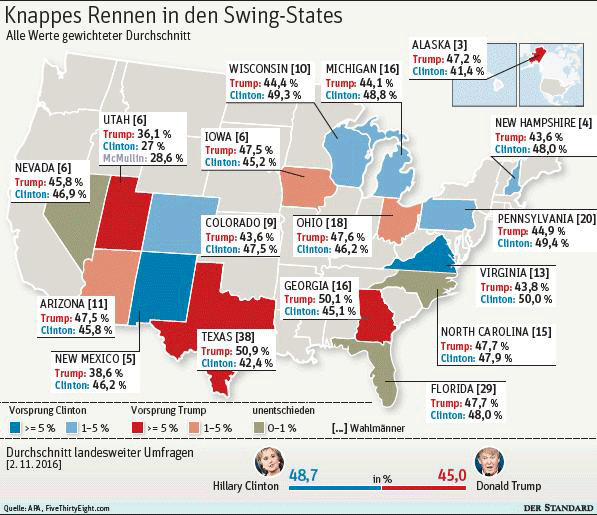Es gab Zeiten, da wusste Lizbeth Martell nicht, wie sie am nächsten Tag über die Runden kommen sollte. In Florida war die Immobilienblase geplatzt, es ging nur noch bergab. Martell – damals alleinerziehende Mutter – verlor ihren Job bei einem Bauunternehmer. "Es war, als wären die Lichter ausgegangen. Ich habe nichts mehr verdient. Null, nada." Aus der Talsohle des Jahres 2008 ging es langsam wieder nach oben. Heute managt Martell eine Hausverwaltung. An den Republikanern gefällt ihr, dass sie Business Business sein lassen, ohne sich viel einzumischen. Der Staat müsse für ein faires Bildungssystem sorgen – und das traut sie dann doch eher den Demokraten zu.
Anfangs fand sie Gefallen an der Kandidatur Donald Trumps fürs Weiße Haus. "Aber dann hat er den Mund aufgemacht", sagt Martell und rollt mit den Augen. Es folgten all die Geschichten über Trumps Umgang mit Frauen. Sie gaben den Ausschlag dafür, dass Martell nun sehr genau weiß, wen sie wählt: Hillary Clinton.
"Der Mann ist ein Schwein", sagt die 43-Jährige. Am Unternehmer Trump hat sie nach wie vor nichts auszusetzen, wohl aber am Politiker Trump: "Er soll endlich Pläne vorlegen und nicht immer nur behaupten: Glaubt mir, ich kann es. Da könnte ich auch sagen: Bald bin ich Queen von England!"
Das halbvolle Glas
Martell sitzt im Puerto Rico's Café, dem Lokal ihrer Mutter in Kissimmee bei Orlando. Es war der Rettungsring der Familie. Die Mutter machte es auf, als sie 1990 aus Puerto Rico kam. Als Tochter musste Lizbeth stets aushelfen, doch jetzt studiert ihre eigene Tochter am College – die typische Generationensaga. Die vielen Puertoricaner hier sehen meist das halbvolle Glas, nicht das halbleere. Politisch sind sie eine schwer zu berechnende Größe: Die meisten sind so wenig auf eine Partei festgelegt wie Lizbeth Martell.
Florida gilt als klassischer "Swing-State". Mit 21 Millionen Einwohnern ist es der bevölkerungsreichste unter den Bundesstaaten, in denen das Pendel mal in die eine, mal in die andere Richtung ausschlägt. Und der ethnisch bunteste: 56 Prozent Weiße, 24 Prozent Hispanics, 17 Prozent Afroamerikaner. Der "I-4-Korridor" entlang der Interstate 4, der Autobahn, die von Tampa bis Daytona Beach führt, ist ein Swing-State im Swing-State: Wer hier die Mehrheit holt, hat in Florida die Nase vorn. Und wer Florida gewinnt, hat gute Chancen aufs Oval Office.
Auf dem Messegelände von Tampa dröhnt Musik. Gleich wird Trump die Bühne betreten, doch Cassie Syska weiß schon, dass sie ihn nicht wählen wird. Sie ist nur aus Neugier gekommen. Syska verkauft Pauschalreisen. Ein karges Gehalt, aufgebessert durch Erfolgsprämien. In 46 Lebensjahren ist es ihr erster richtiger Job. In ihrer Heimatstadt New York war sie Stripperin – Florida sei endlich das Licht am Ende des Tunnels.
Keine Stimme abgeben
Doch die Präsidentschaftswahl treibt sie zur Verzweiflung: "Niemand kriegt meine Stimme." Die hätte nur Bernie Sanders bekommen. "Sanders ist der Einzige, der nicht schlecht über andere redet."
Temple Ohalei Rivka, eine Synagoge am Westrand Orlandos: Saul Senders, seine Frau Marilyn und Elaine Weinberg nehmen sich kein Blatt vor den Mund. "Es geht so hässlich zu, dass ich es nicht fassen kann", klagt Saul Senders, der pensionierter Informatikprofessor aus Pennsylvania, der in der Pension in die Wärme Floridas zog. "Meine Eltern haben den Holocaust überlebt. Ich weiß einfach nicht, warum dieser Hass wieder aufbricht." Trump habe die Büchse der Pandora geöffnet. Um ihn zu verhindern, werden alle drei für Clinton stimmen – wobei sich Weinberg eine Kandidatin Clinton wünschen würde, die fester zu ihren Überzeugungen steht, statt immer so pragmatisch zu sein. "Ist sie mein Idol? Nein, aber ich wäre sehr stolz, würde sie Präsidentin werden."
Weiter über die Autobahn nach Goldsboro: Das ist "Hillary-Land", schwarze Amerikaner sind Clintons verlässlichste Stütze. Doch LaShant Hawkins (41), fünffache Mutter, spricht von einem Motivationsproblem. Sie müsse gegen die Lethargie in der Generation ihrer Kinder anreden. Als Barack Obama antrat, habe man niemanden anzustacheln brauchen. Diesmal fühle es sich an, als sei man aufgefordert, zwischen zwei Übeln das kleinere zu wählen: Clinton.
In DeLand schwirren dann Verschwörungstheorien wie Motten ums Licht. Drei Frauen verbreiten vor dem Gerichtsgebäude haarsträubende Thesen, als wären sie unumstößliche Wahrheiten. Eine handelt davon, dass der Milliardär George Soros die elektronischen Wahlmaschinen liefere und so das Resultat manipuliere, behauptet Candy, eine Trump-Anhängerin.
Harmonie, trotz allem
In Daytona Beach blinzelt Billie Wheeler mit bester Laune in die Sonne. Die Buchhalterin kandidiert für den Gemeinderat. Friedlich und freundlich läuft der lokale Wahlkampf. Konkurrenten vertreiben sich die Zeit, indem sie miteinander plaudern, als seien sie gute Nachbarn. Sicher, auch Daytona Beach habe akute Probleme, etwa die Obdachlosen, sagt Wheeler. Aber irgendwie werde man das schon in den Griff kriegen. Ob Demokraten, Republikaner oder Unabhängige: Hier habe man sich noch immer mit Augenmaß auf Lösungen verständigt.
Ob das im großen Maßstab auch in Washington nach der Wahl gelte? Ob der Ton sachlicher werde, nachdem er diesmal im Wahlkampf so schroff war wie lange nicht? "Ich hoffe, wir Amerikaner erfinden uns wieder einmal neu", sagt Wheeler. "Aber im Moment spüre ich davon noch nichts." (Frank Herrmann von der Interstate 4, Florida, 3.11.2016)