Als Österreichs neue Hoffnung der Linken auszog, um die rechte Reichshälfte zu verteidigen, saß der Anzug perfekt, nur die Krawatte hing etwas schief. Ob die Bundespräsidentenwahl zeige, dass er ein Land von Rassisten regiere, wurde Christian Kern im Interview von einem Journalisten des italienischen Fernsehsenders Rai 3 gefragt. Der Kanzler lächelte erhaben. "Nein, also nein", sagte er im Brustton der Überzeugung. Das Phänomen der starken Rechten lasse sich auch in zahlreichen anderen europäischen Ländern beobachten. Dann kniff der Sozialdemokrat leicht die Augen zusammen und erklärte den Italienern, worum es seiner Ansicht nach wirklich geht: Nicht Fremde, sondern Arbeit, Bildung und Gesundheit seien die großen Themen unserer Zeit.
Das sind die Lieblingsschlagwörter der Sozialdemokraten. Was Kern von seinem Vorgänger unterscheidet: Er setzt sie in einen größeren Zusammenhang. Kurz nach seinem Amtsantritt wärmte der neue SPÖ-Chef die Forderung nach einer Maschinensteuer auf, mit seiner skeptischen Haltung gegenüber dem Freihandelsabkommen Ceta sagt er indirekt den Konzernen den Kampf an, Gerechtigkeit steht wieder im Fokus. Man könnte sagen: Wenn SPÖ-Legende Bruno Kreisky Österreichs Sonnenkönig war, ist Christian Kern nun zumindest der Strahlekanzler. Er gibt der Linken Zuversicht.
Phase der Beliebigkeit
"Nach einer langen Phase der Beliebigkeit bekommen linke Positionen nun wieder schärfere Konturen", formuliert es das rote Urgestein Bruno Aigner, ein enger Mitarbeiter und Vertrauter von Altpräsident Heinz Fischer. Spricht er von linken, meint er damit in erster Linie sozialdemokratische Positionen: "Die SPÖ ist sich immer selbst ihre eigene Linke gewesen."

Das lässt sich kaum bestreiten. Abgesehen von der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ), die seit der Nachkriegszeit nur regional Erfolge verzeichnen kann, gibt es in Österreich keine Partei oder relevante Bewegung links der Sozialdemokratie. "Die Grünen kann man allein aus ihrer Entstehungsgeschichte heraus nicht in das Rechts-links-Schema einordnen", sagt Sieglinde Rosenberger, Professorin für Politikwissenschaften an der Universität Wien. "Sie sprechen Wähler und Wählerinnen aus dem linken, aber genauso aus dem katholisch-konservativen Milieu an."
Doch warum hat es linke Politik in Österreich scheinbar so schwer? In Zeiten, in denen die Sozialdemokraten in fast ganz Europa neoliberale Programme verantworten, mittragen oder zumindest akzeptieren, sprich: sie zusehends in die Mitte rücken – sollte nicht auch in Österreich längst Raum für Politik im linken Spektrum frei geworden sein? Warum profitieren hierzulande nur die Rechten von der Wirtschaftskrise – dem ultimativen Schwächeanfall jenes Systems, das die Linke seit je kritisiert und ablehnt?
Was links überhaupt bedeutet, ist eine Auslegungsfrage. Die beiden politischen Pole stehen immer in Relation zueinander. Rückt eine Partei vom linken oder rechten Rand Richtung Mitte, verschieben sich die Verhältnisse. Ganz grundsätzlich seien aber zwei Merkmale entscheidend, erklärt Rosenberger: "Das eine ist die staatliche Gestaltbarkeit der Wirtschaft." Klassisch links seien die Ablehnung des Kapitalismus und die Forderung nach einer Regulierung des Marktes. "Die zweite linke Kernposition ist, die Folgen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ungleichheiten durch einen starken Sozialstaat abzufedern", sagt die Politologin.
Ein schwaches soziales Netz kann man Österreich freilich nicht nachsagen. Der Blick in Richtung Nachbarländer zeigt dennoch, dass die hierzulande gelebte rote Hegemonie eine europäische Ausnahme darstellt: Bis zur EU-Osterweiterung war die Alpenrepublik der einzige der 15 Mitgliedsstaaten, in dem weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene eine linke Partei neben den Sozialdemokraten parlamentarisch vertreten war. Die ehemaligen Ostblockstaaten, die der Union dann beitraten, stellen einen mit Österreich kaum zu vergleichenden Sonderfall dar, was die Geschichte linker Parteien angeht.
"Die Integrationskraft der SPÖ nach 1945 war erdrückend"
Walter Baier, langjähriger KPÖ-Vorsitzender und mittlerweile Koordinator von Transform, dem Thinktank der europäischen Linken, macht – ähnlich wie Aigner – die Sozialdemokratie dafür verantwortlich, dass sich links von ihr keine Partei etablieren konnte. Er findet jedoch schärfere Worte: "Die Integrationskraft der SPÖ nach 1945 war erdrückend. Sie hat auch intern am linken Flügel alles ausgegrenzt oder ruhiggestellt." Das habe letztlich dazu geführt, dass "Protest in Österreich ausschließlich von der FPÖ artikuliert wird". Bis in die 1980er Jahre sei die SPÖ noch die Partei der Arbeiter und Angestellten gewesen. Doch mit dem aufkommenden Neoliberalismus, ist Baier überzeugt, habe sie diesen Vertretungsanspruch einfach aufgegeben und all jene, die plötzlich unter sozialem Druck standen, in die Arme der FPÖ getrieben. "Die Linke hat die Tendenz, nur auf sich selbst zu schauen", attestiert Baier seinen eigenen Genossen.
Erfolgloser Weg zur Mitte
Die Politikwissenschafterin Rosenberger hat noch eine andere Theorie parat, warum sich die Linke schwerer tue als die Rechte: "Durch die fortschreitende Globalisierung verlieren Nationalstaaten weitgehend Souveränität und Handlungsfähigkeit." Das mache vielen Menschen Angst. "Rechtspopulistische Parteien geben vor, sie könnten dagegen etwas tun, nämlich die Migration stoppen."
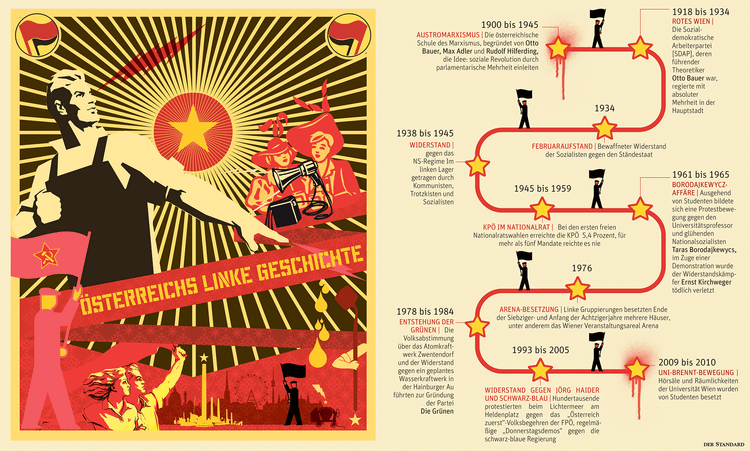
Antworten auf die neuen Herausforderungen einer globalisierten Welt sind die Sozialdemokraten allerdings ebenfalls schuldig geblieben. In Deutschland, sagt der Politologe Gero Neugebauer von der Freien Universität Berlin, habe dieses Versäumnis zur Erstarkung der Linken geführt. "Seit den 1990ern wandert die SPD immer mehr zur Mitte. Grüne und Linke versuchten als Erste, diese Lücke zu schließen." Kanzler Gerhard Schröder habe mit Programmen wie Hartz IV den Boden für die Linkspartei bereitet. Denn die war vorher in Deutschland ebenfalls nicht sonderlich präsent. Im Gegenteil, sagt Neugebauer: "Wir hatten 1969 unseren ersten sozialdemokratischen Kanzler. Der Antikommunismus hat es der Linken lange Zeit sehr schwer gemacht."
"Die SPÖ hat begriffen, dass ihr die Mitte nichts bringt. Darum greift sie nun zum Populismus."
In Österreich wanderte die Sozialdemokratie in den vergangenen Jahrzehnten ebenfalls in die Mitte. Doch in Zeiten, in denen die Rechte kontinuierlich an Wählern gewinnt, sei das die falsche Strategie, ist sich Neugebauer sicher: "Die SPÖ hat begriffen, dass ihr die Mitte nichts bringt. Darum greift sie nun zum Populismus."
Er spricht damit direkt den Kanzler an. Christian Kern ist attraktiv, wortgewandt und weiß sich in Szene zu setzen. Der neue SPÖ-Chef kritisiert offen die neoliberale Sparpolitik der Europäischen Union, bat die Genossen zur Abstimmung über ein Freihandelsabkommen, bloß um sich in seinem Kurs bestätigen zu lassen. Kern beherrscht das Spiel der Staatskunst. In der Realpolitik, etwa dem aktuellen Budget, das die Regierungsparteien beschlossen haben, spiegelt sich sein linker Kurs allerdings kaum wider. "Kern betreibt derzeit in erster Linie massiv Agendasetting", analysiert Rosenberger. "Er setzt mutige Signale", findet Aigner.

Populismus sei in politischen Krisen als Methode immer einsetzbar, erklärt der deutsche Politologe Neugebauer. Das würden auch die Beispiele Spanien und Griechenland zeigen, wo mit Podemos und Syriza zwei linke Bewegungen Wahlerfolge feiern. "Solche Bündnisse sind mit unseren Parteien jedoch nicht vergleichbar", führt Neugebauer aus. Sie würden ein anderes Verhältnis zum Staat pflegen als etwa die Volksparteien in Österreich und Deutschland. Linker Populismus habe mit moderner linker Politik in der Regel nichts zu tun. Phänomene wie Podemos und Syriza seien "eine Art Crossover, die solidarische Moderne". In seiner Reinform sei "'links' paradoxerweise heute nichts mehr, womit man sich in der Politik schmücken könnte", hält Neugebauer fest.
Arroganz der Linken
Zumindest oberflächlich betrachtet, könnte man dieser Aussage den Erfolg der steirischen KPÖ entgegenhalten. Die Partei hält in Graz bei knapp 20 Prozent der Stimmen und stellt mit Elke Kahr die Vizebürgermeisterin. Zudem sitzen zwei kommunistische Mandatare im steirischen Landtag. Der Erfolg ist dem strikten Fokus auf Sachpolitik geschuldet. "Wir mussten uns das Vertrauen der Wähler erarbeiten", sagt Kahr. Sie kritisiert eine weitverbreitete Arroganz unter den Linken: "Man muss die Menschen so nehmen, wie sie sind, nicht so, wie man sie sich wünscht."
Konkret hat sich die Grazer KPÖ dem Thema Wohnen gewidmet. Dieses heikle Ressort wurde ihr von den anderen Parteien in der Stadtregierung überlassen – "wohl in der Hoffnung, wir würden daran scheitern", erzählt Kahr. Doch das Gegenteil passierte. Die Kommunisten konzentrierten sich voll und ganz auf das eine Thema. "Wir haben uns dadurch eine gewisse Kompetenz erarbeitet. Das schätzen die Leute." Trotz allem gesteht sich die überzeugte Marxistin Kahr ein: "Die Mehrheit wählt uns nicht, weil, sondern obwohl wir Kommunisten sind." Von linken Zusammenschlüssen nach dem Vorbild der Südeuropäer hält sie wenig: "Ich würde die KPÖ nie aufgeben."

Einen anderen Weg, den der linken Zusammenarbeit, schlägt die Initiative "Aufbruch" ein. Dahinter steht der erneute Versuch, ein Linksbündnis in Österreich zu etablieren. Das erste Treffen dieses Sammelbeckens außerparlamentarischer linker Opposition fand im Juni statt. "Wir haben mit rund vierhundert Leuten gerechnet, schlussendlich kamen um die tausend", erzählt Christine Heindl, ehemalige grüne Nationalratsabgeordnete und Mitinitiatorin. Noch sei die junge Bewegung unschlüssig, ob sie zur Partei werden möchte, Ende Oktober wolle man mit bundesweiten Aktionen unter dem Motto "Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten" auf sich aufmerksam machen.
Bruno Aigner hofft zwar auf eine "Renaissance der Politik", einer organisierten Form der neuen Linken gesteht er zum heutigen Zeitpunkt allerdings "keine großen Chancen" zu. "Es wird spannend, ob sich nun für linke Politik eine neue Gelegenheit bietet", sagt Neugebauer. "Völker, hört die Signale", lautete einst der Schlachtruf der Arbeiterschaft. Vielleicht ist das letzte Gefecht noch nicht geschlagen. (Steffen Arora und Katharina Mittelstaedt, 15.10.2016)
