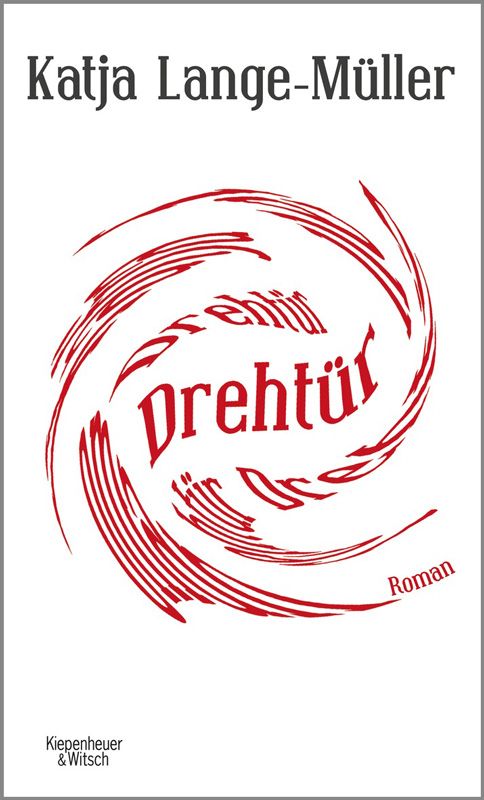STANDARD: Haben Sie mit dieser enormen Resonanz auf Ihren neuen Roman gerechnet?
Lange-Müller: Nein, wenn man als Schriftstellerin Derartiges erwartet, ist man im falschen Beruf, aber natürlich freut es mich, dass meine hysterischen Tentakel etwas erfasst haben, wofür sich außer mir noch ein paar Leute interessieren.
STANDARD: Vom "Buch der Stunde" ist die Rede. Fangen Sie mit derlei Apostrophierungen etwas an?
Lange-Müller: Das Thema lag ja schon länger in der Luft. Ich habe gespürt, etwas ist faul am Helfen, dieser quasi letzten und unantastbar heiligen, prinzipiell guten Domäne des Humanismus. Erst im vorvergangenen Sommer wurde das Helfen plötzlich wieder total en vogue; allerdings verstand man darunter, irgendwelche Plüschtiere, mit denen die eigenen Kinder eh nicht mehr spielen wollten, in die Flüchtlingsmenge zu werfen, und das ist nun ganz und gar nicht die Art von Hilfe, um die es in Drehtür geht.
STANDARD: Sondern?
Lange-Müller: Es geht darum, welche Verantwortung du übernimmst, wenn du wirklich hilfst. Und wie das schlaucht. Und wie anstrengend das ist. Wie frustrierend mitunter auch, denn manchmal hilft das Helfen ja gar nicht, wie wir alle wissen.
STANDARD: Ist das so?
Lange-Müller: Das ist wohl so. Dazu kommt im Kontext der meisten internationalen Hilfsorganisationen, dass diese sogenannte Hilfe denen, die sie brauchen, mitunter ein wenig suspekt ist. Es geht ja immer auch darum, eine gewisse Überlegenheit zu demonstrieren, nicht nur auf medizinischem Gebiet. Daraus erwächst Hierarchie: Der Hilfsbedürftige ist vom Helfenden abhängig. So gesehen hat das Helfen eine glänzende Vorderseite und eine weniger glänzende Rückseite.
STANDARD: Ging es Ihnen denn von Beginn an um diese Rückseite?
Lange-Müller: Überhaupt nicht. Mein Fokus lag ursprünglich woanders. Der hat sich erst verschoben, als ich anfing, mich ernsthaft mit der helfenden Industrie zu beschäftigen.
STANDARD: Ein vermintes Feld ...
Lange-Müller: Fürwahr! Da müsstest du Fachjournalisten losschicken, die das wirklich interessiert. Du kommst nicht so leicht an echte Informationen. Die veröffentlichen in puncto Kosten kaum Zahlen. Du weißt nur, der Aufwand ist riesig, und auf welche Weise bzw. durch wen das alles finanziert wird, ist ziemlich unklar, allein mit Spenden vermutlich nicht.
STANDARD: Wir sprechen jetzt von Organisationen wie Care International oder Ärzte ohne Grenzen, für die Asta, die Protagonistin des Romans, viele Jahre als Krankenschwester gearbeitet hat ...
Lange-Müller: Mein Buch ist ja nun keines über Care und Co. So eins müsste auch dringend geschrieben werden, aber nicht von mir. Ich wollte mich doch eher auf Asta konzentrieren.
STANDARD: Weil Ihnen das andere Thema zu heiß war?
Lange-Müller: Nein, zu heiß wird mir so schnell nichts. Der Grund ist ein anderer: Eine meiner Kernthesen lautet, dass ein Text vor allem dann ein literarischer ist, wenn er so nur von dem einen Autor geschrieben werden konnte, der ihn eben geschrieben hat – und von keinem sonst.
STANDARD: Muss Literatur durch die Biografie des Autors beglaubigt sein?
Lange-Müller: In gewisser Weise, ja. Das heißt nicht, dass er oder sie das Erzählte empirisch erfahren haben muss, aber Erlebnisse, die als Ausgangspunkt des Schreibens dienen, schaden sicher nicht. Das ist ja das Problem vieler junger Autoren. Unter denen gibt es große Schreibtalente, nur fehlt es ihnen schlicht und ergreifend oftmals an Stoff.
STANDARD: Also an Dringlichkeit?
Lange-Müller: Genau. Es ist schon so, wie Heine es sagt: "Wir ergreifen keine Idee / sondern die Idee ergreift uns / und knechtet und peitscht uns in die Arena hinein / dass wir wie gezwungene Gladiatoren für sie kämpfen."
STANDARD: Klingt ziemlich hero-isch, martialisch beinah.
Lange-Müller: Ja, das ist eben Heine. Sie können es natürlich auch in vollendeter Weisheit von Fernando Pessoa haben: "Der Poet verstellt sich, täuscht / so vollkommen, so gewagt, / dass er selbst den Schmerz vortäuscht, / der ihn wirklich plagt."
STANDARD: Ist denn – anders als bei Gericht – in der Literatur die Täuschung der Wahrheitsfindung zuträglich?
Lange-Müller: Zunächst schon, damit der Schmerz überhaupt einmal aushaltbar wird. Die Täuschung schafft ja auch Distanz.
STANDARD: Ist also die eigene Schmerzerfahrung eine literarische Voraussetzung?
Lange-Müller: Davon ist auszugehen. Wenn ein erzählender Text so gar nichts Autotherapeutisches hat, kommt selten einmal Literatur dabei heraus.
STANDARD: Da würden die meisten Ihrer Kolleginnen und Kollegen wohl Einspruch anmelden.
Lange-Müller: Weil sie es nicht zugeben können oder wollen.
STANDARD: Kommt beim Schreiben nicht so oder so nur ganz selten Literatur heraus?
Lange-Müller: (lacht) Allerdings. Ich weiß ja nicht mal, ob bei mir Literatur rauskommt. Wirklich entschieden wird das ohnedies erst nach meinem – mehr oder weniger seligen – Ableben.
STANDARD: Wenig selig ist das Ende von Asta Arnold in Ihrem Roman. Nach ein paar Stunden vor einer Drehtür am Münchner Flughafen und 21 Kette gerauchten Zigaretten erleidet sie einen Herzinfarkt, den sie möglicherweise nicht überleben wird; zumindest trifft sie entsprechende Vorkehrungen, die eine Rettung verhindern sollen. Der Rezensent der "NZZ" meint sogar, dass einem in der Literatur die grausame Banalität des Sterbens selten "so unverblümt, so bildstark, so abgründig" vor Augen geführt worden sei.
Lange-Müller: Da weiß er nun mehr, als ich zugeben konnte. Ich habe es schlichtweg nicht übers Herz gebracht, sie eindeutig sterben zu lassen.
STANDARD: Leidet sie an dem, was gemeinhin als Helfersyndrom bezeichnet wird?
Lange-Müller: Aus der diagnostischen Perspektive betrachtet, kommt das wohl hin, aber es geht mir beim Schreiben ja nicht um einen klinischen Befund.
STANDARD: Asta selbst äußert sich dazu im Roman recht klar, ich zitiere: "Das Bedürfnis, dem Artgenossen beizustehen, das wir mit vielen Tieren teilen, selbst so niederen und unsympathischen wie Wespen oder Ameisen, nannten und nennen neunmalkluge Schwachköpfe Helfersyndrom, als sei das eine multiple, entsprechend komplizierte Krankheit, eine Psycho-Seuche, die nur Exemplare unserer Gattung befällt."
Lange-Müller: Das müssten Sie eigentlich Asta fragen oder einen von denen, die sie als neunmalkluge Schwachköpfe bezeichnet. Ich denke, es hat mit dieser Erschöpfung zu tun. Es gibt einfach keinen Raum für Reflexion, weil du immer beschäftigt bist, immer unter Menschen, aber auch sehr einsam im Grunde. Das bleibt ja alles recht oberflächlich, du versorgst Fleischwunden oder Knochenbrüche, also eher menschliche Körperteile als den Menschen selbst. Eine Fleischwunde bleibt eine Fleischwunde ...
STANDARD: Gilt das nicht für viele Berufe?
Lange-Müller: Sicher. Ich erlebe das ständig in meinem Umfeld, dass Menschen von hundert auf null runtergefahren werden, weil sie einen Schlaganfall erlitten haben, in die Rente bugsiert oder sonst wie aus dem Tumult gezogen worden sind. Die braucht keiner mehr, und nun stehen sie da mit einer Menge Leben, das noch vor ihnen liegt, und wenn sie sich nicht rechtzeitig ein Steckenpferd angeschafft haben, das sie reiten können, wird es finster.
STANDARD: Asta bewegt sich in einem Milieu, das Ihnen nicht fremd ist.
Lange-Müller: Ich war zwar nur pflegerische Hilfskraft, aber wir haben da natürlich auch alles gemacht, was eigentlich nur diplomierten Krankenschwestern vorbehalten war. Die auf der untersten Stufe der Helfer-Hierarchie sind ja literarisch nicht so relevant, über die gibt es eigentlich nur dreckige Witze. Und obwohl ich dieser Arbeit schon so viele Jahre nicht mehr nachgehe, verfolgen mich Träume, die jeden verfolgen, der mal in dem Bereich tätig war.
STANDARD: Das klingt übel.
Lange-Müller: Das ist auch übel, wenn du mitten in der Nacht schweißgebadet aufwachst, weil du davon geträumt hast, dass du deinen Dienst versäumst. Die Straßenbahn ist ausgefallen, und du weißt nicht, ob du da noch hinmusst oder ob du nicht doch schon deine Kündigung abgeschickt hast oder eben erst einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben. In solchen Momenten fängst du an nachzudenken.
STANDARD: Worüber?
Lange-Müller: Na darüber, was aus dir geworden wäre, wenn du dabei geblieben wärst. Ich wäre bestimmt auch zu einer Organisation wie Ärzte ohne Grenzen und ins Ausland gegangen.
STANDARD: Zumal Ihnen das Weggehen nicht fremd ist. Sie sind in der DDR aufgewachsen und 1984 nach Westberlin ausgereist. – Verglichen mit manchen Ihrer Kollegen gehen Sie mit der DDR weniger hart ins Gericht ...
Lange-Müller: Das hat immer mit dem zu tun, was man am eigenen Leib erfahren hat. Ich war nicht im Knast, bin nur aus der Schule geflogen. Bei mir ist die Pubertät quasi nahtlos ins Dissidententum übergegangen. Die subtilen Schikanen der Stasi blieben auch mir nicht erspart, aber der Status meiner Mutter (Inge Müller war hochrangige SED-Funktionärin, Anm.) hat mich sicher vor Schlimmerem bewahrt. Das Leben in der DDR war kein Zuckerschlecken. Doch da ich längere Zeit in Rumänien gelebt habe, weiß ich, verglichen mit der Securitate war die Stasi eine Goldhamstertruppe.
STANDARD: Einige dieser Goldhamster haben es sich im wiedervereinigten Deutschland ziemlich schnell wieder gemütlich gemacht, was heute nur mehr eine Minderheit zu kümmern scheint. Wie kam das?
Lange-Müller: Irgendwann sagten sich die Leute im Westen: Was kümmert mich der Schnee von gestern im ehemaligen Nachbarstaat? So einfach ist das.
STANDARD: Oder so kompliziert ...
Lange-Müller: Oder so kompliziert.
STANDARD: "Drehtür" ist Ihre erste Romanveröffentlichung seit 2007. Braucht es neun Jahre, um einen guten Roman zu schreiben?
Lange-Müller: Zum Schreiben nicht, aber ich muss schon immer 'ne ganze Menge Leben nachladen, um wieder ins Schreiben zu kommen.
STANDARD: Das klingt nach Überwindung.
Lange-Müller: Ja, ich schreibe nicht so gerne. Für mich ist das echt anstrengend, weil ich eine extrem skrupulöse Autorin bin. Ich könnte mein Leben lang an ein und denselben dreißig Seiten schreiben.
STANDARD: Und was tun Sie, damit es dann doch ein paar Seiten mehr werden?
Lange-Müller: Ich habe einen Zettel mit einem Satz von Beckett an meinen Computer geklebt: "Es lohnt sich nicht, den Wörtern den Prozess zu machen, sie sind nicht leerer als ihr Inhalt. (Josef Bichler, Album, 24.9.2016)