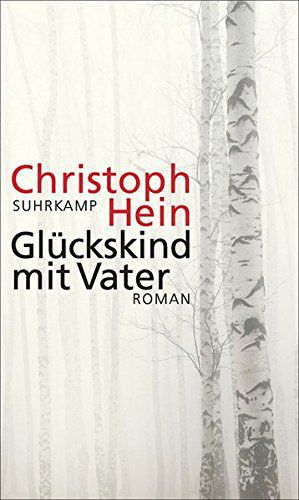Ich verdanke dir mein Leben. Du warst mein Glückskind, Junge", wird die Mutter später zu ihm sagen, wenn sie vom Ende des Krieges erzählt, als plötzlich ein russischer Offizier vor der Tür stand und sie verhaften wollte. Aber was heißt da "Glück"? An diesem Tag fing das Verhängnis an. Die damals hochschwangere Mutter ist die Ehe-frau eines Kriegsverbrechers, das "Glückskind", das wenige Wochen später zur Welt kommt, wird seinen Vater nie kennenlernen, und doch wird dieser Vater das ganze Leben des Nachgeborenen bestimmen. Konstantin Boggosch wird ihn nie mehr los, auch als er schon längst ein nach außen hin beschauliches Leben in einer ostdeutschen Kleinstadt führt, wird er von der Schuld des Vaters noch einmal heimgesucht.
Aber kehren wir in das Jahr 1945, in die deutsche Ostzone zurück: Damals ist mit einem Schlag das Leben der Familie ruiniert, Konstantins Vater wird in Polen hingerichtet, die Witwe verliert ihren sozialen Status und bekommt nie wieder in ihrem Leben eine Chance. Ihr Mann, der Nazibonze und "Klassenfeind", nimmt die Familie in Sippenhaft. Da nützt auch nichts, dass die Witwe wieder ihren Mädchennamen annimmt, damit wenigstens ihre Kinder nicht mit dem Namen eines Verbrechers aufwachsen müssen.
Der Makel der Herkunft, vielmehr müsste man Erbschuld sagen, bleibt dennoch. Der tote Vater versaut dem Sohn das Leben, und der fragt sich oft: Wieso? "Ich habe doch nichts mit ihm zu tun. Nichts, gar nichts. Warum werde ich bestraft?" Das beginnt schon in der Schule: Konstantin ist Klassenbester, aber er darf nicht auf die Oberschule gehen und Abitur machen. Also beschließt der Vierzehnjährige, das Land zu verlassen. Immerhin beherrscht er vier Sprachen, war doch die Mutter, die ihren Beruf nur nicht ausüben darf, früher Sprachenlehrerin.
Prägende Schule des Lebens
Es folgen drei glückliche Jahre in Marseille, die zur prägenden Schule des Lebens werden. Vier ehemalige Résistance-Kämpfer nehmen sich des jungen Mannes an. Sie beschäftigen ihn stundenweise für Übersetzungsarbeiten, zahlen ihm die Abendschule und versorgen ihn mit Literatur. Vor allem, sie erzählen dem "kleinen boche" vom "richtigen" Leben auf der anderen Seite: Alle vier Kameraden waren im Widerstand, waren im KZ. Dort wurden sie von einem brutalen SS-Mann gequält, in dem Konstantin seinen Vater wiederzuerkennen glaubt. Dessen langer Schatten, dem er doch entkommen wollte, hat ihn nun auch in Frankreich eingeholt. Also bleibt ihm wieder nichts anderes übrig, als davonzulaufen.
Genau darin liegt der eigentliche Kunstgriff des Romans, denn Christoph Hein schickt seinen Helden in die DDR zurück, zurück ins System Unfreiheit, zurück in die Vergangenheit mit Vater. Wenn man an die bürgerlichen Bildungsromane denkt, die ihr Muster gerade der deutschen Literatur so erfolgreich übergestülpt haben, dann bewegt sich dieser Held auf Gegenkurs. Ein Entwicklungsroman mit Schubumkehr: Ausgerechnet im August 1961, in Berlin wird gerade die Mauer gebaut, meldet sich Konstantin in die DDR zurück, freiwillig, obwohl ihm ein ganz anderes Leben offengestanden wäre. In Frankreich war er in die Welt der Literatur, der Vielsprachigkeit und des Films eingetaucht. Und jetzt? Statt Nouvelle Vague graues DDR-Kino, graue DDR-Wirklichkeit.
Die sieht zum Beispiel so aus: An der Abendschule kann Konstantin zwar das Abitur nachholen, aber als er an die Filmhochschule in Babelsberg möchte, klatscht ihm wieder die Ohrfeige des Systems ins Gesicht: Er ist talentiert, schafft als einer von wenigen die Aufnahmeprüfung, aber der Studienplatz bleibt ihm dennoch verwehrt, dick steht in seiner Kaderakte: Konstantin Boggosch ist der Sohn eines Kriegsverbrechers ...
Das System bestimmt, am Ende fragt auch das Leben nicht, der Schatten des Vaters begleitet den Sohn auch noch weit über die Wende hinaus. Der bringt es zwar immerhin zum stellvertretenden Direktor eines Provinzgymnasiums, aber die Betonung liegt auf Provinz und der damit verbundenen Versagung aller Ansprüche eines freien Lebens.
Das ist natürlich auch ein kollektives Trauma, und man könnte den Roman in einem Satz zusammenfassen: Man kann sich der Geschichte nicht entziehen, also muss man sie erzählen. Das hat Christoph Hein getan – im guten, im besten Sinn. Und im Ansatz mag das ein wenig auch seine eigene Geschichte sein, denn auch er bekam, als Sohn eines Pfarrers, keinen Platz an der Oberschule, ging deswegen auf ein Westberliner Gymnasium und kehrte, als die Mauer gebaut wurde, in die DDR zurück. Das allein schon wäre Stoff genug. Mit gescheiterten Revolutionen hat sich Hein ja mehrfach auseinandergesetzt, mit seinem Roman Landnahme hat er 2004 ein Stück deutsche Aufarbeitung vorgelegt. Nun hat er ein wenig weiter ausgeholt und einen großen Deutschlandroman geschrieben, der vielleicht mit etwas zu viel Tiefenpsychologie aufwartet, aber dennoch seinen künftigen Platz im Kanon jener Literatur haben wird, in der die Verwerfungen des 20. Jahrhunderts ihren mythischen Abdruck hinterlassen haben. (Gerhard Zeillinger, Album, 13.8.2016)