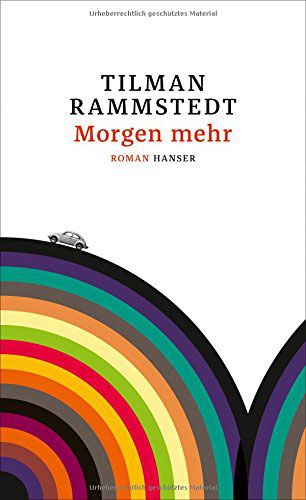Der Literaturbetriebsausflug zum Wörthersee bringt Namen in Umlauf. Einige, die den Bachmann-Preis gewonnen haben, sind mittlerweile Fixsterne am Himmel der Sprachkunst. Ob jedoch Jens Petersen, Peter Glaser oder Jan Peter Bremer heute nicht nur eingeschworenen Spezialisten was sagen, scheint fraglich.
Tilman Rammstedt freilich sollte man auf der Bücherliste haben. Den Preis erhielt er 2008 zugesprochen. Vier Jahre später erntete er viel Lob für sein einfallsreiches Buch Die Abenteuer meines ehemaligen Bankberaters, in dem die Titelfigur den Namen des Autors trägt und dieser als Erzähler den Filmstar Bruce Willis um Hilfe bittet, da er mit dem Manuskript nicht weiterkomme.
Nun legt er wieder einen höchst gewitzten Roman vor, dem er eine delikate, ja irreale Perspektive verschreibt. Der Erzähler ist noch nicht geboren und steht vor der schwierigen Aufgabe, seine Eltern an einem Junitag 1972 zu seiner Zeugung zusammenzuführen. Die Voraussetzungen könnten ungünstiger nicht sein. Die Mutter liegt in Marseille im Bett und arbeitet die To-do-Liste ihrer verstorbenen Zwillingschwester Eva ab, Punkt 19: "Mit einem schwermütigen Franzosen schlafen"; der Vater wird gerade von einem Dimitri, der eigentlich Uwe heißt und sich zum Unterweltkönig berufen meint, mit einbetonierten Füßen in den Main geworfen.
Kurioses Personal
Nicht weniger kurios ist das übrige Personal, auch der Inhalt eines Koffers, der im Text bis zum Schluss mysteriös von einem "Platzhalter" ersetzt ist, sodass die Handlung bis zum (vorläufigen) Showdown auf dem Eiffelturm mitunter an Aberwitz kaum zu überbieten ist.
Sie spielt an einem einzigen langen Tag, der Romantitel ist, so gesehen, ein uneingelöstes Versprechen: Morgen mehr. Die noch nicht erfolgte Zeugung allerdings findet sich in der Perspektive der prekären Ich-Erzählung selbst sprachlich dauernd im Voraus behauptet, die Hauptfiguren sind stets als "mein Vater" und "meine Mutter" bezeichnet. Letztere stand so sehr im Schatten ihrer Zwillingsschwester, dass sie auf deren "Ich heiße Eva" nur sagte: "Ich nicht."
Zwei hilflos Verlorene, die sich jeweils "am anderen Ende der Geschichte" befinden, sollen also aufeinander zusteuern, lautet die Spielanordnung. Darüber hinaus bietet Rammstedt in gefinkelter Konstruktion und Motivik (besonders vielfältig gelungen: das Zeitmotiv) ein amüsantes Beispiel des Zufalls menschlicher Existenz.
Zufall menschlicher Existenz
Das Setting ist in Literatur und Film recht beliebt. Es führt in die Zeit zurück, es vermag – zielstrebig und doch das Paradox der Nichteinlösung im Blick – vor Augen zu führen, wie wenig wahrscheinlich es ist, dass alles bis zur Geburt einer Person hin verläuft. Gewiss, eine Binsenweisheit. Rammstedt gewinnt ihr skurrile Episoden ab, aber ein paar Effekte knallen doch zu stark, einiges ist zu flapsig genrehaft gestaltet (dem unbedarften Dimitri ist "ein wenig langweilig" geworden, und "er nahm sich vor, beim nächsten Mal besser ein Buch mitzubringen, er musste zu Hause irgendwo noch eines haben").
Originell das Lesevergnügen fördernd treibt Rammstedt die Geschichte voran, in entsprechend atemlosem Duktus. Unterbrochen von einer Satire der Paris-Klischees und von einer Simplifizierung des Schrödinger'schen Katzen-Gedankenexperiments, gar von einem Interview mit einem Hammer, dazu Einträge auf Listen, die als Kurzfragmente eines Lebensplanes herhalten.
Das Leben ist unwahrscheinlich, die Liste gibt Ordnung vor. Wie auch die eingestreuten knappen Inventur-Kapitelchen unter den Überschriften "Was wir bislang wissen" oder "Was wir noch nicht wissen". Allen ist auf leicht neobarocke Art ein Plothinweis als Untertitel so vorangestellt, dass es von vornherein ungewöhnlich klingt: "Einundzwanzigstes Kapitel, in dem einem Ruhestand hinterhergefahren wird und ein Käfer vom Buchumschlag in die Geschichte gerät."
Die Zeit spricht für sich
Einfallsreich spannt Tilman Rammstedt seinen Prosabogen über die üblichen Grenzen hinaus. Im postmodernen Flair lässt er auch Allegorien wie "die Traurigkeit" zu Wort kommen, oder: Die 70er-Jahre "wollten so gern die Zukunft sein, auf die sich alle jahrzehntelang gefreut hatten, sie wollten so vieles einlösen, und wussten doch genau, dass sie dabei nur enttäuschen konnten". Die Zeit spricht für sich. Und das letzte ist ein "Schaltkapitel", das sogar formal über den Textrahmen hinausführt, ja ins Impressum hineinspielt.
Alles im Fluss, wie die Zeit. "Das ist alles möglich, wenn auch nicht besonders wahrscheinlich", heißt es auf den literarischen Möglichkeitssinn verweisend, "aber noch war auch ich möglich, wenn auch ebenfalls wenig wahrscheinlich, und viel Zeit blieb mir nicht mehr". So gestaltet Tilman Rammstedt zudem einen genüsslichen Konter der offenbar gerade modischen Autobiografie-Verschreibungen: "Seine eigene Geschichte kann man ja gar nicht erzählen, jedenfalls nicht so, dass sie einem irgendjemand glaubt." (Klaus Zeyringer, Album, 6.8.2016)