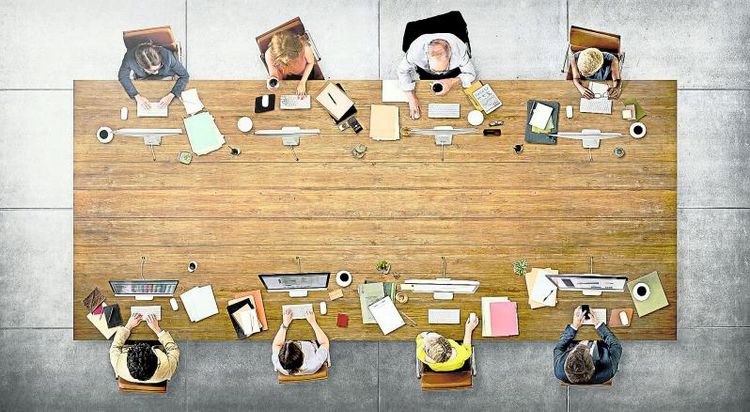
Fällt das Wort Start-up, sind Klischees von hippen Jungunternehmern meist nicht weit. Die Regierung will nun das ganz reale Potenzial von Technologieunternehmen stärker heben.
Wien – Dass er Kontakte zur Start-up-Szene knüpfen und sich damit als Regierungschef mit Wirtschaftskompetenz profilieren will, hat Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) von seiner Angelobung weg signalisiert. Nun machte er die vom Wirtschaftsministerium unter Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) vorangetriebene Gründeroffensive zum ersten größeren Projekt, um die versprochene Umsetzungseffizienz des Zweiergespanns unter Beweis zu stellen. Mit dem am Dienstag vorgestellten Maßnahmenpaket will man explizit nicht alle Neugründungen von Unternehmen fördern, sondern nur jene in Technologiebranchen mit Aussicht auf schnelles Wachstum und entsprechend vielen Mitarbeitern.
Das soll Wachstum und neue Arbeitsplätze bringen. Bis 2020 sollen 1000 zusätzliche Gründungen ermöglicht werden, die Rede ist von 10.000 bis 15.000 neuen Jobs. Österreich soll als Standort für die Gründerszene an Attraktivität gewinnen, ein durch Studien dokumentierter Rückfall wettgemacht werden.
100 Millionen weniger Lohnnebenkosten
Insgesamt fließen über drei Jahre verteilt 185 Millionen Euro, die Summe setzt sich zusammen aus Fördergeldern und Abgabenerleichterungen. Dazu kommen Garantien in Höhe von 100 Millionen Euro. Zu den wichtigsten Punkten des Pakets gehört die Senkung der Lohnnebenkosten. Für die ersten drei Mitarbeiter eines neu gegründeten Unternehmens sollen in den ersten drei Jahren die Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung entfallen: im ersten Jahr nach der Gründung komplett, im zweiten zu zwei Dritteln, im dritten zu einem Drittel.
Kosten soll das den Staat jährlich 100 Millionen Euro, je zur Hälfte aus den Budgets von Wirtschafts- und Infrastrukturministerium. Damit kommt man einem oft geäußerten Wunsch der Arbeitgeberseite nach – auch wenn sich die Wirtschaftskammer eine generelle Senkung der Lohnnebenkosten auch über den Technologiebereich hinaus vorgestellt hätte.
Zur Frage, was unter den Begriff "Start-up" falle und was nicht verwiesen Kern und Mitterlehner auf einen Kriterienkatalog der EU. Das Unternehmen muss über ein innovatives Produkt, eine innovative Dienstleistung oder ein innovatives Verfahren verfügen, muss auf schnelles Wachstum ausgerichtet und darf maximal fünf Jahre alt sein, außerdem muss der Hauptstandort in Österreich liegen. Man stärke bewusst Start-ups, weil diese besonders viel für den Arbeitsmarkt brächten, so Kern. Auf bestimmte Branchen und Unternehmensgruppen zugeschnittene Förderprogramme gebe es viele, es handle sich also um eine sachliche Differenzierung und nicht um eine Ungleichbehandlung.
Rückerstattung für Investoren
Auch Investitionen in Start-ups werden angekurbelt, Fördertöpfe für Gründer um insgesamt 30 Millionen Euro pro Jahr ausgeweitet. Außerdem soll institutionellen und privaten Investoren schmackhaft gemacht werden, ihr Geld in Start-ups zu stecken. Wichtigstes Instrument dazu ist eine Risikoprämie, einer der größten Brocken im Maßnahmenpaket. Wer Geschäftsanteile an Start-ups erwirbt, erhält bis zu 20 Prozent der Investitionssumme vom Staat rückerstattet. Unterstützt werden kumulierte Investitionsbeträge bis zu 250.000 pro Jahr.
"Wir wollen nicht nur große Investoren anziehen, sondern auch Stiftungen und Privatpersonen dazu bringen, zu investieren", so Kern. Trotz der vielen Geschenke hat man der Gründerszene einen anderen Wunsch verwehrt: Ein steuerlicher Freibetrag für Firmenbeteiligungen bis 100.000 Euro kommt nun doch nicht.
Dafür werden Formalitäten bei der Gründung vereinfacht. Indem Anträge über eine zentrale Stelle laufen, soll die Betriebsanmeldung in Zukunft halb so lange dauern wie bisher. Gründer können die Daten über ein Online-Portal eingeben und sollen sich so Behördenwege ersparen. (Simon Moser, 6.7.2016)