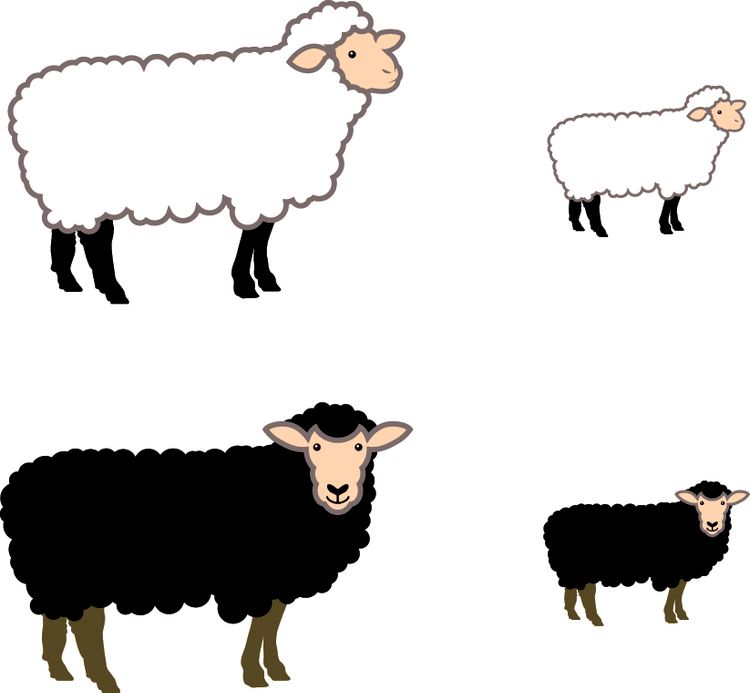
Wer sind die schwarzen Schafe? Ermittler müssen das klären.
Wien – Um die Panama-Leaks-Enthüllungen einordnen zu können, ist es ratsam, die Affäre für einen Moment zurückgelehnt zu betrachten. Was sehen wir da? Die bisher publizierten Dokumente sind Zeugnis einer gewaltigen Verschiebeaktion. Oligarchen, Politiker, reiche Privatleute und Unternehmer aus dutzenden Ländern haben mithilfe professioneller Berater über Jahrzehnte hunderte Millionen Euro nach Panama und in andere Steueroasen geschafft und dort geparkt.
Die Details dieser Transaktionen sind interessant. Per se illegal ist es aber nicht, Geld in einer Oase zu parken. Die spannende Frage lautet also, wie viele von den verschobenen Geldern schmutzig waren, also aus illegalen Quellen stammten. Zwei Verdächtigungen schwirren durch den Raum: Geldwäsche und Steuerhinterziehung. So könnten russische Oligarchen Panama benutzt haben, um Gelder aus Straftaten reinzuwaschen. Andere, wie der Fußballstar Lionel Messi, werden bezichtigt, Steuern hinterzogen zu haben.
Ob aus den Verdächtigungen je Anklagen werden, ist offen. Sicher ist, dass die Ermittlungen langwierig sein werden. Denn in den meisten Fällen dürften internationale Rechtshilfeersuchen, etwa an Russland oder Panama, nötig sein, um die Sachverhalte aufzuklären, sagen Fachleute.
Terror bringt die Wende
Derweil wird sich in der Öffentlichkeit der Eindruck verfestigen, weltweit würde gegen vermeintlich illegale Praktiken nichts unternommen werden. Aber das ist nicht richtig. In den vergangenen Jahren ist sogar eine Flut an Gesetzen erlassen worden, um Geldwäsche und Steuerhinterziehung in den Griff zu bekommen.
Die Regeln gegen Geldwäsche wurden seit den Anschlägen von 9/11 auf Druck der USA sukzessive verstärkt. Auch in Österreich ist das der Fall, wo Banken bei Verdacht auf Geldwäsche ihre Kunden seit Jahren ohne richterliche Verfügung beim Bundeskriminalamt melden müssen, Bankgeheimnis hin oder her.
Schwarze Listen
Die internationale Koordination läuft über eine 1989 gegründete Organisation, die FATF. Diese gibt zwar nur Empfehlungen ab. Doch Länder, die nicht mit der FATF zusammenarbeiten, landen auf einer schwarzen Liste, "und das will aus Furcht vor wirtschaftlichen Nachteilen niemand", sagt der Wiener Steuerexperte Rainer Brandl von der Kanzlei LeitnerLeitner.
Die wichtigste Empfehlung der FATF an Banken – Kenne deine Kunden! – ist daher weltweit mit wenigen Ausnahmen (Iran, Nordkorea) rechtlich umgesetzt. Will also ein Strohmann für eine Scheinfirma ein Bankkonto eröffnen, sind Kreditinstitute weltweit verpflichtet, den wahren Eigentümer der Gesellschaft festzustellen. Sie müssen herausfinden, woher das Geld kommt, etwa indem sie um Urkunden ersuchen.
Zentrales Register
Diese Sorgfaltspflichten sind in der EU mit einer Geldwäscherichtlinie festgelegt. Die neueste Auflage der Richtlinie, die vierte, ist beschlossen und muss auch in Österreich bis 2017 umgesetzt werden. Eine Neuerung ist die Einrichtung eines zentralen Registers, in dem die wahren Eigentümer von Briefkastenfirmen festgehalten werden sollen.
Während der Kampf gegen Geldwäsche forciert wurde, hinkten Initiativen gegen Steuerflucht hinterher. So konnten Banken selbst in Europa, wenn es "nur" darum ging, festzustellen, ob ein Kunde sein Vermögen korrekt versteuert hat, legal wegsehen.
Steuerskandale und die Finanzkrise haben auch hier zu Änderungen geführt. Die OECD hat einen globalen Standard ausgearbeitet, mit dem ab 2017 steuerrelevante Daten von Privatpersonen und Unternehmen grenzüberschreitend ausgetauscht werden. Erfasst werden Dividenden- und Zinszahlungen ebenso wie Veräußerungsgewinne. Abgestellt wird auf wirtschaftlich Berechtigte.
Rückendeckung
Bis auf Bahrain, Vanuatu, Nauru und Panama sind alle Staaten dabei. Panama hat 2015 zugesagt, mitzumachen, legt sich aber seither quer. Das Land erhielt dafür Rückendeckung durch größere Staaten, sagt Pascal Saint-Amans, oberster Steuerexperte der OECD, im STANDARD-Gespräch. Panamas Regierung habe für den Ausbau des Panamakanals in den vergangenen Jahren Bedingungen gestellt, was seine Freiheiten als Finanzplatz betrifft. "Mehrere Staaten" sind darauf eingegangen, sagt Saint-Amans, ohne Details zu nennen. "Doch nach den neuesten Enthüllungen gehe ich davon aus, dass Panama seinen Widerstand gegen den Infoaustausch fallenlassen wird", so Saint-Amans.
Großer Spielraum
Der automatische Austausch von Steuerdaten kommt, Geldwäscheregeln werden strikter: Heißt das, Affären wie Panama-Leaks gehören der Vergangenheit an? Seriös kann diese Frage niemand beantworten. "Alles kommt auf die praktische Umsetzung der Maßnahmen und ihre Überwachung an", sagt Saint-Amans.
Zeigen lässt sich das am Beispiel FATF: Die Organisation setzt zwar durch, dass Länder ihre Empfehlungen gegen Geldwäsche in staatliches Recht umsetzen. "Ob diese Regelungen dann aber angewendet werden, wird von der Organisation nicht weiter kontrolliert", so Saint-Amans. Banken bleibt auch ein großer Spielraum dabei, welche Dokumente sie anerkennen und welche nicht. Die Unternehmenskultur ist also wichtig.
Offen ist auch, wie effektiv der automatische Austausch von Steuerdaten sein wird. Der Knackpunkt ist laut Experten, ob Finanzdienstleiter gewissenhaft die wahren Eigentümer von Briefkastenfirmen feststellen. Bei anderen Vorhaben hängt alles von der Ausgestaltung ab. In das Register für Briefkastenfirmen soll eine Firma kommen, wenn eine Gesellschaft ihren Sitz in einem EU-Land hat. Damit wären viele Offshore-Konstruktionen erfasst, aber nicht alle. Und auch hier ist die Frage: Wer überprüft, ob alle Eintragungen im Register richtig sind? (András Szigetvari, 6.4.2016)