
Linda Nagata: "The Red: First Light"
Broschiert, 432 Seiten, Saga Press 2015
Wir starten militärisch. US-Autorin Linda Nagata, die schon in ihrer "Nanotech Succession"-Reihe ein Faible für die technologischen Aspekte von Science Fiction bewiesen hat, lässt hier einmal mehr die Hard- und Software krachen. Was in diesem Fall in erster Linie heißt: Waffentechnologie. Nagatas "The Red"-Trilogie verknüpft all das, was Fans von Military SF lieben, mit einem klug ausgearbeiteten Nahzukunftsszenario und einem raffinierten Geheimnis. Für Letzteres sorgt etwas, das ein Geschwisterchen von Skynet mit eher ungewöhnlichen Prioritäten sein könnte.
"There needs to be a war going on somewhere, Sergeant Vasquez. It's a fact of life. Without a conflict of decent size, too many international defense contractors will find themselves out of business. So if no natural war is looming, you can count on the DCs to get together to invent one." Gleich die allerersten Sätze des Romans fassen zusammen, wie die neue Weltordnung aussieht. Private "Sicherheitsunternehmen" von molochartiger Größe mischen in der Weltpolitik mindestens so sehr mit wie die alten Staaten. Die dürfen zur Unterstützung der Konzerne aber immerhin noch SoldatInnen in die diversen Krisenherde entsenden.
Vernetzt in den Kampfeinsatz
US-Army-Lieutenant James Shelley, der Ich-Erzähler des Romans, ist einer von ihnen. Zu Beginn treffen wir ihn an seinem gerade aktuellen Stützpunkt an: einem Hightech-Fort irgendwo im Sahel, von dem aus er mit seiner kleinen Einheit regelmäßig auf Patrouille geht. Shelleys Grüppchen bildet eine sogenannte Linked Combat Squad. Sie tragen nicht nur Exoskelette aus Titan (makaber als Dead Sisters bezeichnet), die auch dann noch weitermarschieren, wenn der menschliche Körper in ihrem Inneren tot ist. Sie sind auch durch Kommunikationsimplantate sowohl untereinander als auch mit ihrer fernen Einsatzleitung sowie ihren Kampfdrohnen vernetzt.
Eine ganz besondere Komponente in diesem Netzwerk ist zudem die scullcap, die jeder Soldat trägt: Sie stimuliert die Gehirnchemie und regt beispielsweise nach einer Tötung die Produktion von Substanzen an, die es erleichtern, sich von der Tat zu distanzieren. Shelley hat sich so an sein Häubchen gewöhnt, dass er beim Duschen die Sekunden zählt, bis er es endlich wieder aufsetzen kann. Dass es ihn letztlich manipuliert, ist ihm und seinen KameradInnen übrigens vollauf bewusst. Ebenso wie der Umstand, dass menschliche SoldatInnen einfach nur billiger sind als Kampfroboter, oder der geballte Zynismus der Weltpolitik, für die sie nichts anderes sind als Schachfiguren. Illusionen macht sich keiner von ihnen: "What are you talking about, 'freedom'? We're fighting for a paycheck, right?"
Man muss das Spiel spielen, aber nicht mögen, so lautet Shelleys Credo. Der abgebrühte Kämpfer, der ironischerweise beim Militär gelandet ist, weil er nach der Teilnahme an einer Friedensdemo verhaftet wurde, klingt viel älter, als es seine 23 Jahre vermuten lassen. Seine Sprache ist trocken, knapp und auf den Punkt gebracht. So etwa beschreibt er das Verhältnis zu seiner Ex-Freundin Lissa: We're friends now. Good friends. We trade e-mails all the time. She doesn't tell me about her boyfriends; I don't tell her when I kill people. Nagata erhebt die Nüchternheit zu einer Kunstform und beendet jedes Kapitel mit einem auffallend kurzen Satz, der wie ein Punkt hinter dem Gesagten wirkt. Es ist die absolut angemessene Sprache für eine Handlung wie diese.
Ungeahnte Entwicklungen
Im ersten Abschnitt lernen wir Aufbau und Wirkungsweise eines Linked Combat Squad vom Waffenarsenal bis zur Kampftaktik kennen und sind bei ersten Einsätzen live dabei. Das ist sehr gut beschrieben und hat Tempo – doch fragt man sich unwillkürlich: Kann das noch 400 Seiten so weitergehen? Aber dann endet der Abschnitt mit einigen einschneidenden Erlebnissen für Shelley. Unter anderem muss er erfahren, dass irgendjemand oder irgendetwas sich ins Netzwerk der Einheit gehackt und Shelleys Leben an der Front als Real-Life-Soap ins Internet gestellt hat. Deren Episoden spiegeln die Einteilung des Buchs wider.
Noch wichtiger aber ist, dass es sich dabei um dieselbe mysteriöse Instanz handeln dürfte, die Shelley schon mehrfach vor drohender Gefahr gewarnt hat. Für sich nannte er diesen geheimnisvollen Helfer "Gott". In der Folge, als sich sowohl Shelleys Vorgesetzte als auch einige skrupellose DrahtzieherInnen der Weltpolitik für Shelleys Vorahnungen zu interessieren beginnen, bürgert sich aber die Bezeichnung "The Red" ein. Man vermutet, dass keine Person, sondern ein autonomes Programm dahintersteckt.
Dass möglicherweise eine Art KI das Drehbuch von Shelleys Leben (und nicht nur seinem ...) schreibt, ist ein ziemlich genialer Kniff Nagatas. Ein Blick auf die Meta-Ebene zum einen – denn letztlich ist sie als Autorin ja selbst "The Red" –, aber auch ein raffinierter Weg, um beispielsweise Deus-ex-Machina-Lösungen vollkommen plausibel unterzubringen. Allerdings führt das Ganze auch zu ziemlich ungemütlichen Gedanken: Shelley weiß, dass Drehbücher einen Hang zur Eskalation haben – vielleicht wurde er ja nur gerettet, um ihn noch größeren Gefahren auszusetzen? Und was das Stichwort Eskalation in weiterer Folge des Romans anbelangt: Naja, wie wär's denn mit ein paar Atomexplosionen auf US-Boden?
Empfehlung!
Kurz gesagt: Der Roman ist richtig gut! Nagata hatte ihn ursprünglich 2013 via Self-Publishing veröffentlicht, ehe ihn heuer der Verlag Saga Press aufgegriffen hat, der nun auch die beiden Fortsetzungen herausgibt: "The Trials" ist bereits erschienen, der Abschlussband "Going Dark" wird Anfang November folgen.
Oft genug lese ich nur den Anfangsband einer Trilogie und denke mir dann: Ok, ich weiß, wie's funktioniert, reicht mir. Hier hingegen möchte ich unbedingt wissen, wie es mit Shelley weitergeht. Hoffentlich schaffe ich es, die beiden Folgebände bis Jänner zu lesen, wenn das Rundschau-Best-Of-2015 online geht, denn in dem wird "The Red: First Light" garantiert enthalten sein.
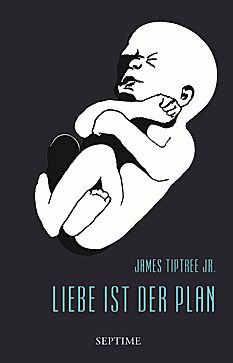
James Tiptree Jr.: "Liebe ist der Plan"
Gebundene Ausgabe, 512 Seiten, € 25,60, Septime 2015
Ladies and Gentlemen (und geschlechtlich Unbestimmte): Hier erleben wir James Tiptree Jr. auf dem Höhepunkt "seiner" schriftstellerischen Laufbahn. 18 Kurzgeschichten aus den Goldenen Jahren 1969 bis 1972 enthält der aktuelle Band der Tiptree-Werkausgabe, hier jagt ein Highlight das andere!
Mit Witz beginnt's
Mit dabei auch einer meiner absoluten persönlichen Lieblinge, auch wenn den niemand je irgendwo zu den zentralen Werken Tiptrees bzw. Alice B. Sheldons rechnen würde (ich hab das mal als Kind gelesen und war hin und weg, sowas prägt): "Der Mann, zu dem die Türen Hallo sagten". In diesem vollkommen sinnfreien Stück Hochtempo-Humor begegnet der Erzähler einem Drei-Meter-Mann, der in seinen Taschen ein paar lebendige Miniatur-Mädchen als Untermieterinnen herumträgt (ist schließlich schwer für ein Mädel, in der großen Stadt eine anständige Wohnung zu erschwinglichem Preis aufzutreiben ...), missgelaunten Möbelstücken die Leviten liest und alle Türen grüßt, die ihn auch freundlich zurückgrüßen. Und das alles mit einer Selbstverständlichkeit, die nicht nur den Erzähler aus den Socken haut. Die Geschichte ist wie ein Wirbelwind, der durchs Zimmer fegt, und ehe man noch sagen kann: "Was zum Teufel war denn das?", ist der Spuk auch schon wieder vorbei.
Ähnlich witzig sind die Umtriebe in "Der nachtblühende Saurier": Ein paar Paläontologen mit Zeitreisetechnologie schleppen für einen Sponsor einen toten Sauropoden aus der Kreidezeit an. Um seine Jagdgelüste zu befriedigen, müssen sie ihm nun allerdings noch vorgaukeln, dass das Tier noch am Leben ist. Den Tiefpunkt erreichen sie, als sie kistenweise Gemüse essen, um authentisch wirkende Dunghaufen zu produzieren ...
Tiptrees Humor in dieser Schaffensphase entsprang einer satirischen Betrachtung der Alles-ist-machbar-Haltung des Wirtschaftswunderzeitalters. Am besten bringt dies das herrliche "Ich warte auf euch, wenn der Swimmingpool leer ist" auf den Punkt: Mit der Freundlichkeit eines aufgeklärten Kolonialherren krempelt der junge Tourist Cammerling die von Krieg geprägte barbarische Kultur eines Hinterwäldlerplaneten im Alleingang um. Und in kürzester Zeit hatten sie einen Kibbuz, und die Mädchen unterrichteten Mengenlehre nach Montessori und kreative Hygiene. Es wäre allerdings nicht Tiptree, würde das Ganze nicht noch in einen fiesen Schluss münden.
Das umschaltbare Bewusstsein
Am vollkommen entgegengesetzten Ende des Spektrums finden wir die Art von Geschichten, die Tiptree berühmt gemacht haben – also die, in denen wir so richtig eine reingewürgt bekommen. Wie etwa "Das eingeschaltete Mädchen": In diesem Stück Proto-Cyberpunk reißt uns Tiptree mit direkter Ansprache in eine zynische Zukunftswelt hinein, in der herkömmliche Werbung verboten ist und Promis durch öffentlichen Konsum die Massen zur Nachahmung animieren sollen. Das glamouröse It-Girl, das die Medien zeigen, ist aber nur ein Avatar aus Fleisch – ferngesteuert vom missgestalteten Mädchen Philadelphia Burke, das in einem Tank aus Metall dahinvegetiert.
Auf subtilere Weise tragisch ist die interstellare Spionagegeschichte "Vivyan", deren Titelfigur ein unbedarfter, friedfertiger junger Mann ist, der am Ende der Geschichte als Einziger nicht begriffen hat, wie sehr er instrumentalisiert wurde – also wer nach der Geschichte keinen Kloß im Hals hat, der hat kein Herz. Ähnliches gilt für "Paradiesmilch", in dem sich ein von Aliens aufgezogener Junge nicht in die menschliche Gesellschaft einfügen kann und zurück "nach Hause" möchte. Er verklärt die Welt seiner Zieheltern und deren kulturelle Errungenschaften – als wir mit ihm diese Welt endlich erreichen und mit der Realität konfrontiert werden ... also man kann echt nicht sagen, ob dieser Schluss hoffnungsvoll oder entsetzlich ist.
Eine der meistzitierten Geschichten von James Tiptree Jr. ist "Frauen, die man übersieht", auch wenn die mich persönlich nicht so sehr beeindruckt wie andere. Ein Kleinflugzeug stürzt an der Küste von Yucatan ab. Der Erzähler, der ein mitgereistes Mutter-Tochter-Gespann anfangs nur als "verschwommene Flecken Weiblichkeit" wahrgenommen hat, stellt fest, dass sich die beiden nach dem Unglück als ausgesprochen patent erweisen. Doch nicht dass sie Wert auf seine Anerkennung legen würden – im Gegenteil, sie sind bereit, bis zum Äußersten (und buchstäblich Lichtjahre darüber hinaus) zu gehen, um sich aus ihrem bisherigen Leben zu lösen. Was an der Geschichte wirklich beeindruckt, ist die stille Kompromisslosigkeit der beiden Frauen: eine Totalabsage an eine von Männern dominierte Welt.
Zwei weitere Höhepunkte
Sämtliche Erzählungen des Bands werde ich hier nicht aufzählen (darunter einige zugedröhnte Trips ganz im Sinne der damals gerade aktuellen New Wave of Science Fiction), aber auf jeden Fall noch zwei von den ganz großen Geschichten. John Delgano ist "Der Mann, der nach Hause ging": ein unfreiwilliger Zeitreisender, der durch eine Teilchenbeschleuniger-Katastrophe in die Zukunft geschleudert wurde und nun verzweifelt versucht zurückzukehren. Einmal im Jahr – immer dann, wenn die Erde die Bahn des Zeitreisenden kreuzt – manifestiert er sich nur für einen Augenblick stets an derselben Stelle, eingefroren in der Bewegung. Für die Menschen auf der Erde, die nach der Katastrophe auf ein niedriges Niveau zurückgesunken sind, ist die alljährlich auftretende Erscheinung ein Mysterium, um das sich bald eine blühende Kultstätte entwickelt. Von all dem bekommt John jedoch nichts mit: Er rast weiter mit letzter Kraft in umgekehrter Richtung auf sein Ziel zu, um so die Katastrophe auszulösen, mit der alles begonnen hat.
Und dann wäre da noch das Nebula-gekrönte "Liebe ist der Plan, der Plan ist Tod", das in Sachen Tragik und Originalität John Delganos Leidensgeschichte sogar noch übertrifft. Geschrieben in einem schwelgerischen Stil, den Tiptree laut eigener Aussage an pornographische Werke der 1920er Jahre angelehnt hatte, ist es die Geschichte eines halbintelligenten insektenartigen Wesens namens Moggadeet, das im Plan – seinem Fortpflanzungszyklus – gefangen ist. Moggadeet begreift nicht, dass seiner Welt der Untergang in Form einer Eiszeit droht – ebensowenig wie er begreift, dass im Plan letztlich Liebe und Tod dasselbe bedeuten werden, wie es in Tiptrees Geschichten so oft der Fall war. Die Erzählung zeigt einmal mehr Tiptrees beispiellose Fähigkeit, uns mit "seinen" Figuren mitfühlen zu lassen – sei es nun John Delgano, Vivyan oder Philadelphia Burke ... oder eben ein monströses außerirdisches Rieseninsekt.
Uneingeschränkte Empfehlung!
Und nachdem wir hier den Höhepunkt der Tiptree-Werkausgabe in Händen halten, konnte es eigentlich auch nur einen Text für den Anhang geben; nun endlich auch im vollen Wortlaut zu lesen. Nämlich den mittlerweile legendären Aufsatz von Autor und Herausgeber Robert Silverberg, in dem dieser 1975 – also mitten im großen Rätselraten, ob Tiptree ein Mann oder eine Frau sei – ebenso vehement wie fundamentiert und vollkommen falsch argumentiert hatte, dass James Tiptree Jr. ganz eindeutig ein Mann sein müsse. Aber immerhin: beim Alter hatte er hervorragend treffsicher geschätzt!
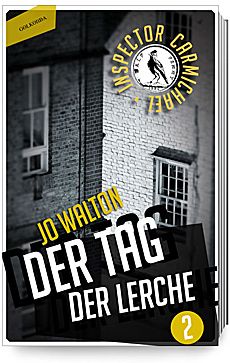
Jo Walton: "Der Tag der Lerche"
Klappenbroschur, 293 Seiten, € 17,40, Golkonda 2015 (Original: "Ha'Penny", 2007)
Acht Jahre ist es mittlerweile her, dass ich den ersten Teil von Jo Waltons "Farthing"-Trilogie besprochen habe. Schön, dass es dieses beklemmende Alternativweltszenario über ein England der 1940er Jahre, das sich dem Faschismus hinzugeben droht, inzwischen auch auf Deutsch gibt. Hier also nun Teil 2.
Nur zur Erinnerung: In dieser Welt hat das Vereinigte Königreich mit Hitler-Deutschland ein paar Schlachten geschlagen, dann aber einen Frieden geschlossen, der nun schon seit acht Jahren anhält. Während die Nazis ganz Festlandeuropa beherrschen, die USA unter Präsident Lindbergh sich raushalten und nur noch die Sowjetunion Hitler Paroli bietet, werden die Beziehungen Englands zum Reich immer freundschaftlicher. Und das färbt ab.
An den Haaren herbeigezogen ist das Szenario keineswegs: Faschistische Bewegungen gab es in der Zwischenkriegszeit ja auch in England; sogar im "Haus am Eaton Place" (Neuauflage) wurde das schon thematisiert. In den vergangenen Jahren haben sich vermehrt Alternativweltromane – etwa D. J. Taylors "The Windsor Faction" – der Frage gewidmet, was wohl geschehen wäre, wenn sich die durchgesetzt hätten. Bei Walton präsentiert sich das als Schere, die die Demokratie von zwei Seiten bedroht: Oben basteln nazifreundliche Adelige am heimlichen Umsturz, unten wütet der Mob der Ironsides.
Polizist in Nöten
Einmal mehr kredenzt uns Walton die politische Giftsuppe in Form einer Murder Mystery: Diesmal ist eine arrivierte Theaterschauspielerin in ihrem Haus einer Bombenexplosion zum Opfer gefallen. Zum Tatort wird erneut Inspector Carmichael von Scotland Yard gerufen, der immer noch von den Ereignissen in Band 1 gezeichnet ist. Er hatte den damaligen Mordfall gelöst – doch der Täter ist mittlerweile auf krummen Wegen zum Premierminister geworden und Carmichael wurde zur Vertuschung gezwungen. Dass er schwul ist, bietet seinen Vorgesetzten das perfekte Druckmittel.
... nicht dass wir diesmal größere Einblicke in sein Privatleben gewinnen dürften. Es werden immerhin ein paar kurze Gespräche mit seinem Lebensgefährten geführt, aber im Wesentlichen belässt Walton die persönliche Sphäre der Figur, die die Trilogie zusammenhält, im Verborgenen – wie es Carmichael selbst ja gezwungenermaßen tut. Carmichael versieht seinen Dienst weiterhin professionell. Allerdings will er, angewidert von der politischen Entwicklung, seinen Dienst nach dem aktuellen Fall quittieren ... und wird doch immer tiefer in die Politik hineingezogen. Bald sieht sich der grundanständige Polizist in der Zwickmühle zwischen Ohnmacht und dem Wunsch, wenigstens andere vor dem Zugriff des aufkommenden Faschismus zu retten. "Ich kreise wie ein Falke über einem Schlangennest. Stoße ich hinab, wird mich ihr Gift töten, aber solange ich in der Luft bleibe, kann ich Unschuldige fernhalten."
Hauptfigur zwo
Während Carmichaels Kapitel in dritter Person erzählt werden (und nicht einmal sein Vorname genannt wird!), stellt ihm Walton wie schon im ersten Band eine Person gegenüber, die in der anderen Hälfte der Kapitel als Ich-Erzählerin fungiert und in deren Denken wir damit etwas unmittelbarere Einblicke gewinnen dürfen. Mehr als uns lieb ist vielleicht, denn wie schon in Band 1 ist die zweite Hauptfigur eine recht unbedarfte und egozentrische Person.
Olivia Lark ist eine Tochter aus gutem Hause, die es ans Theater gezogen hat. Eine ihrer Schwestern war mit dem Mordopfer aus Band 1 verheiratet, eine zweite mit einem Atomforscher, die dritte mit Heinrich Himmler(!), und zum Ausgleich ist die vierte Kommunistin. Greller als jede Soap-Familie! Olivia nun wird in eine Verschwörung hineingezogen, die glatt an "Inglourious Basterds" erinnert: Bei einem Staatsbesuch soll Hitler zusammen mit dem britischen Premier während einer Theatervorstellung in die Luft gejagt werden. Nach langem Hin und Her willigt Olivia in den Plan ein – würde den Zeitzünder aber gerne auf möglichst spät stellen, damit man sie noch länger auf der Bühne bewundern kann ...
Eleganz durch Zurückhaltung
Eine Murder Mystery ist immer auch ein Sittenbild. Das findet sich hier in ersten kleinen Schikanen im Alltagsleben wieder – etwa dass SchauspielerInnen einen britischen Pass brauchen, um im Theater auftreten zu dürfen. Es geht weiter über schon schwerwiegendere Phänomene wie die zunehmende Selbstverständlichkeit von Antisemitismus oder die Einschränkung persönlicher Freiheiten zwecks "Bekämpfung von Terrorismus", was die Trilogie gleichzeitig an unsere Gegenwart anbindet. Und es reicht bald auch schon bis zu den ganz großen Scheußlichkeiten: Während das Königreich in unserer Welt Flüchtlinge aus Nazideutschland aufnahm, deportiert es hier immer mehr unliebsam Gewordene auf den Kontinent, wo sie der Tod im KZ erwartet.
All das reibt uns Jo Walton aber nicht über Seiten und Seiten hinweg unter die Nase, um klarzustellen: Das! Ist! Ein! Alternativweltroman!, sondern lässt es subtil ins Geschehen einfließen. Eine Anmerkung hier, ein Kommentar da. Wie bei einem herkömmlichen Krimi ist der historisch-politische Hintergrund immer präsent, aber er braucht nicht viele Worte. Diese Zurückhaltung ist die eigentliche Raffinesse der "Farthing"-Trilogie.
Tja, werden Inspector Carmichael und sein England dem Untergang im braunen Sumpf am Ende doch noch entgehen? Ich kann Teil 3 kaum erwarten!
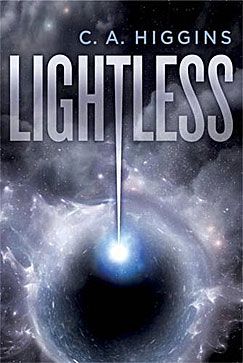
C. A. Higgins: "Lightless"
Gebundene Ausgabe, 304 Seiten, Del Rey 2015
Zeit mal wieder für eine Space Opera, am besten von jemandem mit abgeschlossenem Physikstudium, wie es bei C. A. Higgins aus New Jersey der Fall ist. Wobei die Physik hier auf anderen Wegen als Beschreibungen von Tangentialkursen oder relativistischen Effekten eingebracht wird, die man vielleicht eher erwarten würde.
Zunächst einmal nämlich ganz plakativ: Die einzelnen Abschnitte des Romans werden von den Hauptsätzen der Thermodynamik eingeleitet. Dann gleichnishaft: Eine Figur vergleicht menschliche Beziehungen mit Energie- bzw. Machtdifferenzen. All human interactions were nothing more than the flow of power from one to another. In einem Akt poetischer Gerechtigkeit wird ein noch unmenschlicherer Beobachter später den Zerfall der Leiche ebendieser Figur nüchtern als Prozess der Entropieerhöhung beschreiben. Und was diesen Beobachter anbelangt: Der ist in Physik bzw. Mathematik so zuhause wie ein Fisch im Wasser.
Schwerpunkt auf dem Menschlichen
Aber ich will hier auch keine falschen Fährten legen: Das meiste vom oben Gesagten ereignet sich erst spät im Roman, primär ist "Lightless" pures Human Drama und dreht sich um Themen wie Vertrauen, Loyalität und Widerstand versus Konformität. Das Drama setzt sich in Gang, als die nur dreiköpfige Crew des Forschungsraumschiffs "Ananke" ungebetenen Besuch erhält. Leontios Ivanov, kurz Ivan, und Matthew Gale haben sich heimlich an Bord der "Ananke" geschlichen: zwei dubiose Gestalten, die in Verbindung mit einer terroristischen Widerstandsbewegung gegen das herrschende System stehen.
Der undurchsichtige Ivan wird speziell für Schiffsingenieurin Althea Bastet zur Herausforderung, die wir uns als weiblichen Techno-Geek vorstellen dürfen. Althea empfindet tiefe Liebe für ihr Schiff und dessen Technik – mit Menschen tut sie sich hingegen schwer. Bis zum Schluss wird sie mit der Frage hadern, wie sie Ivan einschätzen soll.
Das System schlägt zurück
Hintergrundinformation: Wir befinden uns in einer nicht näher spezifizierten Zukunft, in der sämtliche größeren Himmelskörper des Sonnensystems entweder terraformiert oder in luftgefüllte Plastikhüllen gepackt wurden. Und allesamt stehen sie unter der Knute besagten Systems, das alles und jeden rund um die Uhr mit Kameras überwacht und jedes Anzeichen von Rebellion im Keim erstickt. Auch vor Genozid wird dabei keineswegs zurückgeschreckt.
Als das System erfährt, dass Ivan an Bord der "Ananke" festgesetzt wurde (sein Kumpel konnte flüchten), entsendet es die versierte Verhörspezialistin Ida Stays, die übrigens eine Gemeinsamkeit mit dem Schiff teilt: Beide tragen ein Schwarzes Loch in sich – die "Ananke" im wortwörtlichen und Ida im emotionalen Sinne. Die sich überlegen fühlende Soziopathin wird alles daransetzen, Ivan zu brechen. Allerdings steht sie dabei auch unter gehörigem Erfolgsdruck.
Damit ist die Struktur des Romans für längere Zeit festgelegt. Ein Handlungsstrang dreht sich um Ivans Verhör durch Ida und besteht fast ausschließlich aus Dialogen. Währenddessen huscht Althea durchs Schiff und versucht die Auswirkungen eines Virus zu bekämpfen, das Matthew vor seiner Flucht in den Bordcomputer eingeschleust hat und das immer öfter für Systemfehler und sonstige Seltsamkeiten sorgt. Dieser Teil ist möglicherweise dazu gedacht, eine ähnliche Stimmung wie in "Alien" oder zumindest "Sunshine" zu evozieren, ist dafür aber schlicht nicht unheimlich genug – wie man auch schon deutlich heftigere Verhörpassagen gelesen hat. Wirkt insgesamt alles etwas harmlos – zum Glück wird's später aber dann doch noch auf unerwartete Weise interessant.
Vorhang zu
"Space Opera" ist hier wörtlich zu verstehen, denn "Lightless" wirkt wie ein Bühnenstück. Insgesamt treten acht Personen auf, manche davon nur kurz und nie alle zusammen. Als neunter Akteur wird später jemand dazukommen, dessen Part im Theater eine Lautsprecherstimme aus dem Off übernehmen würde. Die Bühne selbst – also das riesige Forschungsschiff – ist von außen imposant: When it drifted through black space, it looked like an extinct creature of Terran ocean depths, a creature out of time and into space. Schöner Satz. Aber innen ist es natürlich genau so beengt, wie es Bühnen nun einmal sind. Und wir werden diese auch niemals verlassen, nicht einmal für Flashbacks. Stattdessen werden wie im klassischen Theater Botschaften – darunter auch ein wirklich dicker Hund – aus der Außenwelt vorgetragen, auf die die Figuren dann reagieren. Und die Verhörpassagen rund um Ivan und Ida, die sind sowieso ein Kammerspiel.
"Lightless" ist wieder so ein Buch, bei dem Zwischenbilanzen ganz anders lauten würden als der abschließende Eindruck. Im recht schablonenhaften Mittelteil hätte sich Higgins Gedanken machen müssen, wie sie etwas mehr Dynamik reinbringen hätte können. Der Schlussteil (also in etwa das letzte Drittel) mit seinen Twists und Umstürzen reißt das Buch dann aber wieder raus. Als Kirsche obendrauf gibt's dann noch eine Danksagung, wie ich sie auch noch nicht gelesen habe: Und zwar bedankt sich die Autorin bei den Regierungsbehörden, die ihren Internetzugang überwachen – dafür, dass sie nicht verhaftet wurde, obwohl sie gegoogelt hat, welcher Schaden sich mit Atomexplosionen anrichten lässt und wie man jemandem die Kehle aufschneidet. Das System drückt manchmal wohl doch ein Auge zu.
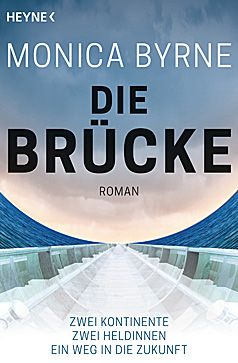
Monica Byrne: "Die Brücke"
Klappenbroschur, 447 Seiten, € 15,50, Heyne 2015 (Original: "The Girl in the Road", 2014)
Der Preis für das faszinierendste Bauwerk dieser Rundschau geht an die US-Autorin Monica Byrne und ihren Debütroman "Die Brücke". Ihr Transarabischer Lineargenerator, im Volksmund schlicht Trail genannt, zieht sich wie eine Pontonbrücke aus Aluminiumpyramiden über tausende Kilometer hinweg quer übers Arabische Meer, von Mumbai in Indien bis hinüber nach Dschibuti am Horn von Afrika. Eigentlich handelt es sich um ein gigantisches Kraftwerk: Die einzelnen Segmente, die abtauchen können, um Schiffe passieren zu lassen, tragen auf der Oberseite Solarpaneele und in den Scharniergelenken Dynamos zur Erzeugung von Wellenenergie. Aber gar nicht so wenige Menschen nutzen den Trail illegalerweise auch als interkontinentalen Fußgängerweg.
... leider ist das aber auch schon der einzige Preis, den "Die Brücke" von mir bekommt. Könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder die andere Besprechende im "Literarischen Quartett" sich für den Roman erwärmen könnte – mein Fall war er nicht.
Die Hauptfiguren
Byrne schildert parallel den Walkabout zweier Frauen bzw. einer Frau und eines Mädchens im Jahr 2068: R. G. Meenakshi, kurz Meena, aus Indien und die kleine Mariama aus Afrika. Meena, die im Lauf des Romans auf dem Trail den Ozean überqueren wird, steht dabei im Vordergrund. Und vorab zu berücksichtigen ist, dass wir sie in einer psychischen Ausnahmesituation kennenlernen: traumatisiert von einem Anschlag auf ihr Leben und offenbar auch noch mitten in einem manischen Schub. So kommt sie aus dem Süden Indiens nach Mumbai, begeistert sich im dortigen Museum wie ein aufgekratztes Schulkind für die Trail-Exponate und beschließt letztlich, auf dem Trail nach Äthiopien zu gehen ... dorthin, wo ihre Eltern einst von einer Einheimischen ermordet wurden.
Vielleicht sieht sie keine andere Möglichkeit als dieses Wahnsinnsunternehmen, um zu ihren "Wurzeln" zurückzukehren: Den Chip, den man für Geldüberweisungen wie z. B. für ein Flugticket braucht, schneidet sie sich in ihrer Paranoia nämlich aus dem Körper. Der Hauptgrund dürfte aber sein, dass sie einfach neben sich steht – unter anderem wird sie auf ihrer ganzen Reise Halluzinationen haben.
Mariama indes wird als kleines Mädchen aus Westafrika eingeführt, das aus einem Slumviertel davonläuft und sich einer Gruppe Männer anschließt, die sich mit dem Auto auf eine monatelange Reise quer über den Kontinent begeben – bis nach Äthiopien. Da diese Kapitel im Gegensatz zu denen um Meena im Präteritum erzählt werden, steht von Anfang an die Möglichkeit im Raum, dass die beiden Reisen nicht synchron ablaufen. Noch die spannendste Frage an Mariamas Trip ist daher die, ob sie sich am Ende womöglich als die Mörderin von Meenas Eltern oder als "Bloody Mary" entpuppen wird – eine Art Geist des Trails, von dem Meena unterwegs erzählt wird. Wie Byrne die beiden Handlungsfäden letztendlich verknüpft, ist dann aber wirklich gelungen, das zumindest muss ich der Autorin lassen. Wär bloß nicht soviel dazwischen ...
Wozu Science Fiction?
Es ist schon etwas paradox, ein Megakonstrukt wie den Trail zu entwerfen, dann aber auf jeden Panoramablick zu verzichten und sich ganz auf das mikroskopische Universum zu konzentrieren, in dem die von Segment zu Segment kriechende Meena im eigenen Saft schmort. Mein Leben ist einfach und elementar: Blut, Wasser, Pisse, Schokolade. Und nicht zu vergessen jede Menge Halluzinationen und Erinnerungen an früher. Ich muss gestehen, ich war erleichtert, als Meenas Super-Kindle im Meer versank, weil ich dann wenigstens nicht mehr die poetischen Essays irgendwelcher indischer Dichterinnen mitlesen musste – es gab auch so schon bedeutungslose Abschweifungen genug.
So rein als Konzept mag es ja spannend klingen, jemanden zu beschreiben, der auf sein Selbst zurückgeworfen ist. Und natürlich gibt es auch jede Menge geglückte Umsetzungen eines solchen Plots. Aber wozu der ganze Aufwand mit interkontinentaler Landbrücke und weltweit ansteigendem Meeresspiegel und einem zwischen den neuen Kolonialmächten Indien und China aufgeteilten Afrika? Ich setze mich schließlich auch nicht extra an den Rand des Grand Canyon, um dann eine Nahaufnahme davon zu machen, wie ich mir die Zehennägel schneide.
Und was Mariamas Reise anbelangt, bei der es im Wesentlichen darum zu gehen scheint, mit den Augen eines Kindes die Welt neu zu entdecken (wenn man das denn will): Die könnte genausogut in unserer Gegenwart angesiedelt sein. Daher wieder die Frage: Wozu einen SF-Rahmen dafür bemühen?
Ein langer Fußmarsch, und ich fühle jeden Schritt
Dass der Roman die SF-Elemente im Hintergrund belässt und sich ganz auf seine zwei Hauptfiguren konzentriert, ist per se noch nichts Schlechtes. Mein ganz subjektives Problem mit "Die Brücke" war nur leider, dass es zwei Figuren sind, mit denen ich nie warm geworden bin – eher im Gegenteil. Und die Herzlosigkeit, mit der Mariama den Tod einer sympathischen Nebenfigur quittiert, gebe ich gerne zurück: He, Kleine – Francis' Lebensgeschichte hätte mich tausendmal mehr interessiert als deine!
Mal sehen: Zwei Hauptfiguren, die im Schneckentempo Eindrücke sammelnd durch die Welt ziehen und mir dabei immer egaler werden ... woran erinnert mich das bloß? Ach ja richtig: an Kim Stanley Robinsons "2312". Wie passend, dass Robinson für Byrnes Buch einen lobpreisenden Blurb beigesteuert hat. – Naja, vielleicht werden sich ja alle, die anlässlich "2312" nicht einer Meinung mit mir waren, jetzt sofort auf "Die Brücke" stürzen.
Immerhin habe ich durch den Roman gelernt, dass das berühmte Australopithecusweibchen "Lucy" in Äthiopien als Urururahnin "Dinkenesh" verehrt wird. Wenigstens das wird mir von "Die Brücke" im Gedächtnis bleiben.
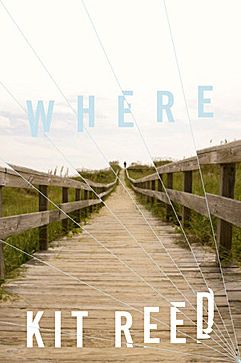
Kit Reed: "Where"
Gebundene Ausgabe, 236 Seiten, Tor Books 2015
Meine Entdeckung des Monats ist eine fast schon archäologische (sorry, Ms. Reed): Die Kalifornierin Kit Reed, mittlerweile 83, gehört neben beispielsweise Carol Emshwiller oder Eleanor Arnason zu einer Kategorie älterer Autorinnen, die seit Jahrzehnten und Jahrzehnten im Phantastik-Genre tätig sind und jeweils einen ganz wunderbaren individuellen Stil pflegen, von deutschsprachigen Verlagen aber weitestgehend ignoriert wurden. Von Reeds umfangreichem Romanwerk sind meines Wissens grade mal zwei Stück auf Deutsch erschienen, das war's dann aber auch schon (und ist immer noch mehr als bei den genannten Kolleginnen).
Ihr jüngster Roman "Where" entwirft für uns ein Szenario, wie wir es von TV-Serien wie "Lost", "Under the Dome" oder "Wayward Pines" kennen: Ein Gruppe von Menschen verschwindet in eine mysteriöse Zone unter/über/neben/jenseits unserer Welt. In diesem Fall sind es die 100 EinwohnerInnen von Kraven Island, einer kleinen Insel vor South Carolina. Die gingen gerade nichts Böses ahnend ihren morgendlichen Beschäftigungen nach. Until, without warning and with no sense of transition .. This.
Draußen ...
Normalerweise bleiben wir in einem solchen Plot entweder bei den Verschwundenen und tasten uns mit ihnen durch eine neue, fremdartige Umgebung. Oder wir begleiten diejenigen, die nach ihnen suchen und keine Ahnung haben, ob die Vermissten überhaupt noch am Leben sind. Reed verknüpft beides in zwei parallel geführten Handlungssträngen und hängt es an einem Paar auf, das dummerweise unmittelbar vor dem Ereignis im Streit auseinander gegangen ist: dem Architekten David Ribault und seiner Langzeitfreundin Merrill Poulnot. David hatte Merrill am Vorabend des Ereignisses in einer (vermeintlich?) zweideutigen Situation mit Rawson Steele erwischt, einem zugereisten Grundstückshai. Der erschien David ohnehin schon die längste Zeit verdächtig, weil er ein Haus nach dem anderen auf der Insel aufkauft.
Die Konsequenz des Ganzen war, dass sich David außerhalb Kraventowns befand, als der Verschwindibus-Effekt auftrat. Von Angst und nicht zuletzt auch Schuld getrieben, versucht er nun auf die rasch von Polizei und Militär abgeschottete Insel zurückzukehren. Einer der beiden Handlungsstränge dreht sich um Davids manische Bemühungen, im verlassenen Kraventown irgendeine Spur von Merrill zu finden.
... und drinnen
Doch Merrill und ihre 99 LeidensgenossInnen sind längst ganz woanders. Sie fanden sich übergangslos in einer geheimnisvollen Anlage irgendwo in einer Wüste wieder, über der eine unnatürlich grelle Sonne strahlt. Glühend heiß sind die Tage, eiskalt die Nächte. Sie werden bald bemerken, dass die Gebäude der Anlage die Topografie von Kraventown widerspiegeln – doch ist hier alles so hell, glatt und steril wie in dem weißen Raum, in dem Morpheus Neo das Wesen der "Matrix" vorführt. Als Merrills kleiner Bruder in ihrem neuen "Zuhause" Kalenderstriche an der Wand anbringt, verschwinden diese über Nacht wieder, als würde das Gebäude auf Default zurückspringen.
Kameraüberwachung, Leuchtdisplays an den Wänden, die den Verschwundenen zeigen, was die Nachrichten daheim über sie berichten ... und gelegentlich auch eine Besprühung mit beruhigendem Gas zur Verhaltenskontrolle: Rasch schmoren die solcherart unter Druck gesetzten Verschwundenen im eigenen Saft. Und natürlich herrscht das übliche Rätselraten, was hinter all dem stecken mag. Ist es eine besonders perverse Form von Reality TV? Sind sie alle nur Avatare riesiger nichtmenschlicher Kinder mit Joysticks? Skurrilerweise sind das noch plausible Hypothesen im Vergleich dazu, was die Behörden daheim öffentlich mutmaßen: Dort glaubt man allen Ernstes an einen Angriff von Piraten aus Somalia ...
Wunderbar geschrieben
Reed katapultiert uns von Beginn weg ansatzlos in die Köpfe der Beteiligten, in denen sich die Gedanken nur so überschlagen. Panik, Frust, Zorn, Entschlossenheit und bei dem einen oder anderen bald auch Wahnsinn ... sie alle sind Getriebene. Sehr gut beschrieben ist beispielsweise der geistige Verfall von Merrills Vater, der sich selbst als neuen Moses zu sehen beginnt (ohne religiöse Spinner scheint's in US-Mysterys einfach nicht zu gehen).
"Where" enthält einige der besten inneren Monologe, die ich seit langem in einem Genreroman gelesen habe. Gespickt mit Parenthesen, Slang und Comic-Sprache, wirkt das alles einfach organisch: So und nicht so gestelzt und stets grammatikalisch korrekt wie bei vielen anderen AutorInnen denken bzw. sprechen Menschen wirklich. Die 83-jährige Autorin kann sich übrigens auch ziemlich gut in die Sprache eines videospielsüchtigen Teenagers einleben. Und zeigt dabei nebenbei bemerkt eine gewisse Vorliebe für das Wort "fuck". Ms. Reed, ich krieg ja ganz rote Ohren!
Ungewissheit bleibt
Trotz dieser begrüßenswert bodenständigen und stets herrlich auf den Punkt gebrachten Ausdrucksweise hat "Where" eine sehr stark metaphorische Seite. Das zentrale Thema – symbolisiert durch den Limbus, in den Merrill & Co versetzt wurden, und noch einmal betont durch eine dem Roman beigefügte Kurzgeschichte – ist Ungewissheit. Jemanden verloren zu haben ist schon grauenhaft genug. Noch schlimmer ist es jedoch, wenn man nicht weiß, was mit ihm geschehen ist. Ein Toter kann betrauert werden und die Trauer zu einem Abschluss finden. Bei einem Vermissten bleibt den Zurückgelassenen dieser Abschluss jedoch verwehrt – auf ihre ganz eigene Weise sind Vermisste damit unsterblich.
Die metaphorische Ebene betone ich nicht von ungefähr, denn streng rational Denkende werden mit dem Schluss von "Where" vielleicht so ihre Probleme haben. Der kommt übrigens reichlich abrupt und lässt zudem viele offene Fragen und auch einige blinde Motive zurück – als befände man sich in einer Mystery-Serie, deren zweite Staffel leider nie gedreht wurde. Allerdings, das muss man auch sagen, bereitet der Roman beim Lesen derart viel Vergnügen, dass man erst mit einigem Abstand (und vielleicht nach einer nochmaligen Lektüre) bemerkt, wieviel an zuvor gelegten Spuren Kit Reed letztlich im Sande verlaufen ließ ... oder vielleicht auch schlicht und einfach vergessen hat.
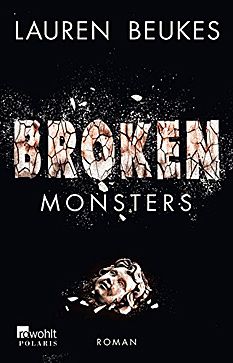
Lauren Beukes: "Broken Monsters"
Klappenbroschur, 541 Seiten, € 17,40, Rowohlt 2015 (Original: "Broken Monsters", 2014)
Auf geradem Kurs segelt die südafrikanische Autorin Lauren Beukes auf unsere Realität zu: Nach dem SF-Roman "Moxyland", der Zukunfts-Fantasy "Zoo City" und dem Zeitreise-Krimi "Shining Girls" ist sie nun mit "Broken Monsters" in Slipstream-Gewässern eingetroffen. Das ist praktisch die Gezeitenzone vor unserer Welt, in spätestens zwei Romanen geht sie an Land! Allerdings sind es auch tückische Gewässer, weil man darin Gefahr läuft, LeserInnen mit bestimmten Genre-Erwartungen zu verwirren. Mein Vorab-Tipp daher: Ohne Erwartungshaltung an "Broken Monsters" herangehen, dann kann man sich davon so richtig schön packen lassen.
Broken City
Geblieben ist Beukes' Faszination für seltsame Urbanitäten. "Broken Monsters" ist nicht nur ein Krimi mit äußerst bizarren Begleiterscheinungen, sondern auch eine Art "Durch die Nacht mit ...". Der Schauplatz: Detroit, die ehemalige Industriemetropole zwischen Niedergang und versuchter Renaissance. Seit längerem wird Detroit gerne eine ähnliche Rolle zugeschrieben wie Berlin in den 90ern – mit dem Unterschied allerdings, dass Berlin stets fühlbar im Wachstum war, während man in Detroit trotz aller Wiederbelebungsmaßnahmen immer noch verzweifelt gegen Abwanderung und verfallende Infrastruktur ankämpfen muss.
Auf der einen Seite ein kreativer Hotspot zwischen Techno-Kultur, Urban Gardening und schrägen Kunstinitiativen wie dem "Heidelberg Project" von Tyree Guyton (ich empfehle eine Image-Search). Auf der anderen Seite Verfall und Ruinenpornographie, die längst zum Magneten für eine ganz eigene Art von Tourismus geworden ist. Beukes, die natürlich selbst vor Ort sein musste, fasst ihre Eindrücke von Detroit zusammen und lässt sie von ihren Romanfiguren mit Galgenhumor wiedergeben: Sie fahren am Yachtclub vorbei, und sie zeigt auf den alten Zoo, der mit Brettern verschalt ist, die Tiere sind lange weg. Vielleicht sind sie mit den Weißen in die Vororte geflüchtet.
Die ProtagonistInnen
Aufgebaut ist der Roman äußerst strukturiert. Er gliedert sich in mehrere Abschnitte, die jeweils für einen Tag stehen, und innerhalb derer wir kapitelweise durch ein fünfköpfiges Ensemble von Hauptfiguren rotieren. Nummer 1 ist Gabriella Versado, eine erfahrene Polizistin, die sich abmüht, den Spagat zwischen Ermittler- und Mutterrolle zu bewältigen. Und der wird bedeutend schwieriger, als Gabi mit dem Fall konfrontiert wird, der die Geschehnisse des Romans ins Rollen bringt: Man findet die Leiche eines Jungen – oder genauer gesagt dessen Oberkörper, der mit Fleischkleber auf den Unterleib eines jungen Hirschs gepappt wurde.
"Broken Monsters" ist kein Whodunnit: Als Täter wird uns nämlich schon früh Clayton Broom vorgestellt, ein abgesandelter Künstler in seinen 50ern, den wir als Loser und Messie kennenlernen, hinter bzw. in dem aber mehr steckt. Clayton träumt von einer "Welt unter der Welt". Und nicht nur, dass er versucht, mit seinen Werken die Grenzen zwischen den Welten einzureißen. Sein Traum ist auch zu einer eigenen, unheimlichen Persona geworden, die mit Claytons Körper scheinbar unabhängig agiert. Und damit sehr, sehr böse Dinge anstellt.
In die Ereignisse hineingezogen werden auch Thomas Michael Keen, ein in wohnlicher Hinsicht Benachteiligter (=Obdachloser), und Jonno Haim, ein ehemaliger Journalist aus New York, der in Detroit einen Neustart versucht. Obwohl schon Ende 30, lebt er wie ein Spät-Teenager, lässt sich zusammen mit einer DJane durch Detroits alternative Kunstszene treiben und ist als freischaffender Blogger auf der Suche nach Inspiration. Naja, und wen die Götter bestrafen wollen, dem erfüllen sie bekanntlich seine Wünsche ...
Als letzte kapiteltragende Figur wäre noch Layla Versado, Gabis nervige Tochter im Teenageralter, zu nennen. Im großen Showdown des Romans wird ihr noch eine entscheidende Rolle zukommen – davor sind ihre Kapitel weitgehend entbehrlich. Erinnert mich irgendwie an Thea Queen in den ersten beiden Staffeln von "Arrow", wo ich immer auf Fast Forward gedrückt habe, wenn's um ihre belanglosen Befindlichkeiten ging.
Getting Weird
Es wird nicht bei einer Leiche bleiben. Weitere Tote tauchen auf, ebenfalls in bizarre "Kunstwerke" eingebettet. Zudem stoßen unsere diversen ProtagonistInnen unabhängig voneinander auf Türen, die jemand in Tatortnähe mit Kreide an die Wand gemalt hat. Bald prangen immer mehr davon in Detroit – zugleich häufen sich seltsame Wahrnehmungen, und nicht alle davon dürften sich als (wie auch immer induzierte) Halluzinationen abtun lassen. Wie war das noch mal schnell mit dem Grenzen öffnen? Achtung, die Realität wird brüchig!
... und damit scheiden sich die Geister, wie man auch an den Reaktionen von LeserInnen erkennen kann. Im letzten Siebtel des Romans wird's surreal. Das ist eher spät für LeserInnen, die aus der Phantastik-Ecke kommen und die bis dahin einen recht konventionellen Krimi gelesen haben. Umgekehrt stößt es aber das Krimi-Publikum vor den Kopf, das nun eine ebenso konventionelle Aufklärung erwarten würde. Wie gesagt, Slipstream hat seine Tücken.
Daher noch einmal meine Empfehlung: "Broken Monsters" weder als Krimi noch als Fantasy oder Horror lesen, sondern einfach als Roman. Dann hat man nämlich einen ziemlich guten in Händen.
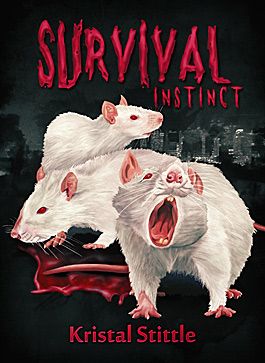
Kristal Stittle: "Survival Instinct"
Broschiert, 500 Seiten, € 15,95, Luzifer Verlag 2015 (Original: "Survival Instinct", 2013)
Viel Zeit zum Einstimmen lässt uns die kanadische Autorin Kristal Stittle in ihrem Zombie-Thriller "Survival Instinct" ja nicht gerade: Das Rennen, Retten, Flüchten setzt schon auf den ersten Seiten ein. Da begleiten wir den Kameramann Tobias Mackenzie zu einem Open-Air-Konzert, als in der Zuschauermenge plötzlich das große Gebeiße losgeht. Wie wir später erfahren werden, ist diese Menschenansammlung der entscheidende Katalysator, durch den sich eine schon länger im Verborgenen schwelende Epidemie zum unaufhaltsamen Flächenbrand auswächst.
Elf Erstkontakte
Im zweiten Kapitel ... erleben wir den ganzen Vorgang noch mal, diesmal aus der Warte des Feuerwehrmanns Cillian Knight. Daraufhin habe ich sicherheitshalber vorgeblättert und erst mal entsetzt festgestellt, dass Stittle der Reihe nach nicht weniger als elf(!) Point-of-view-Charaktere einführen wird. Darunter sind beispielsweise die rüstige alte Giftnudel Kara Taggart, der im Rollstuhl sitzende Ex-Soldat Alec McGregor, die Ärztin Riley Bishop, die von ihren spinnerten Eltern für den Überlebenskampf gedrillt wurde, der verwaiste Teenager Danny Cole und dessen Bruder Mathias, der als Sicherheitsmann für jenen Konzern arbeitet, dem die Welt die Zombie-Epidemie zu verdanken hat. Eine solche Romanstruktur könnte Gefahr laufen, einerseits durch ständige Wiederholungen zu langweilen und andererseits viel zu viel Zeit verstreichen zu lassen, bis man den ganzen Figurenreigen einmal durch hat und wieder zu Nummer 1 zurückkehren darf.
Glücklicherweise konnte ich meine Befürchtungen rasch ablegen. Zum einen gehört es einfach zu den Highlights einer Zombiekalypse, wenn jemand noch ahnungslos mit seinem ersten Untoten konfrontiert wird – das kann man offenbar problemlos auch elfmal hintereinander lesen. Und zum anderen gibt es eine Menge Querverbindungen zwischen den einzelnen Episoden; Cillian beispielsweise wird sich als Tobias' Retter erweisen. Auf die Spitze wird die Vernetzung in Kapitel 8 getrieben, das sich um die fünfjährige Alice Carter dreht. Wir werden sie nicht nur als Tochter einer Nebenfigur aus Kapitel 2 erkennen, sondern auch als diejenige, die in Kapitel 6 dabei war, als im rettenden Augenblick ein Zombie überfahren wurde, und die in Kapitel 7 von wieder jemand anderem auf der Flucht gesichtet wurde. Wie diese Flucht ausgeht, erfahren wir dann in Kapitel 10. Hübsch gemacht! All die Querverbindungen aufzuspüren, wird zu einem recht vergnüglichen Sport.
Keine Details bitte – welche Art von Zombies?
In Sachen Zombies sind wir ja mittlerweile alle so saturiert wie ein alteingesessenes Opernpublikum, das jeden Regieeinfall schon tausendmal gesehen hat und nur noch Kerben für "Arie im Stehen geschmettert" oder "Diesmal wieder im Knien gesungen, wie originell" ins Logengeländer ritzt. Wer also nur eine schnelle Orientierung möchte, um welche Subsubform des Zombiegenres es sich handelt – bitte sehr:
Zunächst scheint es sich bei "Survival Instinct" um die Variante zu handeln, die man mittlerweile als die parallelweltliche bezeichnen müsste: also die, in der anscheinend noch nie jemand von Zombies gehört hat. Das täuscht aber. Anfangs haben – gar nicht so unrealistisch eigentlich – die meisten bloß Umstellungsprobleme damit, dass die aus Film, Fernsehen und Literatur bekannten Untoten plötzlich tatsächlich auf den Straßen herumtorkeln. Oder durchs Fenster hereingesprungen kommen. Später besinnt man sich seines popkulturellen Wissens; eine Figur nimmt auf ihre Flucht sogar Max Brooks' "Zombie Survival Guide" mit.
Die Krankheit wird durch eine im Labor erzeugte Mischung aus Virus und Prion übertragen, kann auch verschiedene Tierarten befallen und ähnelt am ehesten der Tollwut-Variante aus "28 Days Later": Die Zombies wollen vor allem beißen und zerfleischen, weniger tatsächlich fressen. Und sie kommen sowohl in schlurfiger Romero- als auch in flotter Snyder-Form vor. Manche sind so klug wie Korallen, andere können Türen öffnen oder kopfunter eine Leiter hinunterkrabbeln – wie "schlau" sie geblieben sind, hängt von einer Reihe Faktoren ab und ist individuell unterschiedlich. Aber keine Angst: Ihnen das Hirn zermerschern funktioniert auch hier ausnahmslos.
Kurzer Ausblick
Nach dem gelungenen Eröffnungsabschnitt mit all seinen Erstbegegnungen flüchten wir zusammen mit den diversen ProtagonistInnen aufs Land. Dabei geht es fast schon mathematisch zu: Die einzelnen Figuren finden sich erst zu Zweier-, dann zu Dreier- oder Vierergruppen zusammen; dabei ergeben sich auch einige potenziell konfliktträchtige Zusammenstellungen. Und so nebenbei schält sich immer mehr die Rolle des Marble-Keystone-Konzerns heraus, der an der Freisetzung des Erregers (ob absichtlich oder nicht) schuld ist. Einige der ProtagonistInnen haben für Marble Keystone gearbeitet, und nicht nur das: Die ganze Stadt – ein fiktiver kanadischer Ort namens Leighton – ist letztlich eine Gründung des Konzerns und hängt an dessen alles bestimmendem Tropf. Da liegt ein Hauch Umbrella Corporation in der Luft.
Ab diesem Abschnitt verringert sich das Tempo des Romans etwas. Und ja, 500 Seiten sind für reine Zombie-Routine schon ein wenig arg lang. Andererseits beinhaltet das Wort "Zombie-Routine" ja schon, dass es nie wirklich langweilig werden kann.
Deutsche Sprache, tote Sprache
Worunter der Roman leidet – um nicht zu sagen stöhnt wie ein Zombie –, ist die Übersetzung. Von diversen Vertippern mal abgesehen (da hätte ruhig noch einmal drübergelesen werden dürfen), ist das Hauptproblem eine unbeholfene Wortwahl und mitunter auch Wortstellung. Ein kurzer Blick zurück zerstob jedoch etwaige Hoffnungen diesbezüglich. Derart unnatürliches Deutsch bekommt man sonst nur zu hören, wenn sich ein Polizist vor der Presse ein Tatprotokoll in behördlich bewilligter Ausdrucksweise abkrampft.
Immer wieder werden Wörter falsch verwendet: "eine unpässliche Gelegenheit", "allenthalben", wo "allenfalls" gehört ... und auch erstaunlich, was sich hier so alles "erbricht" (Schüsse zum Beispiel). Aber Hauptsache, in großzügiger Weise veraltete Ausdrücke wie "fürwahr" oder "obschon" einstreuen. Es ist eine pseudogehobene und leider sehr oft auch nicht gemeisterte Wortwahl, die so richtig überhaupt nicht zu einem in der Gegenwart angesiedelten, rasanten Zombie-Thriller passt. Kurz: Hier mangelt es von vorne bis hinten an Sprachgefühl. Als könnte ihn kein Wässerchen trüben ... au Backe.
Hauptsache spannend
Zum Glück ist Stittle, soweit zwischen der Übersetzung erkennbar, eine sehr straighte Erzählerin, da fällt das weniger ins Gewicht als bei einer großen Stilistin. Und noch etwas Positives: So konventionell "Survival Instinct" auch gestrickt sein mag – Stittle hat damit immerhin geschafft, was Monica Byrnes kunstvoll geklöppeltes Psychogramm "Die Brücke" bei mir überhaupt nicht erreicht hat: Bei jeder einzelnen von Stittles zahlreichen Figuren wollte ich wissen, wie's mit ihm oder ihr weiter- oder zu Ende gehen wird. Sogar bei den unsympathischen. Und das ist, soweit es mich betrifft, letztlich die Grundanforderung an einen Roman.
Mit "Adaptive Instinct" und "Fighting Instinct" hat Stittle mittlerweile zwei Fortsetzungen geschrieben. Vielleicht werden die ja auch wieder auf Deutsch veröffentlicht – aber dann bitte einen anderen Übersetzer ranlassen, fürwahr.
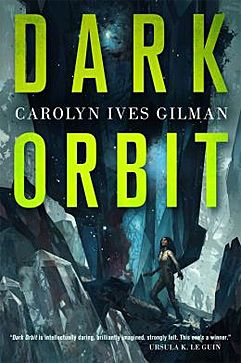
Carolyn Ives Gilman: "Dark Orbit"
Gebundene Ausgabe, 303 Seiten, Tor Books 2015
For others, time passed. For a Waster, it was always just now. Fraglos eines der Highlights in "Dark Orbit", dem jüngsten Roman Carolyn Ives Gilmans, ist das Anfangskapitel, in dem die US-Autorin die schönste Beschreibung eines nonlinearen Lebensstils seit Joe Haldemans "Der ewige Krieg" abliefert.
Ein Leben außerhalb der Zeit
Am Beamen liegt's, das dann halt doch nicht so einfach abläuft wie bei "Star Trek" (bzw. den Stepperscheiben von Larry Niven oder den Transmittern von "Perry Rhodan"). Zum einen sind sich die interstellar Reisenden, also die Wasters, in "Dark Orbit" sehr bewusst, dass sie nicht körperlich, sondern nur als Informationspakete verschickt und am Zielort ganz neu erschaffen werden. Sara Callicot, die Hauptfigur mit Hindu-Hintergrund, fühlt jede solche "Wiedergeburt" in ihren reduplizierten Knochen.
Wiederholt seine Moleküle in der halben Galaxis zu verstreuen wäre alleine schon Grund genug, sich die Frage zu stellen, was das Wort "Ich" genau bedeutet. Die eigentliche Crux ist aber die Reisegeschwindigkeit. In Gilmans Romanwelt hat Teilchenverschränkung zwar Kommunikation ohne Zeitverlust ermöglicht – aber nur für vergleichsweise geringe Infomengen. Das gewaltige Datenpaket eines vollständigen Menschen kann nur mit Lichtgeschwindigkeit verschickt werden. Was angesichts der enormen Entfernungen zwischen den Welten bedeutet, dass die Wasters stets als lebende Anachronismen am Zielort ankommen.
Im günstigsten Fall werden sie nur schief angesehen, weil sie veraltete Mode tragen. Schwerer wiegt da schon, dass sie sich immer wieder mit veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vertraut machen müssen (an dieser Stelle setzt Gilman einige witzige Spitzen gegen die waffen- und überwachungsverliebten USA unserer Tage). Und natürlich verlieren die Wasters nach und nach alle Angehörigen, für die sich die Uhr weitergedreht hat, während sie selbst zwischen den Sternen auf Lichtgeschwindigkeit eingefroren waren. Wasters leben einsam – trotzdem würde Sara nie mit einem Plant (so die Bezeichnung für diejenigen, die ihr Leben lang auf ihrem Heimatplaneten bleiben) tauschen. Und daran ändert nicht einmal der Umstand etwas, dass jedes Beamen letztlich auch einen Sprung ins Ungewisse bedeutet: Schließlich muss man immer darauf vertrauen, dass am zukünftigen Zielort jemand sein wird, der noch die benötigte Empfangstechnologie hat ...
Die Ereignisse kommen ins Rollen
Sara ist noch kaum auf ihrer Heimatwelt Capella Two angekommen, da wird sie von einem alten (und gealterten) Bekannten auch schon wieder auf die Reise geschickt. Am Rande des bekannten Kosmos hat ein uraltes robotisches Erkundungsschiff einen potenziell bewohnbaren Planeten aufgespürt. Und das in einem Sternsystem voller Gravitationsanomalien, weshalb man dort eine Ballung von Dunkler Materie vermutet. Was nebenbei für interessante Spekulationen genützt wird, dass nicht Materie Gravitation bewirkt, sondern dass im Gegenteil die Schwerkraft für sich existiere und Materie sich nachträglich dort ansammle, wo sich die Gravitation ballt.
Sara wird aber nicht nur in ihrer Funktion als Exoethnologin ins ferne Iris-System gebeamt. Sie soll auch – streng vertraulich – auf ein anderes Expeditionsmitglied aufpassen: die adelige Thora Lassiter, die für einen diplomatischen Eklat gesorgt hatte, als sie auf einem rückständigen Planeten von einer Art Geisteskrankheit befallen wurde und ungewollt einen Bürgerkrieg auslöste. Dass gleich nach dem Aufwachen an Bord des Pionierschiffs in der Kabine neben Thora eine geköpfte Leiche gefunden wird, macht Saras Aufpasserrolle nicht gerade einfacher.
Eine Frage der Kultur
Auf dem Buchcover streut niemand Geringeres als Ursula K. Le Guin der Autorin Rosen. Was durchaus passt, denn mit ihrer "Twenty Planets"-Reihe hat Gilman ein literarisches Universum geschaffen, das Le Guins "Hainish"-Zyklus recht ähnlich ist. Wir bewegen uns in einem kleinen von Menschenabkömmlingen geschaffenen Sternenreich, bei dem es vor allem auf die kulturellen Unterschiede zwischen den einzelnen Planetenbevölkerungen ankommt. Reizvoll ist in "Dark Orbit" etwa die brisante Chemie zwischen Sara und dem Sicherheitschef der Expedition, Dagan Atlabatlow. Sie entstammt einer Kultur, in der man auf Autoritäten pfeift – er kommt von einem Planeten, auf dem man glaubt, dass die innigste Beziehung zwischen Jäger und (menschlicher) Beute besteht.
Auf Iris stoßen sie nun auf eine ganz andere Kultur, die von der lange zurückliegenden Diaspora der Menschheit übriggeblieben ist. Diese Menschen leben in ewigem Dunkel. Und obwohl ihre Augen rein technisch funktionieren würden, orientieren sie sich ausschließlich über Gehör, Gerüche und Berührungen. Plus etwas esoterischeren Möglichkeiten, wie sich noch zeigen wird. In den 70ern hätte man "Dark Orbit" schlicht als Science Fantasy bezeichnet – heute braucht man ja bloß den Quantenzauberstab schwingen, schon lässt sich alles irgendwie verwissenschaftlichen.
Thora, eine "Sensualistin", die an Wahrnehmungsmöglichkeiten außerhalb bestehender Schubladen glaubt, lässt sich bereitwillig auf die neue Kultur ein. Parallel dazu versuchen die übrigen Expeditionsmitglieder, dem indigenen Mädchen Moth das Sehen beizubringen. Mit Folgen, wie man sie aus der Medizin von lebenslang blinden Menschen, deren Gesichtssinn dann doch aktiviert wird, kennt: Wer nie Konzepte wie Räumlichkeit oder Perspektive erlernt hat, empfindet die Flut an neuen Eindrücken nicht bereichernd, sondern hoffnungslos desorientierend. Die parallel-gegenläufige Entwicklung zwischen Thora und Moth bestimmt die Struktur von "Dark Orbit", und unterm Hintern aller Beteiligten dräuen die zunehmenden Gravitationsanomalien im Iris-System.
Ein paar Abstriche
Wie man sieht, ist das Konzept des Romans perfekt durchdacht. In der Ausführung gibt es allerdings ein paar Abstriche vom Optimum:
+ Nach der Einführung von Iris als Kristallwelt voller Spiegellabyrinthe, fraktaler Räume und geometrischer Anomalien samt dazupassendem einheimischem Leben sind die im Dunkeln herumkrebsenden Höhlenmenschen dann doch ein wenig ... wenig.
+ Da diese aus einer früheren Expansionswelle der Menschheit stammen, sprechen sie auch eine altertümliche Version der universellen Standardsprache. Historikerin Gilman setzt dies in Form von Shakespeare-Englisch um, was folgerichtig sein mag, auf mich zumindest aber unfreiwillig komisch wirkt ("Harken thou, Torobes!" Moth said dramatically, so that her voice echoed. "Harken, for I have been to a wondrous place.")
+ Ein ganz banaler Faktor: Sara und Thora teilen sich das Buch halbe-halbe. Da Thoras Kapitel rein formal ein aufgezeichnetes Audio-Protokoll sind, hat Gilman diese Passagen kursiv gesetzt. Aber ehrlich – über aberdutzende Seiten hinweg kursiv lesen, das nervt mit der Zeit.
+ Am wichtigsten aber: der Plot-Driver. In einem gar nicht so unähnlichen Culture-Clash-Szenario fand Joan Slonczewski für "A Door Into Ocean" einen hervorragenden Handlungsmotor in einem heraufziehenden Krieg. Auf dem Papier übernehmen die sich verschlimmernden Gravitationsanomalien diese Rolle bei Gilman – würde sie zwischendurch nicht lange drauf vergessen, was zu einem gewissen Absacker im mittleren Teil des Romans führt.
Lektüre lohnt trotzdem
Ansonsten wie gesagt: ein hervorragendes Buch voller faszinierender Ideen. Und obwohl die "Twenty Planets"-Reihe aus jeweils abgeschlossenen Romanen besteht, wäre hier eine Fortsetzung denkbar und sogar wünschenswert.
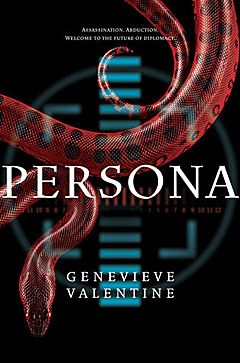
Genevieve Valentine: "Persona"
Gebundene Ausgabe, 310 Seiten, Simon & Schuster 2015
Reichlich bizarr war sie, die postapokalyptische Steampunk-Freakshow, die uns Genevieve Valentine 2011 in ihrem Erstling "Mechanique" präsentierte. Ihr jüngster Roman "Persona" steht in Sachen Ausstattung und Special Effects am exakt anderen Ende des Spektrums. Dafür wirken die Gedankengänge der Hauptfigur im Anfangskapitel nicht minder bizarr als das Setting von "Mechanique" – man braucht erst mal etwas Zeit, die hier geltenden Verhältnisse zu verstehen, daher beginne ich mit einem Infodump.
Gesichter der Weltpolitik
Wir befinden uns in einer sehr nahen Zukunft, vielleicht auch in einer Parallelwelt. Hier gibt es in den Kopf implantierbare Kameras (so ziemlich das einzige SF-Element des Romans) und ein paar in unserer Welt nicht vorhandene Staaten wie Free Korea – vor allem aber gibt es eine etwas andere Form von Außenpolitik. In der hiesigen Entsprechung der UNO-Vollversammlung, der International Assembly, sitzen nicht etwa gesichtslose DiplomatInnen, sondern ganz im Gegenteil die Faces: telegene junge Leute, die buchstäblich als Gesichter ihrer Nationen auftreten und Celebrity-Status haben.
Weltpolitik als Reality-Soap, mit knochenhart ausgebildeten It-Girls und It-Boys als HauptdarstellerInnen, darauf in etwa läuft "Persona" also hinaus. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Die Faces agieren dabei in einem faszinierend fremdartigen Spannungsfeld: Hinter ihnen stehen ihre handlers, eine Mischung aus Indoktrinatoren und PR-Beratern, die ihre Schützlinge auf Linie halten sollen. Nach außen hin dagegen strahlen sie im Scheinwerferlicht, nehmen an glamourösen Events teil, sammeln in der Öffentlichkeit Sympathiepunkte für ihre jeweilige Nation und können untereinander sogar abgesprochene Beziehungen eingehen (so lässt sich ein wirtschaftspolitischer Vertrag in den Medien als quotenträchtige Romanze verkaufen). Aber Achtung: Sympathie kann es einem Land auch einbringen, wenn sein Face zu Tode kommt. Die Jungs und Mädels müssen sich also stets bewusst sein, dass ihr Luxusleben ein Tanz am Rande des Vulkans ist.
Das dynamische Duo
Suyana Sapaki ist ein solches Gesicht. Als sogenannte "C-Listerin" ist sie für die Medien allerdings nur von geringem Interesse. Die kämpferische Quechua aus Peru spricht für die vergleichsweise unbedeutende Amazonian Rainforest Confederation und punktet maximal mit Exoten-Status. Immerhin: Einmal konnte sie den Fokus auf sich richten, als in ihrem Land ein US-amerikanischer Stützpunkt in die Luft flog. Seitdem ist sie aber wieder in die dritte Reihe zurückgetreten. Bis eines folgenschweren Tages in Paris ein Attentat auf sie verübt wird.
Auftritt der zweiten Hauptfigur: Der junge Daniel Park hat als Journalist in Korea gearbeitet, bis er sich wegen eines Fauxpas nach Paris absetzen musste. Hier versucht er sich nun als snap durchzuschlagen – das ist das, was von der freien Presse übrig blieb: Paparazzi, die im Auftrag von Untergrund-Agenturen Faces bei inoffiziellen Aktivitäten abzulichten versuchen. Da sie damit die Hochglanz-Inszenierungen der mit der International Assembly verbandelten offiziellen Presse unterwandern, werden sie gnadenlos verfolgt. Aber was tut man nicht alles für Geld. Daniel jedenfalls hat sich Suyana als Zielobjekt herausgepickt und ist deshalb zur Stelle, als auf sie geschossen wird. Er zieht das verletzte Mädchen aus der Schusslinie, und von da an ist das ungleiche Duo auf der Flucht.
Misstrauen gibt den Ton an
"Persona" hat eine geradezu novellenartige Verdichtung: Die gesamte Handlung spielt sich innerhalb von nur zwei Tagen ab. Zudem bleiben wir stets direkt bei unseren beiden Hauptfiguren und dem tiefen Misstrauen, das zwischen ihnen brodelt. Daniel beispielsweise hält es für durchaus möglich, dass es sich bei dem Attentat lediglich um einen inszenierten Publicity-Stunt handelt. Suyana wiederum weiß überhaupt nicht, wie sie ihren Retter einschätzen soll. Zudem plagt sie sich mit der Frage, wer hinter dem Attentat stecken mag: Die USA, mit deren Face sie gerade eine Liaison eingehen wollte? Die Öko-Terroristen, mit denen sie heimlich kooperiert? Die International Assembly selbst? Oder gar ihr eigener handler?
Das Zusammenspiel zwischen den beiden Hauptfiguren bildet eines der Kernelemente von "Persona". Suyana würde Daniel gerne vertrauen – doch wurde ihr in jahrelanger Ausbildung eingebläut, stets authentisch zu wirken, es aber niemals zu sein. (They were trained never to give thanks if they were sincere, because if you cared about something, it could be used against you.) Alles, was ein Face sagt oder tut, ist einstudiert. So ist Suyana wie ihre Kollegas zu einer Meisterin mimischer, gestischer und verbaler Subtilitäten geworden – auch Daniel bekommt ihre manipulativen Fähigkeiten zu spüren. Es ist, als hätte Kim Kardashian eine Bene-Gesserit-Ausbildung genossen ... brrr, das war jetzt vermutlich der gruseligste Gedanke des Monats.
Resümee
Dreh- und Angelpunkt von "Persona" ist die Frage, was Öffentlichkeit mit den Menschen macht, die in ihr leben müssen. Nicht von ungefähr bloggt Genevieve Valentine regelmäßig von Oscar-Verleihungen und ähnlichen Großveranstaltungen (ihre sogenannten "Red Carpet Rundowns"). Dankenswerterweise präsentiert sie das aber nicht als nabelbeschauliches Ringen um die Identität, sondern eingebettet in eine Handlung mit hohem Tempo und gleichermaßen hoher Paranoia-Quote. Zudem ist es bemerkenswert, wie fremdartig die Romanwelt wirkt, obwohl sie sich von der unseren doch nur minimal unterscheidet.
Was aber nicht heißen soll, dass "Persona" perfekt wäre. So richtig kann ich mir nach Beenden des Romans noch immer nicht vorstellen, wie groß der politische Handlungsspielraum eines Face nun wirklich ist. Auch die Öffentlichkeit selbst kommt paradoxerweise zu kurz: Man sollte annehmen, dass Suyana als Medienpersönlichkeit auf der Flucht gelegentlich auch mal mit einem Otto Normalverbraucher, der sie wiedererkennt, konfrontiert würde. Wir erleben sie aber immer nur innerhalb ihrer diplomatischen/politischen/terroristischen Peer-Group, recht losgelöst vom Rest der Welt eigentlich. Da der Roman zudem eher mit einem Etappenziel als einem rundum befriedigenden Schluss endet und eine Reihe von Dingen unausgesprochen lässt, wäre noch reichlich Material für Fortsetzungen übrig. Würde ich glatt lesen.

Stephanie Schnee: "Der Schuppenmann"
Broschiert, 122 Seiten, € 7,90, p.machinery 2015
Eine mächtige Erschütterung, so etwas wie ein Urschrei, aber ein dumpfer, ein Hinaufsteigen und Absacken aller Säfte gepaart mit einem anschließenden Knirschen, Knacken und Krachen Abertausender von Borken, welche gewaltsam versetzt worden waren, die Verschachtelung der Schuppen hatte sich gelöst, ereignete sich in genau dem Augenblick, als er geboren wurde. So beginnt nicht nur der Kurzroman der deutschen Autorin Stephanie Schnee, von der ich nun zum ersten Mal etwas gelesen habe. So beginnt auch das Leben ihres Titelhelden, des Bäumlings bzw. Schuppenmannes.
Das Titelbild zeigt exakt, was am Anfang steht: Eine Eiche gebiert ein anthropomorphes Wesen aus Holz, das anschließend zu einer Art Botschafter des Waldes wird. Schnees insgesamt etwas naive Öko-Fabel ist damit nicht zuletzt eine verkappte Jesus-Geschichte, allerdings mit Chlorophyll Kid von der Legion der Superhelden in der Rolle des Messias.
Auf, du junger Wandersbaum
Die Handlung ist rasch erzählt: Der Bäumling zieht in die Stadt, wird als Ruhestörer festgenommen, durchläuft im Gefängnis einige Metamorphosen, die den untersuchenden Amtsarzt an den Rand des Wahnsinns bringen, und entkommt. Nachdem er sich regeneriert hat, zieht er erneut in die Stadt, findet erste Jünger und präsentiert sich der Öffentlichkeit, womit er erneut Aufruhr auslöst.
Die gleichnishafte Geschichte enthält einige wirklich schöne Abschnitte: Etwa das erste Kapitel, in dem der Bäumling in jugendlicher Lebenslust durch den Wald zieht und sich von Sinneseindrücken fluten lässt. Oder wenn er seine Fähigkeit einsetzt, verarbeitetes Holz wieder lebendig zu machen und austreiben zu lassen. Und nicht zuletzt sorgt seine Mittelexistenz zwischen Mensch und Pflanze immer wieder für Situationskomik, wissen die Stadtbewohner doch so gar nicht, wie sie mit ihm umgehen sollen: Als man ihm Nahrung und Wasser entzieht, schrumpft er zu einer unzugänglichen Kapsel zusammen. Also stellt man ihn beim nächsten Mal ins Wasser – wodurch er aber morsch wird und ihm die Beine abfallen.
Stilistischer Wildwuchs
Das Wie ist bei Schnee allerdings mindestens so wichtig wie das Was. Ähnlich Thomas Ziegler in seiner "Sardor"-Reihe setzt Schnee auf einen überkandidelten Stil irgendwo zwischen romantischem Überschwang und expressionistischer Poesie. Die vielen Rufzeichen! Überall Rufzeichen! Die Hälfte weniger hätte gereicht! Mindestens!
In ihren lichtesten Momenten macht die Autorin mit der Natur Ähnliches wie Frank Hebben mit der Welt der Maschinen. Allerdings ist Hebben (der in der nächsten Rundschau wieder mit einem Roman vertreten sein wird) in seiner sprachlichen Experimentierfreude in der Regel sehr trittsicher. Was man von Schnee nicht unbedingt behaupten kann. Schlicht und einfach falsche Ausdrücke ("ein reißerischer Wind") tummeln sich in Schnees Text ebenso wie Stilblüten (Wie sehr der Steckling ihn doch anwurmte mit seiner lebenshungrigen Spitze! Oder: Des Bäumlings Rückkehr ins Leben lief einer Ästhetisierung des Prozesses wahrhaftig entgegen. Was soll dieser Satz überhaupt bedeuten?). Normalerweise rüge ich an dieser Stelle das Lektorat, doch wage ich zu bezweifeln, dass sich beim Verlag jemand getraut hat, in diesem Text zwischen geglückten und missglückten Formulierungen zu unterscheiden.
Bilanz: Seltsam unterhaltsam
Ironischerweise demonstriert der Text, dass mehr manchmal tatsächlich mehr sein kann. Stilblüten, die mir in einem konventionelleren Text die Augen versengen würden, gehen hier in Schnees ziemlich einzigartigem Erzählschwall unter. Ist ein bisschen so wie anno dunnemals die berühmt-berüchtigte ORF-Comedy "Tohuwabohu" mit ihren Schnellfeuer-Gags: Who cares, wenn einer oder zwei (oder zehn ...) danebengehen, drei Sekunden später kommt ja schon der nächste. Mit nüchterner Distanz kann man an Schnees Text so einiges bekritteln – aber steckt man im Strudel erst mal drin, lässt man sich auch mitreißen.
Dass mir "Der Schuppenmann" trotz diverser Mängel als zumindest nicht negativ in Erinnerung geblieben ist, lag aber auch schlicht und einfach an der Zufälligkeit meiner Lesereihenfolge. Hätte die anders ausgesehen, wäre mir der Text vermutlich viel zu schwurbelig gewesen. So aber habe ich ihn direkt nach der sterilen Ödnis von Joelle Charbonneaus jüngstem "Auslese"-Roman gelesen (siehe zwei Klicks weiter) – und im Vergleich dazu war "Der Schuppenmann" ein angenehm lebendiger Kontrast. Ist eben alles relativ. Oder um es mit Schnee zu sagen: Ist eben alles relativ!
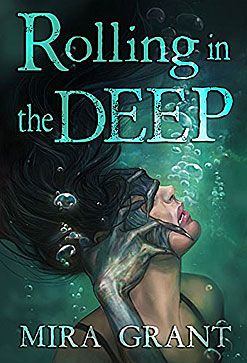
Mira Grant: "Rolling in the Deep"
Gebundene Ausgabe, 123 Seiten, Subterranean Press 2015
Und noch einmal ein Stück Natur. In Mira Grants ebenso blutiger wie lustiger Horror-Novelle "Rolling in the Deep" will die Natur allerdings keine Heilsbotschaften verbreiten, hier hat sie Zähne und Klauen. Und Schwimmhäute. Meerjungfrauen – also die Grant traut sich was! Eine Nixe hat doch schon so mancher Karriere den Knick verpasst. (Ich nenne keine Namen ... M. Night Shyamalan.)
Mira Grant, ein Pseudonym der kalifornischen Erfolgsautorin Seanan McGuire, ist auf Deutsch mit der Zombie-Trilogie "Feed" / "Deadline" / "Blackout" bekannt geworden. Auch in "Rolling in the Deep" wählt sie wieder die Strategie, ein klassisches Horror-Motiv aufzugreifen und mit einem Medien-Twist zu versehen.
Auf ins Verhängnis!
In der an Warren Fahys "Biosphere" erinnernden Prämisse der Novelle bedeutet dies Folgendes: Der Privatsender Imagine Network hat seine Marktlücke in der Vermischung von kryptozoologischen Dokumentarfilmen und Scripted Reality gefunden. Mit viel Tamtam rüstet der Sender nun eine Expedition zu einem Seitenarm des Marianengrabens aus, wo man sich auf die Suche nach Meerjungfrauen begeben wird. Und eines gleich vorneweg: Man wird auch wirklich welche finden. Lieblich sind sie allerdings nicht. Grant hat ein paar nette Einfälle zur Biologie der doch nicht nur mythologischen Geschöpfe. Und hat sich eigentlich schon mal jemand gewundert, warum man immer nur Meerjungfrauen sieht?
Die Zusammenstellung der Expedition ist bizarr: Dazu gehören echte WissenschafterInnen, die zusammen mit ebenso echten StudentInnen vor Ort tatsächlich echte Forschung betreiben sollen. Dass die Rahmenbedingungen ihrer Tätigkeit alles andere als seriös sind, wissen sie – aber sie brauchen das Geld. Zur Expedition gehören aber auch SchauspielerInnen, die für etwas Human Drama sorgen sollen. Und last but definitely not least die elf Damen des Blue Seas Ensemble: Professionelle Synchronschwimmerinnen, die bei Firmenfeiern und Karnevalen als Meerjungfrauen mit Neoprenschwanz auftreten. Sie sollen bei Gelegenheit am Rande des Aufnahmebereichs der Kameras mal unverfänglich durchs Bild schwimmen ...
Der Anfang vom Ende
Zusammen mit dem Produktionsteam und der Crew stechen damit an Bord des umgebauten Passagierschiffs "Atargatis" über 200 Leute in See. None of them would ever be seen again, of course, just as none of the scientists, interns, Imagine camera crews, or ship's personnel would be seen again – not alive. But in that moment, as the Atargatis sailed, none of this was known. They saw a great adventure. They saw a glorious and entertaining hoax. They saw profit, ratings, everything but the disaster that awaited them. The Atargatis sailed blithely on, out of the harbour, and into history.
Schon aus dem Prolog wissen wir also, wie das Unternehmen enden wird. Aber wissen wir auch, ob es sich tatsächlich so zugetragen hat? Dieser Prolog ebenso wie kurze Abschnitte zwischen den Kapiteln sind Kommentare aus der Sendung, die das Imagine Network aus dem gefundenen Videomaterial zusammengeschnitten haben will. Und diese Passagen sind clever ambivalent gehalten – sie lassen die Möglichkeit offen, dass alles nur ein Hoax sein könnte. Was zur interessanten Meta-Frage führt, ob die Geschehnisse in einem Buch weniger real sind, wenn sie "nicht stimmen". Beim Leben und Sterben der Hauptfiguren sind wir jedenfalls live dabei – selbst wenn es sich nur um eine Fiktion innerhalb einer Fiktion handeln sollte. Aber vielleicht will der Sender mit dieser Taktik ohnehin nur verschleiern, dass er ein paar hundert Menschenleben auf dem Gewissen hat.
Meerjungfrauen beißen besser
Für den längeren Teil bewegt sich die Erzählung im Wissenschaftsthriller-Modus dahin; erste ungewöhnliche Entdeckungen lassen vorerst nur erahnen, dass sich unter dem Schiff Ungemach zusammenbraut. Die Gewalt kommt dann so, wie sie in Wirklichkeit eigentlich immer kommt: wie aus dem Nichts und mit Vehemenz. "That mermaid ate his fucking face off!" Let the gorefest begin ...
Kurzum: Als "Rolling in the Deep" erst mal in Gang gekommen war, war es ein echtes Vergnügen. Allerdings auch ein kurzes. Gut 100 Seiten in einem relativ großzügigen Satz: Das ergibt ein hübsches Schmuckbändchen, aber 37 Euro sollte niemand dafür bezahlen – limitierte Auflage mit Autogramm der Autorin hin oder her. Ausnahmsweise empfehle ich in diesem Fall daher explizit darauf zu warten, bis der Titel wieder als E-Book erhältlich ist.

Nnedi Okorafor: "Lagoon"
Broschiert, 305 Seiten, Saga Press 2015
Nnedi Okorafors erster Roman für Erwachsene, "Who Fears Death", hat mich seinerzeit nur halb so begeistert, wie es der Hype ums Buch erwarten ließ. Mit "The Book of Phoenix" ist heuer ein Prequel erschienen, das näher an unserer Gegenwart angesiedelt und damit auch sciencefictionesker als die magisch geprägte Zukunftswelt von "Who Fears Death" ist. Im Prinzip hätte mich die Erklärung interessiert, wie aus einer SF- eine Fantasywelt werden konnte. Erste Reaktionen auf das Buch – durchaus lobende – lasen sich für mich dann aber so, als würden auch hier wieder die Elemente, die mir nicht so viel gegeben hatten, im Vordergrund stehen.
Also habe ich lieber zu was anderem gegriffen; von Okorafor kommt ja schließlich genug. Zum Beispiel "Lagoon", eine quirlige First-Contact-Geschichte, in der es turbulent genug zugeht, dass die Menschen sowieso und gelegentlich auch die Außerirdischen von den Ereignissen überfordert werden. Ähnlich Linda Nagatas "The Red: First Light" ist auch dieser Roman ursprünglich 2014 erschienen (bei Hodder & Stoughton), ehe kürzlich Saga Press eine Neuausgabe veröffentlicht hat.
Splash! Die Alljungfrau
Zur Abwechslung landen die Alienbotschafter mal nicht in New York oder Washington, sondern ganz heimlich in Nigerias Millionenmetropole Lagos – oder genauer gesagt: ein Stückchen davor im Meer. Und die allerersten Kontakte knüpfen sie darum auch nicht zu Menschen, sondern zur Unterwasserfauna. Die nützt die Gelegenheit, sich von den außerirdischen Wunscherfüllern in neue, wehrhafte Formen umwandeln zu lassen. "I am change", wird Botschafterin Ayodele später einmal erklären. Diese Veränderungen sollen den Menschen zugutekommen – aber eben nicht nur ihnen. Baden und fischen sollte man in Lagos künftig besser nicht mehr gehen.
An Land fühlen sich indessen drei Menschen wie magnetisch zur Küste gezogen: Die Meeresbiologin Adaora, der Soldat Agu und der Rapper Anthony. Sie wurden ausgewählt, den Aliens bei ihrer Mission zu helfen (worin diese besteht, bleibt übrigens sehr lange offen und scheint dann auch nur mehr eine untergeordnete Rolle zu spielen – sowas ist typisch für Okorafor). Zunächst einmal sollen sie die Ankunft der Außerirdischen bezeugen ... wie die Heiligen Drei Könige, und "Lagoon" ist mindestens so sehr eine verkappte Jesusgeschichte wie Stephanie Schnees "Schuppenmann". Witzigerweise kann auch dieser Heiland die Gestalt wechseln – allerdings besteht er aus winzigen metallischen Kugelmodulen und erzeugt bei jeder Wandlung ein ohrenzerfetzendes Kreischen.
Ein herrliches Chaos
"Lagoon" setzt stark auf den Rashomon-Effekt: Wir erleben das Geschehen aus den jeweiligen Perspektiven zahlloser ProtagonistInnen. Und bald werden fast ebenso viele unterschiedliche Interessen an den heimlich über die grüne Grenze eingeschlichenen Aliens geweckt : Die LGBT-Gruppe von Nigeria mischt da ebenso mit wie die Gemeinde eines bigotten Bischofs – und wieder andere wollen Ayodele entführen, um Geld aus der Sache zu schlagen. Bald hat sich um Ayodeles Unterkunft der reinste Karneval angesammelt – nur die verantwortlichen Behördenvertreter sucht man vergeblich. Irgendwann wird der Rummel sogar Ayodele zuviel, sodass sie sich in einer witzigen Passage für einige Zeit in ein schmollendes Äffchen verwandelt. Auch überlegene außerirdische Kultiviertheit hat ihre Grenzen.
Wie immer bringt Nnedi Okorafor auch in diesen Roman viele Elemente aus dem Magic Realism ein: Als zwischenzeitliche Erzähler fungieren vermenschlichte Tiere oder auch Gestalten aus der nigerianischen Mythologie (das "Straßenmonster" könnte glatt eine Schöpfung von Stephen King sein). Und dann wären da noch die übernatürlichen Kräfte, die unsere drei auserwählten Hauptfiguren in Notlagen entfesseln können.
Kurzum: "Lagoon" ist ein einziges fröhliches Chaos, auf Turbulenz versessen wie die Filme in Nigerias "Nollywood"-Kino und generell sehr stark auf Lokalkolorit setzend. Für die zahlreichen Pidgin-English-Ausdrücke gibt es am Ende des Romans übrigens ein Glossar. Letztendlich ist der Roman eine Ode an das Potenzial von Lagos bzw. von Nigeria: das Land, aus dem Okorafors Eltern einst in die USA auswanderten, und das die Autorin immer noch regelmäßig besucht.
Und dann war da noch "Binti"
Überall bekommt man zu lesen, dass Nnedi Okorafor eine große Erzählerin sei. So richtig hundertprozentig bin ich davon noch nicht überzeugt. Es stimmt, sie bringt aufgrund ihrer Herkunft neue Perspektiven ein – sowohl was Schauplätze und Figuren als auch was ihren Stil anbelangt. Afrikanische bzw. nichtwestliche Erzählweisen mit den uns geläufigen zu mischen, wirkt belebend. Und sie sprudelt fraglos vor Ideen nur so über. Eine große Erzählerin müsste aber meines Erachtens nicht nur über Einfallsreichtum und einen individuellen Stil verfügen, sondern auch die Struktur fest im Griff haben – in dem Punkt geht sie's aber immer wieder recht locker an und lässt unterwegs so einiges liegen.
Beispiel: Ihr allerneuestes Werk, die Novelle "Binti", erschienen bei Tor (siehe das Cover oben links). Titelfigur der Erzählung ist eine junge Himba, also eine Angehörige eines namibischen Volks, die sich aus ihrer Familientradition löst und heimlich zu einer renommierten Universität auf einem anderen Planeten aufbricht. Sie fliegt mit einer gentechnisch gezüchteten, weltraumtauglichen Riesengarnele, trägt ein seltsames außerirdisches Gerät aus einem früheren Zeitalter mit sich, das sie mal gefunden hat, und wird auf ihrem Trip auch noch mit mörderischen Medusen konfrontiert, die das Raumschiff entern.
Die Geschichte dreht sich um Themen wie individuelle Selbstbehauptung und Bewahrung der kulturellen Identität und kann neben den genannten Elementen auch noch mit einem faszinierenden Konzept einer Art "Mathemagie" aufwarten: "My people are the creators and builders of astrolabes", I said. "We use math to create the currents within them. The best of us have the gift to bring harmony so delicious that we can make atoms caress each other like lovers." – Da ist also eine ganze Menge drin, aber letztendlich verpufft auch alles in einer totalen Antiklimax. Die Auflösung kann man einfach nur unbefriedigend finden – mal ehrlich: Für Massenmord wird man mit einem Uni-Stipendium belohnt? Und ich Blödmann hab jahrelang Studiengebühren bezahlt.
Resümee
"Binti" ist nicht unbedingt eine Beweisführung in Sachen große Erzählerin. Einfallsreiche Erzählerin, ja. Große Fabuliererin, ja. Aber das ist eben nicht ganz das Gleiche. Die Novelle würde ich daher eher nicht empfehlen. "Lagoon" hingegen ist eindeutig lohnende Lektüre – eine erfrischende Variante eines alten SF-Themas, die Fans von First-Contact-Geschichten tatsächlich etwas Neues zu bieten hat.

Joelle Charbonneau: "Die Auslese: Nichts vergessen und nie vergeben"
Gebundene Ausgabe, 414 Seiten, € 17,50, Penhaligon 2015 (Original: "Independent Study", 2014)
Joelle Charbonneau lesen erinnert ein bisschen daran, wie es ist, als Erwachsener FM4 zu hören: Die Musik mag man noch, dazwischen das Gequatsche über Partys und Schule kommt einem aber von Jahr zu Jahr fremdartiger vor. Und vermutlich muss man dem Schulalltag noch nahe sein, um dem von Charbonneau entworfenen Szenario etwas abgewinnen zu können. Mit zunehmender Distanz merkt man allerdings, was für ein dünnes Süppchen die Autorin kocht.
Zur Erinnerung: Im Eröffnungsband ihrer Trilogie "Die Auslese" – einer Trittbrettfahrt auf dem ÖBB-Sonderzug "Hunger Games" – stellte uns Charbonneau eine vage postapokalyptische Welt vor, die gerade dabei ist, sich wieder zu berappeln. Auf dem Gebiet der ehemaligen USA hat das Vereinigte Commonwealth ein Netz von Kolonien etabliert, die sich mit der Revitalisierung der von atomaren, chemischen und biologischen Waffen verwüsteten Landschaft abrackern. Damit das Commonwealth nur von den Besten geführt wird, werden Jugendliche einem streng geheimen Selektionsprozess unterworfen: Wer die diversen Challenges und den gnadenlosen Konkurrenzkampf, die die Auslese mit sich bringt, nicht bewältigt, landet in der Regel in einem Leichensack.
Die Prämisse
Hauptfigur Cia Vale hat die Auslese in Band 1 überstanden und ist nun zur Universität in der Hauptstadt Tosu-City, dem ehemaligen Wichita, zugelassen. Sollte sie aber geglaubt haben, es wäre nun mit der Lebensgefahr vorbei, so hat sie sich getäuscht: Auch hier folgt eine Prüfung auf die andere, und schon bald muss sie beobachten, wie der reglose Körper eines Kommilitonen heimlich vom Uni-Gelände abtransportiert wird.
Eigentlich sollte sie sich an die Auslese gar nicht erinnern, denn allen überlebenden TeilnehmerInnen wird vor Studienantritt das Gedächtnis gelöscht. Allerdings hatte Cia heimlich Aufzeichnungen angefertigt und hört nun mit Schaudern, welche Untaten an ihr und ihren LeidensgenossInnen begangen wurden – und mehr noch: welche Untaten sie selbst begehen mussten, um zu überleben. Damit wäre die Keimzelle für eine widerständige Haltung Cias geboren, und tatsächlich knüpft sie an der Uni Kontakte zu einer angeblichen Rebellenbewegung gegen das System. Dieser Faden wird allerdings erst nach diversen hundert Seiten wieder aufgenommen und soll wohl hauptsächlich dem Abschlussband vorbehalten bleiben.
Sinnfreies Seitenfüllen
Denn erst einmal steht schon wieder eine Challenge an, erneut ein Geländetest der völlig sinnlosen Art. Eine Schnitzeljagd durch die Hauptstadtregion führt Kapitänin Cia mit ihrem Team von einem aufgelassenen Zoo über ein Militärgelände bis zum Gebäude der Zentralregierung. Am jeweiligen Etappenziel wartet dann immer ein Zettel mit einer kryptischen Botschaft, wie's weitergeht – es ist wie eine Schatzsuche im "Dschungelcamp".
Spätestens wenn die Commonwealth-Präsidentin höchstselbst mitten in einer Ratssitzung unterbrochen werden darf und dann Cia einen Umschlag mit neuen Hinweisen überreicht, merkt man, wie lächerlich das Ganze ist. Brave Kinder, habt ihr gut gemacht – sind sie nicht schlau? Jetzt geht weiterspielen und wir machen wieder Politik. Es wirkt wie ein Unterhaltungsprogramm für zehnjährige Pfadfinder – abgesehen natürlich von den tödlichen Fallen, die unterwegs lauern. Und am Ende dessen, was wohl eine Art wildgewordenes Teambuildingseminar sein soll, haben wir auch schon die Mitte des Romans erreicht. So füllt man Seiten.
Wird dem Vorbild nicht gerecht
Nur scheinbar bietet die "Auslese"-Trilogie die gleichen Attraktionen wie Suzanne Collins' "Hunger Games": Hier wie dort werden Jugendliche in einer dystopischen Gesellschaft in tödliche Survival-Kämpfe gezwungen. Allerdings machen die in den "Hunger Games" Sinn: Sie sind Teil eines Systems von Zuckerbrot und Peitsche, das mit einer gewaltigen Medieninszenierung die Massen unter Kontrolle hält, Aufsässige bestraft und Gehorsame von Problemen ablenkt. Charbonneaus heimlich durchgeführte Auslese kann diesen Zweck nicht erfüllen. Genausowenig aber kann sie ihrer nominellen Aufgabe gerecht werden – außer es ist das Ziel, eine psychisch vollkommen kaputte Funktionärsklasse heranzuzüchten.
Wenn Charbonneau ein Ausbildungssystem à la "Another Brick in the Wall" zeichnen wollte, dann hätte sie sich vielleicht ein paar Gedanken über Regeln und Zwänge machen sollen, die nicht nur für bedrückende Tagebucheintragungen Cias gut sind, sondern hinter denen tatsächlich auch eine gewisse Systemlogik erkennbar wird. An Plausibilität mangelt es hier aber gehörig, und am meisten beim Faktor Human Resources: Eine bevölkerungsmäßig stark ausgedünnte Gesellschaft, die jede verfügbare Arbeitskraft in den Wiederaufbau stecken muss, kann es sich eigentlich nicht leisten, so verschwenderisch mit talentiertem Nachwuchs umzugehen.
Wenn Cias wachsender Widerstand gegen das System der Plot-Motor der Trilogie sein soll, dann stottert der deshalb, weil das ganze System von vorneherein völlig unlogisch und willkürlich zusammengezimmert war. Da reicht es auch nicht, wenn nun in Form des Auslese-Leiters Dr. Barnes ein hauptverantwortlicher Schurke aufgebaut wird – bislang hat schließlich das gesamte politische System des Commonwealth brav das Unfugsspiel mitgespielt.
Auslese nicht bestanden
Wenn ich anfangs geschrieben habe, dass es für die Lektüre der "Auslese" maßgeblich ist, welcher Alterskohorte man angehört, dann stimmt das natürlich nur bedingt. Grundsätzlich kann jedes Thema mitreißend sein, wenn es nur gut umgesetzt ist – im eingangs beschriebenen "Liebe ist der Plan" hat James Tiptree Jr. ja vorgeführt, dass man sogar mit den Paarungsgelüsten einer Riesenspinne mitfiebern kann. Aber wer lässt sich von der leblosen Erzählstimme Cia Vales respektive Joelle Charbonneaus mitreißen? So geschwätzig sie ist, so blutleer bleibt sie leider auch. Nicht zuletzt drückt sich die Autorin vorwiegend in Gattungsnamen aus, statt endlich einmal anschaulich zu werden, und schafft es daher nicht, ihrer auf dem Reißbrett entworfenen Welt Leben einzuhauchen.
Konnte Charbonneau in Teil 1 noch mit Tempo und ein paar ausgesucht bösen Ideen über die völlig unplausible Prämisse und stilistisches Mittelmaß hinwegtäuschen, so erleidet sie nun endgültig Schiffbruch. Und es ist kein spektakulärer Untergang, sondern ein langsames, knirschendes Auflaufen auf eine Sandbank.
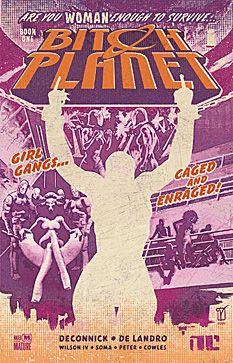
Kelly Sue DeConnick & Valentine De Landro: "Bitch Planet"
Graphic Novel, broschiert, 136 Seiten, Image Comics 2015
Nach der saft- und kraftlosen Dystopie von Joelle Charbonneau zum Ausgleich und Abschluss jetzt noch eine, bei der Blut, Schweiß und Sonstiges so fließen, dass man es auch riechen kann. Das perfekte Setting dafür: ein Frauenknast. Und zwar kein so harmloser wie im Katy-Karrenbauer-Vehikel von RTL, sondern the real stuff.
Die Ausgangslage
"Bitch Planet" greift die Tradition von glorios schundigen Exploitationfilmen aus den 60er und 70er Jahren auf. Genau die Weidegründe also, die auch ein Quentin Tarantino so gerne ironisch abgrast – auch wenn "Bitch Planet" aus seiner Feder sicher etwas anders geworden wäre als in der vorliegenden Form. Verantwortlich dafür: die US-amerikanische Comic-Autorin Kelly Sue DeConnick, die unter anderem für Marvel arbeitet und – wie viele ihrer Zunft – den größeren kreativen Spielraum, den der Verlag Image Comics bietet, nur allzu gerne nutzt.
Für "Bitch Planet" hat DeConnick eine dystopische patriarchalische Gesellschaft entworfen, die unliebsam gewordene Frauen auf den extraterrestrischen Auxiliary Compliance Outpost abschiebt; inoffizieller Name siehe Titel. Dort landen waschechte Mörderinnen ebenso wie Frauen, die sich einfach nur nicht fügsam genug geben ... sowie solche, deren Äußeres missfällt. Wie beispielsweise die kolossale Penny Rolle, eine der Sympathieträgerinnen der Reihe. Ihr massives Übergewicht ist ihr vollkommen wuppe – als man ihr Gehirn an eine Maschine anschließt und sie sich das Idealbild ihrer selbst vorstellen soll, sieht das Ergebnis zur Fassungslosigkeit der umstehenden Männer aus wie ihr Spiegelbild.
Großartige Bilder
In Schach gehalten werden die Inhaftierten von maskierten Wachen und den überlebensgroßen Avataren eines Wärterinnenhologramms, das so etwas wie die perverse Vollendung des gewünschten Erscheinungsbilds einer Frau ist: eine wespentaillierte Mischung aus Neko und strenger Schwester in Neonrosa. Gruselig-großartig der Gesichtsausdruck dieser holografischen Monstrosität, als sie die neueingelieferte Marian Collins aus der Reihe der Insassen herausbittet – Darth Vader sah nie unheimlicher aus.
Die Illustrationen von Valentine De Landro sind ebenso bunt wie schlicht gehalten: gängiger US-Comic-Stil mit Anklängen an die Optik früherer Epochen, aber mit viel Gespür für die richtige Inszenierung. Und trotz Reduktion sind sämtliche Protagonistinnen sehr individuell gezeichnet, was ja schließlich auch der springende Punkt an der ganzen Sache ist.
Besonders schön finde ich die Cover- und Rückseitengestaltung, in der die Trash-Ästhetik alter Kinoplakate Wiederauferstehung feiert ("Bold, Beautiful and ... Baaaaaad!"). Das gilt jetzt übrigens für die Heftausgaben, soweit ich sie bisher kenne. Der Sammelband ist nach einigen Verzögerungen leider erst jetzt erschienen und noch nicht bei mir daheim angekommen. Bislang konnte man sich bei Image Comics allerdings immer darauf verlassen, dass sie sämtliches vorhandene Bildmaterial wieder mit reinpacken.
Anhaltender Erfolg
Dieser Band fasst die ersten fünf Heftausgaben der vor knapp einem Jahr gestarteten Serie zusammen. Wir sind damit also noch mitten in der Exposition: Figuren werden mit ihrer Hintergrundgeschichte vorgestellt, Themen, die künftig eine große Rolle spielen werden, werden eingeführt: Etwa Megaton bzw. Duemila, ein brutales Sportspektakel zur Unterhaltung der Massen, das unwillkürlich an "Rollerball" denken lässt (abzüglich der Motorräder). Praktisch unvermeidlich, dass jemand auf die Idee kommt, zwecks "Rehabilitierung" ein Frauenknast-Team zusammenzustellen. Die armen Männer, die gegen die antreten werden müssen, tun mir jetzt schon leid ...
Und während bei der fortlaufenden Serie alle gespannt darauf warten, wann sich alles im absehbaren totalen Gewaltausbruch entlädt, kann man schon mal die Zwischenbilanz ziehen, dass Kelly Sue DeConnick es bislang tatsächlich geschafft hat, eine höchst prekäre Balance zu wahren. Immerhin ist "Bitch Planet" einerseits wirklich DeConnicks ganz persönliche Liebeserklärung an die (S)Exploitationfilme der 70er Jahre – und ein voyeuristischeres Genre kann man sich kaum vorstellen. "Bitch Planet" hingegen ist das nicht, trotz einer Menge nackter Haut (sogar auf die obligatorische Duschszene wird nicht vergessen!) und natürlich reichlich Gewalt. Stattdessen gab's für die Comic-Reihe sehr viel feministisches Lob. Glühende Fans sollen sich sogar schon Tattoos mit "Bitch Planet"-Zitaten stechen haben lassen. Na hoffentlich lassen die sich noch ein bissel freie Haut übrig – das nächste Heft und der nächste Sager Penny Rolles kommen bestimmt.
Ausblick
Die nächste Rundschau wird sicher um einiges kürzer als diese, sonst bringe ich vor Weihnachten keine zwei Stück mehr durch. Trotz geringeren Umfangs ließen sich darin theoretisch gleich vier(!) neue Titel von Stephen Baxter unterbringen. Das wäre dann allerdings doch ein bisschen viel, oder? (Josefson, 10.10.2015)