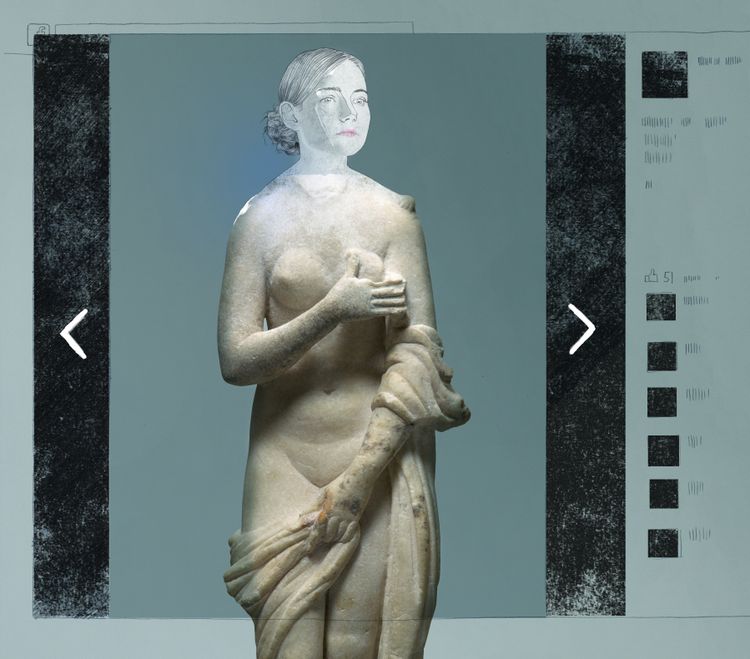"Heute bekam ich die Diagnose, dass ich ein Adenokarzinom habe. Stadium IV. D. h. inoperabel, nicht bestrahlbar. Es soll also eine Chemo gemacht werden. Ich habe dieses Forum gelesen, seit ich vor drei Wochen geröntgt wurde und eine scheußliche Aufnahme zu sehen bekam. Seitdem wurde ich durch die Mühle gedreht, PET/CT, Bronchoskopie, Biopsie mit Pneumothorax. Na und nun endlich!!! – die endgültige Diagnose. Der Witz ist, dass ich mich topfit fühle, wenn man von dem störenden Husten mal absieht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich demnächst meine Haare verliere und mich schlecht fühle oder sterben muss."
Mit diesem Eintrag beginnt "Mouse" am 21. November 2006 im Forum der Website "Krebs-Kompass.de", über ihren Lungenkrebs zu schreiben. Unter dem Titel "Adenokarzinom inoperabel" berichtet sie, ihr richtiger Vorname ist Christel, nach ihrem ersten Eintrag fast täglich über das Leben mit dem Tumor. Sie ist verheiratet, hat einen Sohn, wohnt irgendwo in Deutschland. Über ihre Identität erfährt man nicht viel mehr.
Diagnose als Initialzündung
Dafür gibt Mouse unzählige Details über die Gefühle preis, die sie seit Bekanntwerden ihrer Erkrankung empfindet. In ihrem Thread, so nennt man die chronologisch verfassten Beiträge in Internetforen, entwickelt sich ein reger Austausch zwischen ihr und anderen Betroffenen, Angehörigen und Hinterbliebenen von Erkrankten. Zigtausende Einträge kommen zusammen. Mouse und andere Betroffene wie "Ekaka", "MichaeleBS", "Erika E" berichten über Chemotherapien, Luftnot, Haarausfall.
Die Gespräche drehen sich aber auch um Urlaube und Witze, oft auch um den Tod. "Ich habe klargemacht", schreibt Mouse einmal, "dass ich auf eine Palliativstation möchte, das ist für mich erste Wahl. Hospiz ist zweite Wahl, zu Hause möchte ich nicht gepflegt werden. Mein Mann hat nur begrenzt Urlaub, Sohn und Schwiegertochter auch, und was mache ich, wenn die arbeiten müssen?"
Es gibt viele tragikomische Momente, so etwa als Mouse ihr Internetpublikum nach längerem Schweigen beruhigt und schreibt: "Bin noch am Leben, konnte mich nur nicht melden, weil mein Computer spinnt." Im Laufe der Zeit werden die tragischen Augenblicke mehr: "Wir laufen auf einer sich abwärtsdrehenden Spirale, im Moment habe ich das Gefühl, nicht mehr schnell genug laufen zu können. Es gibt absolut kein Entkommen. Das hat niemand verdient! Dieses Sterben auf Raten."
Eine Schicksalsgemeinschaft
Jährlich erkranken in Österreich fast 40.000, in Deutschland eine halbe Million Menschen erneut an Krebs. Allein in Österreich leben aktuell 350.000 Menschen mit einer Krebsdiagnose.
Die Krankheit und ihr Verlauf sind bei keinem Betroffenen gleich, ident ist nur, dass jeder durch eine Diagnose erst einmal aus der Bahn geworfen wird. Zwar ist Krebs besser behandelbar als früher – doch die ersten Assoziationen sind meistens trotzdem Schmerzen, Leid, begrenzte Lebenszeit. Eigene Ängste und die Sorge um Angehörige relativieren alles, was bis dahin zählte.
Ob gut behandelbarer Brustkrebs oder aggressiver Bauchspeicheldrüsentumor: Während die medizinische Maschinerie prompt startet, bleibt die psychologische Betreuung der überforderten Patienten oftmals völlig dem Eigenengagement überlassen.
Von Ärzten alleingelassen
Obwohl eine Krebsdiagnose ein traumatisches Ereignis darstellt, mit dem man kaum klarkommen kann, gibt es in dieser Situation so gut wie keine Krisenintervention. "Schaut nach Karzinom XY aus, wir müssen Gewebe entnehmen, dann sehen wir weiter": Für viele Patienten, die nicht privat versichert oder sonst wie prominent sind, besteht das erste ärztliche Aufklärungsgespräch oft aus nicht viel mehr Sätzen.
Während Debatten über fehlende medizinische Ausstattung oder überlastete Mediziner an der Tagesordnung sind, fehlen Diskussionen über die mangelnde psychosoziale Betreuung Krebskranker und ihrer Angehörigen. Auf einer onkologischen Station im AKH hängt auf dem Gang ein Poster, auf dem erklärt wird, dass eines der neueren Krebsmedikamente das mittlere Überleben bei bestimmten Tumoren von acht auf zehn Monate verlängert. So eine Information kann verstörend sein.
Wen wundert's also, dass Betroffene Unterstützung anderswo suchen und im Internet fündig werden. Auf "Krebs-Kompass.de" stehen mittlerweile 1,3 Millionen Beiträge, es gibt aktuell 63.000 Benutzer, sagt der Websitebetreiber. Dabei ist es längst nicht die einzige virtuelle Anlaufstelle. Auch auf den Seiten der Schweizer Krebsliga oder der Karzinomseite des deutschen Medizinforums gibt es ähnliche Anlaufstellen und abertausende User.
Gegenseitige Unterstützung
Was der Austausch bringt, lässt sich nachlesen. Betroffene teilen Erfahrungen und Ängste, tauschen sich über Behandlungsmöglichkeiten aus. Nicht selten wird auch über Medikamente und ihre Nebenwirkungen diskutiert. Oder es werden die Erfahrungen mit Spitälern und konkreten Ärzten kommuniziert. Wenn Threads wie der von Mouse gut funktionieren, lässt sich das Gefühl der gegenseitigen Unterstützung und Stärkung eindeutig herauslesen. Davon zeugen die vielen gegenseitigen Dankesbekundungen.
Auch Tod und Sterben sind keine Tabus. Der deutsche Theaterregisseur Christoph Schlingensief (1960–2010), bei dem im Jänner 2008 Lungenkrebs diagnostiziert worden war, gründete in einer ersten Reaktion ein Onlineforum unter dem Namen "Geschockte Patienten". Dort schrieb er einmal: "Der Tod ist unbequem, und Menschen, die den Tod thematisieren, machen sich unbequem, weil sie die Lebenden an ihre Sterblichkeit erinnern."
Schlingensiefs Website ist noch aus einem anderen Grund interessant. Während auf "Krebs-Kompass" alle Beiträge anonym verfasst werden können, forderte der deutsche Künstler auf seiner Seite die totale Offenheit ein. "Wann werden Sie Ihre Krankenakte veröffentlichen?", war die große Frage auf der Homepage von "Geschockte Patienten".
Krankenakten findet man auch heute nur selten online. Doch immerhin haben in den sozialen Netzwerken, also auf Twitter und Facebook, Krebserkrankungen Einzug gehalten. Hier wird nicht anonymisiert. Im vergangenen Jahr hat in Österreich die Geschichte des an Lungenkrebs erkrankten "News"-Journalisten Kurt Kuch auf Facebook breites Interesse geweckt.
Krebskranke Prominente
Kuch hatte im April 2014 unmittelbar nach der Diagnose begonnen, seinen Kampf gegen die Krankheit zu dokumentieren. Er postete auch Fotos. So veröffentlichte er auf Twitter Bilder, die ihn mit Gesichtsmaske bei der Gehirnbestrahlung zeigen. Auf Facebook stellte er Bilder aus dem Krankenzimmer, während ihm die Chemotherapie per Infusion in die Adern lief. Bis kurz vor seinem Tod am 3. Jänner 2015 war Kuch online. Er starb 42-jährig. Der letzte Eintrag auf seiner Facebook-Seite lautet: "Ich sage leise adieu ..." – mit dem Bild eines rosa Himmels.
Auch Personen des öffentlichen Lebens nutzen Social Media. Prominent etwa Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser, die ihre Krebserkrankung im Februar 2015 auf Facebook publik machte. Zuletzt durfte man lesen, dass sie ihre letzte Chemotherapie hinter sich hat. Der bekannteste Social-Media-Pionier in Österreich war der Grünen-Politiker Karl Öllinger. "Ich will euch meine Pause hier erklären – ich war jetzt über eine Woche im Krankenhaus. Diagnose Krebs", schrieb er im Februar 2014 auf Facebook. Was sind seine Erfahrungen – was dürfen sich Betroffene vom Facebook-Outing erwarten?
An einem lauwarmen Vorsommernachmittag sitzt Öllinger in einem Wiener Kaffeehaus und trinkt Eiskaffee. Nach Operation und viel Chemotherapie hat er einen Sieg errungen. Der 64-jährige Expolitiker ist nun auch Exkrebspatient. Seine Krankengeschichte öffentlich zu machen war nicht Folge einer tiefgründigen Überlegung, sagt er. "Aber ich wollte es bekanntgeben. Ansonsten wäre man einfach verschwunden."
Solidarität online
Im Gespräch mit Öllinger wird rasch klar, worin der Unterschied zwischen sozialen Netzwerken und Onlineforen besteht. Auf Twitter und Facebook stehen nicht Emotionen, Todesangst und die Traurigkeit im Vordergrund, vielmehr geht es meistens um eine eher sachliche Schilderung der Erkrankung.
Er selbst hat das so gemacht – nicht aus Angst vor Reaktionen. Öllinger erzählt, dass er fast ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten hat. Bekannte wie Fremde schickten Genesungswünsche und Kraftpakete. "Die Menschen wollen, dass man gesund wird, dass es einem gut geht", erinnert er sich. Für Todesängste und die eigene Hilflosigkeit sei aber seiner Erfahrung nach auf Social Media eher kein Platz. "Das wird nicht verstanden."
Diesen Eindruck bestätigen die Hunderten von Einträgen auf der Facebook-Seite des Journalisten Kurt Kuch oder die Reaktionen, die Ministerin Oberhauser in den vergangenen Monaten auf ihrer Facebook-Seite gesammelt hat.
Hier stehen weniger die Erkrankung, die Angst und die Schmerzen im Vordergrund als eher der "Kampf" gegen den Feind Krebs. Kuch nutzte die Plattform, um die Antiraucherkampagne "Don't Smoke" zu befeuern, damit zettelte er die Debatte über einen effektiven Nichtraucherschutz in Lokalen neu an.
Was verschwiegen wird
Über seine innersten Gefühle und schwierige Phasen schwieg Kuch. So wie auch Öllinger. "In den wahnsinnigen Phasen meiner Erkrankung bin ich zu Hause gelegen und konnte mich nicht rühren", kann er retrospektiv erzählen. Als es ihm im ersten Halbjahr 2014 so richtig "erbärmlich" ging und er nicht nur die Chemotherapie und einen vorübergehenden künstlichen Darmausgang verkraften, sondern auch noch am Meniskus operiert werden musste, schrieb er auf Facebook keine Einträge darüber.
Trotzdem. "Social Media war persönlich hilfreich", sagt Öllinger, "man hat das Gefühl, es ist den Menschen ein Anliegen, wie es einem geht. Auch wenn man weiß, es ist vielleicht nur ein Klick: Es ist ein angenehmes Gefühl", sagt er.
Doch gibt es vielleicht versteckte Risiken, die Betroffene nur mangels ihrer Erfahrung nicht erkennen? Es ist Zeit herauszufinden, was Experten wie Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe, über die Veröffentlichung von Krankengeschichten in Internetforen oder auf Facebook denken.
Was Profis empfehlen
"Die Zeit der Ärzte, sich mit Krebspatienten auseinanderzusetzen, wird immer kürzer", weiß sie aus Erfahrung mit vielen Patienten und Angehörigen. Deshalb habe sie großes Verständnis dafür, dass sich Menschen online über ihre Krebserkrankungen austauschen möchten.
Wovor sie warnt: die eigene Diagnose im Internet einfach wild zu googeln. "Richtige Antworten für die eigene Krankengeschichte findet man dort sowieso nie, Patienten haben dann meist nur noch viel mehr unbeantwortete Fragen im Kopf oder müssen mit Horrorszenarien zurande kommen." Das Positive an Foren wie Facebook und Twitter sei jedoch, dass Menschen sich aussprechen können. Zuspruch, weiß sie, wirkt für Betroffene "sehr motivierend".
Schwieriger hingegen wird es, wenn Kranke spüren, dass "sich das nicht mehr ausgehen wird", wie Kiefhaber es formuliert. Viele Betroffene wüssten, wie lange ihre Kraft noch reicht, sagt sie. Wenn man Durchhalteparolen wie "Du schaffst es" liest, aber schon spürt, dass diese "große Müdigkeit" eingesetzt hat, könne das belastend wirken.
Nicht für alle ein Weg
Und noch etwas ist Kiefhaber als Ratschlag für alle, die sich in Foren tummeln, wichtig: Selbsthilfegruppen, die von der Krebshilfe angeboten werden, sind moderiert. Diese Gesprächsbegleitung verhindert, dass persönliche Erfahrungen Einzelner in Diskussionen zu dominant werden und sich auf diese Weise "role models" entwickeln. "Denn was dem einen im Umgang und der Bewältigung mit der Erkrankung guttut, können andere durchaus als belastend empfinden", so Kiefhaber.
Im Web fehlt so eine Moderatorenfunktion. Tatsächlich finden zum Beispiel auch auf den Seiten von "Krebs-Kompass" anstrengende Diskussionen statt, etwa dann, wenn in einem gutbesuchten Thread die Diagnose eines Forenbesuchers von anderen angezweifelt wird.
Andererseits finden sich dort aber auch wieder Momente beeindruckender menschlicher Nähe. Mouse stirbt am 15. April 2013. Auf einer Gedenkseite verabschieden sich dutzende Menschen.
Den letzten Eintrag verfasst ihr Ehemann: "Eigentlich wollte ich hier nicht mehr schreiben, aber es haben so viele ihre Anteilnahme aufgeschrieben, dass ich mich bedanken möchte. Es ist schon erstaunlich, wie gut ihr Christel gekannt habt, obwohl nur einige sie tatsächlich getroffen haben. Diejenigen kennen dann auch ihr Lachen. Vielen Dank." (András Szigetvari, Cure, 25.8.2015)