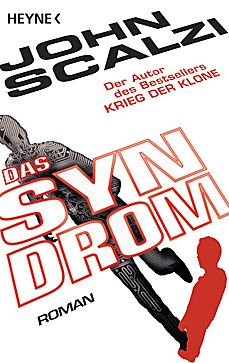
John Scalzi: "Das Syndrom"
Broschiert, 396 Seiten, € 10,30, Heyne 2015 (Original: "Lock In", 2014)
Im Mai sorgte SF-Autor John Scalzi auch außerhalb des Genres für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass er mit seinem Verlag Tor Books einen Vertrag über 3,4 Millionen Dollar abgeschlossen hatte. Das klang zunächst eher nach einem Fußballtransfer als nach einer Meldung aus dem literarischen Nischenmarkt Science Fiction – und für den ist es wirklich ein ungewöhnlich guter Deal. Aber Scalzi muss dafür auch 13 Bücher innerhalb der nächsten zehn Jahre abliefern.
Nicht dass es dem Kalifornier an Produktivität mangeln würde. Seit es ihm sein Romanerstling "Old Man's War" ("Krieg der Klone") ermöglicht hat, von der Schriftstellerei zu leben, hat Scalzi einerseits an der "Klone"-Reihe weitergeschrieben – vor kurzem erst ist mit "The End of All Things" ein weiterer Band herausgekommen. Und andererseits tendenziell humoristische Einzelromane eingestreut, in denen er auch gerne Themen aus früheren Epochen der SF-Geschichte aufgriff ("Der wilde Planet" oder das preisgekrönte "Redshirts"). Scalzi hat ein Faible für Genrehistorie.
Die Ausgangslage
Der aktuelle Roman "Das Syndrom", ein SF-Krimi aus der nahen Zukunft, enthält zwar an einigen Stellen Situationskomik, die man nicht unterschätzen sollte: Da schlagen etwa zwei Androiden in einem wahren Hightech-Duell mit Töpfen und Bratpfannen aufeinander ein. Oder Demonstranten, die sich als George Washington & Co maskiert haben, geben in einer Gefängniszelle ein recht klägliches Gruppenbild der amerikanischen Gründerväter ab. Aber humoristisch ist "Das Syndrom" nicht gemeint, es ist bloß in lockerem Ton gehalten.
Die Prämisse wird in einem ausführlichen Infodump-Vorwort abgehandelt (das im Grunde unnötig ist, weil sämtliche Fakten später ohnehin noch mal im Text auftauchen werden). In aller Kürze: Ein Virus ist um die Welt gezogen, hat ein paar hundert Millionen Menschen getötet und bei einem Teil der Überlebenden das sogenannte Lock-In-Syndrom bewirkt. Die Hadens, benannt nach einem prominenten Opfer der Epidemie, sind Gefangene ihres Körpers – bei Bewusstsein, aber nicht in der Lage, ihren Körper willentlich zu steuern.
Threep macht mobil
Zum Glück konnte die Technologie Abhilfe verschaffen. Ein implantiertes neuronales Netz ermöglicht den Hadens, einen Androidenkörper fernzusteuern: Threep genannt, wieder mal eine kleine Verbeugung vor der Genregeschichte, in dem Fall vor C-3PO aus "Star Wars". Wer es sich leisten kann, könnte als Alternative auch die Dienste eines der wenigen menschlichen Integratoren in Anspruch nehmen, die ein fremdes Bewusstsein in ihrem aufnehmen können, um gewissermaßen ihren Körper für einige Zeit auszuleihen. (Gab es im Cyberpunk nicht etwas in der Art, das "Reiter" hieß oder so?)
Die technische Infrastruktur ist also ausgebaut genug, dass sich nun, zwanzig Jahre nach Beginn der Epidemie, Stimmen in der Politik durchgesetzt haben, die sich dafür aussprechen, die bevorzugte Behandlung der Hadens wieder zu beenden und staatliche Unterstützungen zusammenzustreichen. Scalzi lässt seinen Roman also da beginnen, wo bei anderen längst der Abspann nach technologischer Lösung und Happy End durchgezogen wäre. Was gleichzeitig das eigentlich Neue an "Das Syndrom" ist, dessen Szenario ja durchaus bekannt ist. Eine seiner jüngsten Ausformungen war der doofe Film "Surrogates", dessen klaffende Logiklücken bei Scalzi aber zum Glück keine Entsprechung haben.
Die Hauptfigur
Erzählt wird "Das Syndrom" aus der Ich-Perspektive von Chris Shane, einem Haden aus einer prominenten Washingtoner Familie, der gerade seinen ersten Arbeitstag beim FBI antritt. Und gleich an einen Mordschauplatz gerufen wird. Das Opfer: ein völlig unbeschriebenes Blatt, das sich noch als geistig behinderter Mann aus der unabhängigen Navajo-Nation entpuppen wird. Der blutbeschmierte Verdächtige: ein Integrator, der beteuert, dass er die Tat nicht begangen habe. Für Chris und seine Partnerin, die trinkfeste und leicht abgelebte Leslie Vann, stellt sich damit zunächst einmal die Frage, wer den Körper des Integrators für einen Mord missbraucht haben könnte.
Bald ziehen die Ermittlungen immer weitere Kreise, wie es bei einem Wirtschaftskrimi eben so ist. Chris wird bald Menschen verdächtigen, die zum unmittelbaren Bekanntenkreis seines prominenten Vaters zählen. Und rundherum eskalieren die Ereignisse: Eine Firma, die an einem Medikament arbeitet, mit dem man Hadens aus dem Lock-In zurückholen könnte, fliegt in die Luft. Eine Haden-Separatistin ruft zum Massenprotest gegen die Subventionskürzungen auf. Und Chris und Leslie werden mehrfach zum Ziel von Attentaten. Was nebenbei zum Running Gag führt, dass der arme Chris ungewollt einen Threep nach dem anderen schrottet.
"Das Syndrom" ist also eine klassische Cop-Story um einen Rookie und dessen raubeinigen Seniorpartner (hier eben eine Frau), deren Ermittlungen sie in die vermeintlich besseren Kreise der Gesellschaft führen; inklusive all der Raffgier und Skrupellosigkeit, die man dort halt so findet.
Auf einfache Weise gut
In Sachen SF-Elemente macht Scalzi es ganz im Sinne der von ihm geliebten Golden-Age-SF auch genrefremden LeserInnen leicht. Bezeichnend etwa eine Passage, in der er auf die Agora, einen für Hadens reservierten virtuellen Tummelplatz, eingeht: Es ist unmöglich, unsere großen Treffpunkte zu beschreiben, unsere Debatten und Spiele, oder wie wir miteinander intim werden, ob sexuell oder auf andere Weise, ohne dass es merkwürdig oder gar abstoßend klingt. Es geht um das ultimative "Man muss da gewesen sein". Das ist natürlich ein eleganter Weg, Beschreibungen aus dem Weg zu gehen, die sowohl beim Lesen als auch beim Verfassen zur Herausforderung werden könnten. Auch ins menschliche Gehirn, dessen neurologische Prozesse und Funktionen aufgrund der Romanprämisse natürlich ein großes Thema sind, dringt Scalzi nur sehr oberflächlich ein – erst recht wenn man als Vergleich den neuen Roman von Peter Watts heranzieht, dessen Besprechung hier ein paar Klicks weiter zu lesen ist.
Scalzi hält seinen Roman schlicht – auch sprachlich. Ganz ehrlich, das ständige ich sagte – sie sagte – ich sagte hätte ruhig etwas originelleren Formulierungen Platz machen können. Davon abgesehen ist diese Schlichtheit aber nicht unangenehm. Die unauffällige Sprache treibt die Handlung voran, und letztlich lebt ein Krimi ja von seiner Spannung. "Das Syndrom" gehört zu den wenigen Büchern in letzter Zeit, die ich in einem Rutsch durchgelesen habe.
Konventionell, leicht erzählt und leicht verständlich, flüssig und spannend. Kurz gesagt: "Das Syndrom" ist der Stoff, aus dem Bestseller gemacht sind. Hält Scalzi das beim nächsten Dutzend Romane durch, wird er keine Probleme haben, seinen Vertrag zu erfüllen.
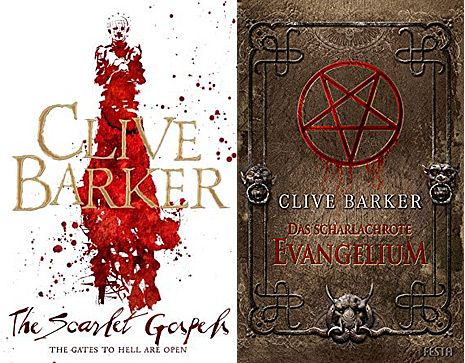
Clive Barker: "Das scharlachrote Evangelium"
Broschiert, 464 Seiten, € 13,95, Festa 2015 (Original: "The Scarlet Gospels", 2015)
Barker's back! Und zwar to the roots. Worauf Fans des britischen Kultautors nun schon seit über einem Jahrzehnt hoffen, wird mit dem "Scharlachroten Evangelium" endlich wahr: Clive Barker reaktiviert zwei der populärsten Figuren aus seinen frühen Jahren als Horrorautor und lässt sie blutig aufeinanderprallen: Privatdetektiv Harry d'Amour und den Zenobiten – also wirklich den Zenobiten – Pinhead. Den man natürlich auf gar keinen Fall in seiner Gegenwart so nennen sollte ...
Eine Vorabbemerkung noch: Diese Rezension richtet sich nach der Originalfassung des Buchs, genauer gesagt nach der Paperback-Ausgabe (siehe oben links). Auf die hatte ich extra gewartet, weil mir das rot-weiße Cover mit Pinhead deutlich besser gefällt als das der gebundenen Version, die schon im Mai herauskam. Und ein Buch mit schönem Cover lese ich einfach lieber. Zeitgleich mit dem Erscheinen der schon lange vorbestellten Paperback-Ausgabe hätte sich dann allerdings noch eine dritte Möglichkeit aufgetan: Die deutschsprachige Version, lobenswert früh erschienen im Festa Verlag. Wer mit dem Englischen hadert, greife also hier zu! Selbst wenn ihm dann ein so poetischer Satzausklang entgeht wie: "There's enough in that story to make me think you might be a decent human being under all those layers of lawyer and liar."
Die genagelte Ikone und der illustrierte Mann
Beste Pointe des insgesamt bemerkenswert humorvollen Romans: "You're a magnificent cliché", sagt Pinhead zu Harry d'Amour – ausgerechnet Pinhead, die in unzähligen Filmen und Comics verbratene Horror-Ikone, die abgesehen von ihrem Nagelkopf schon so vielfältig und widersprüchlich dargestellt worden ist, dass man längst nicht mehr sagen kann, was kanonisch ist und was nicht. Barker nennt den Zenobiten nun übrigens explizit einen Dämon und schreibt ihm den Rang eines Höllenpriesters zu.
Im Prolog des Romans vollendet Pinhead gerade sein mehrjähriges Werk, sämtliche Magier der Welt abzuschlachten und ihr Wissen in sich aufzusaugen: Ein äußerst blutiges Spektakel, in dem wieder die metaphysischen Ketten fliegen und zerreißen, ausweiden und verstümmeln, was ihnen unter die Haken kommt. Als nächste müssen Pinheads Ordensschwestern und -brüder (inklusive Butterball!) dran glauben, und nach dem magischen Massaker in Zenobitenhausen arbeitet sich Pinhead Station für Station, Special Effect für Special Effect durch die Hölle voran. Das letzte Ziel auf seinem angestrebten Weg zur Göttlichkeit soll kein geringeres als Luzifer selbst sein.
Harry d'Amour, der knarzige Privatdetektiv mit Ganzkörpertätowierung und Gespür für übersinnliche Umtriebe, wurde von Pinhead – warum auch immer – dazu ausersehen, seinen Aufstieg zu bezeugen und sein "Evangelium" zu verkünden. Nichts könnte Harry mehr am Arsch vorbeigehen. Doch Pinhead entführt als Druckmittel eine alte Freundin Harrys, das blinde Medium Norma Paine. Und so bleibt dem Dämonenjäger nichts anderes übrig, als sich auf die Spur des Zenobiten zu setzen. Harry durchschreitet zusammen mit seinen Mitstreitern Caz, Lana und Dale das Portal zur Hölle. Was folgt, ist – im Gegensatz zur beklemmenden Stimmung des Prologs – weniger von Horror als von Action und vielen Ah!s und Oh!s geprägt.
Bezüglich "oberflächlich" und "entmystifiziert"
"Das scharlachrote Evangelium" scheint die Barker-Fans zu spalten. Von denen, die es nicht so mochten, monieren die einen, dass es dem Roman an Tiefgründigkeit fehle; andere stoßen sich an den Sex-Witzeleien der Hauptfiguren. Aber vielleicht hängt beides ja sogar zusammen: Barkers Markenzeichen war stets eine extreme Körperlichkeit, die Verbindung von Sex und Gewalt. Wobei der Sex in seinen frühen Werken noch viel stärker verklausuliert war, was die Handlung seiner Erzählungen stets wie die Spitze eines gewaltigen dunklen Eisbergs wirken ließ. Inzwischen schreibt Barker mit der Schamlosigkeit des Alters – Subebenen und versteckte Bedeutungen braucht er kaum noch.
Ein Wort, das man in Besprechungen des Buchs besonders oft liest, ist "Entmystifizierung". Und das hat tatsächlich was für sich. Immerhin wird Pinhead hier als Wesen mit Ambitionen dargestellt, wodurch er automatisch weniger souverän wirkt als bei seinen historischen Auftritten als Gestalt gewordene Gleichgültigkeit. Hauptsächlich – und das gilt für Pinhead genauso wie für die hier sehr ausführlich beschriebene Hölle – ist es aber eine ganz simple Folge der Informationsmenge: Je mehr man von jemand oder etwas erfährt, desto mehr büßt er/es zwangsläufig von seinem geheimnisvollen Nimbus ein. Entmystifizierung also: ja.
Von Horror zu Fantasy
Bei einem solchen Autor kommt man gar nicht darum herum, persönlich zu werden – immerhin war Clive Barker ein Held meiner Jugend. Die "Bücher des Blutes" hatte ich verschlungen, denn es gab damals nichts Vergleichbares. Die Begeisterung übertrug sich auch auf die darauf folgenden Romane "Spiel des Verderbens", "Gyre", "Cabal" und "Jenseits des Bösen". Zum Knackpunkt wurde "Imagica". Das gilt heute als einer seiner besten Romane und ist es vielleicht auch. Aber es war Fantasy, und das hab ich damals nicht gebraucht – erst recht nicht von jemandem, der doch so fantastische Horrorerzählungen geschrieben hatte.
Ich kann mich rühmen, dass ich in meinem Freundeskreis der einzige bin, der den Soundwechsel der Cardigans von Easy Listening zu Rock problemlos mitgemacht hat und beide Gesichter der Band gleich gern mag. Bei Barker, der sich selbst eher als Fantasy-Autor sieht, ist mir der Umstieg leider nicht gelungen. Spätere Wiedereinstiegsversuche haben es nur bestätigt. "Der Dieb der Zeit": nett. "Abarat": hat mich einfach nicht gepackt. Schade.
... und Fantasy bleibt es
Aber die Zeit heilt offenbar alle Wunden (solange sie nicht von Pinhead geschlagen werden). Denn auch "Das scharlachrote Evangelium", das mir unterm Strich sehr gut gefallen hat, ist – trotz höllischer Ausstattung und entsprechenden Personals – ganz klar ein Fantasy-Roman. Das beginnt schon bei der Struktur der Handlung: eine klassische Queste, mit der der Triumph des Bösen verhindert werden soll.
Diese Queste führt durch ein Wunderland namens Hölle, das mindestens so elaboriert ausgestaltet ist wie die Welt eines High-Fantasy-Wälzers, es sieht nur etwas ... anders aus: Wie ein beklatschenswert fantasievoller Themenpark aus zu gleichen Anteilen Hieronymus Bosch, Enki Bilal und dem, was Barker selbst "abscheuerregenden Glamour" nennt. Und sie ist auf ihre Weise ein erstaunlich weltlicher Ort, an dem man wohnt, isst, arbeitet, schläft, Sex hat und sogar sterben kann (was danach kommt, bleibt allerdings offen).
Durch dieses Wunderland reisen Harry und seine Scooby Gang nun wie Touristen und speziell Harry zeigt sich vom Gebotenen mäßig beeindruckt. Womit er einen flapsigen Ton vorgibt, wie er – dare I say "Buffy"? – für Urban Fantasy typisch ist. Siehe etwa einen Dialog Normas mit einem Mann, der nicht glauben will, dass sie den Geist seines toten Bruders sieht: "You're telling me you can see my brother? Right now?" Norma turned back and stared into the office. "Yes, he's lying on your couch." "What's he doing?" "You really want to know?" "I asked you, didn't I?" "He's masturbating." "Jesus. It's him."
Empfehlung!
Das Tor zu neuen Höllen wird mit dem "Scharlachroten Evangelium" nicht aufgestoßen. Dieses Buch will einen nicht in Schrecken versetzen, wie es die Definition eines Horror-Romans wäre. Es nimmt einen auf eine Reise mit. Und ich bin ihm gerne gefolgt. Yep, Barker's back, zumindest soweit es mich betrifft. Vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, "Imagica" eine zweite Chance zu geben und es diesmal zu Ende zu lesen.
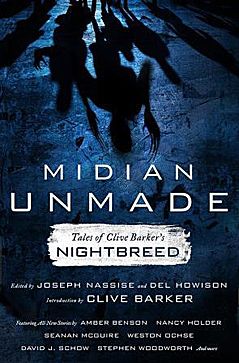
Joseph Nassise & Del Howison: "Midian Unmade: Tales of Clive Barker's Nightbreed"
Gebundene Ausgabe, 304 Seiten, Tor Books 2015
Und noch ein Clive-Barker-Klassiker kehrt aus dem Reich der (Un-)Toten zurück. Das 1988 veröffentlichte "Cabal" wurde spätestens durch die zwei Jahre später erfolgte Verfilmung "Nightbreed" zum identitätsstiftenden Klassiker für alle, die irgendeiner Form von Subkultur, Minderheit oder Underground angehörten. "Cabal" war die Geschichte einer Gemeinschaft nichtmenschlicher bzw. übernatürlicher Wesen, die unter einer Nekropole im Westen Kanadas eine Zufluchtsstätte fanden – bis ein Lynchmob von Menschen dieses Midian genannte Asyl zerstörte und die Nachtbrut sich in alle Himmelsrichtungen zerstreute.
Die Anthologie "Midian Unmade" ist kein direktes Sequel, schildert aber in 23 kurzen Erzählungen von 24 AutorInnen, was danach geschah. Es sind Geschichten aus der Diaspora der Nachtbrut – mal melancholisch, mal erschreckend, ebenso brutal wie poetisch und oft mit überraschenden Twists versehen. Es gibt ein paar Redundanzen und auch inhaltliche Widersprüche, insgesamt wird die Sammlung dem Geist Barkers aber erstaunlich gut gerecht. Und sie ist ironischerweise auch das, was Barkers eigenes Werk "Das scharlachrote Evangelium" (siehe die vorherige Seite) nicht mehr ist: Horror.
Nach Midians Fall
Einige AutorInnen setzen unmittelbar nach den Geschehnissen von "Cabal" an. Paul J. Salamoff etwa lässt in "Tamara" einen Gestaltwandler die Form eines der Lynchmörder annehmen, die beim Angriff auf Midian getötet wurden. In neuer Gestalt versucht er sich in dessen Familie einzufügen – gedacht als verquere Form der Sühne, was natürlich nicht so laufen wird wie erhofft.
Erfolgsautorin Seanan McGuire alias Mira Grant ("Feed") wiederum gehört zu den wenigen hier, die eine Figur aus "Cabal" aufgreifen, statt eine eigene zu erfinden. In ihrem Beitrag "The Moon Inside" ist es das Monstermädchen Babette, das mittlerweile zur Teenagerin geworden ist und im Exil von Seattle mäßig amüsiert reagiert, als sie auf stinknormale Jugendliche trifft, die selbst gerne Monster wären. McGuire holt zudem in einem eleganten Zeitsprung die Nachtbrut ins Internetzeitalter. Ich habe "Cabal" im Vorfeld noch einmal gelesen, und es enthält tatsächlich nichts, was die Geschichte in einem bestimmten Jahrzehnt verorten würde.
Von Menschen und anderen Monstern
McGuire bzw. Babette illustriert aber auch sehr schön einen essenziellen Zug von Barkers Originalwerk: Barker kehrte zwar die Rolle von Mensch und Monster um. Das soll aber nicht heißen, dass die Angehörigen der Nachtbrut was zum Kuscheln wären. Sie ticken anders (Nancy Holder bringt dies in "Another Little Piece of My Heart" sehr schön auf den Punkt) – und sie haben bei aller Sympathie ihre Schattenseiten, sind brutal und fressen gerne mal Menschen. Der zentrale Punkt jedoch: Sie sind, was sie sind, und werden sich dafür niemals entschuldigen. "When a monster is a monster he's being true to his nature. When a human is a monster it's far worse", heißt es an einer Stelle.
Hier sei auch Amber Benson genannt – jawoll, die Tara aus "Buffy"! In ihrer Erzählung "Pride" belauert ein Nachtbrut-Mädchen ein Quartett männlicher Serienkiller. Das könnte auf eine typische weibliche Rachefantasie hinauslaufen (was ein Genre für sich wäre). Stattdessen glaubt Hauptfigur Abra zunächst, in den Killern endlich Gleichgesinnte gefunden zu haben: eine Volte, die ganz in Barkers Sinn wäre.
Wie gelungen die Chiffre von der Nachtbrut ist, zeigt sich nicht zuletzt auch darin, wie leicht unterschiedliche AutorInnen sie auf ihr Leben beziehen können. Brian Craddock ist ein australischer Autor und Puppenspieler und schrieb eine Geschichte über einen nichtmenschlichen Puppenspieler in Australien. Und US-Kriegsveteran Weston Ochse lieferte eine Story über Soldaten in Afghanistan, die ein lokales Monster als Verbündeten gewinnen wollen. Ochses "The Devil Until the Credits Roll" beschreibt, wie der Krieg das Monster wecken kann, das seit jeher im Menschen steckt, und gehört zu den besten Erzählungen dieses Bands.
Angst und Trost
Den Preis für die originellsten Nichtmenschen gewinnt C. Robert Cargill für UHF (einen Mann mit einem Fernseher als Kopf) und FM Girl (eine Frau, deren Stimme nur über ein Radio gehört werden kann) – mit Vampiren, Werwölfen und anderen Konfektionsmonstern im Industrie-Standardformat ist hier nix. Und Stephen Woodworth & Kelly Dunn beschreiben in "A Monster Among Monsters" ein ungeheuerliches Wesen, vor dem sogar Ungeheuer Angst haben.
Viele Geschichten hier sind angsty, aber es gibt auch eine ganze Reihe Erzählungen voller Trost und Hoffnung. Die kann ein Nachtbrutmitglied allein, nämlich im Bewusstsein der eigenen Sinnhaftigkeit finden wie in Kevin J. Wetmores "The Night Ray Bradbury Died" (bester Titel!). Aber auch darin, langsam Vertrauen zu Menschen aufzubauen. Wie es ein Monster und autistischer Bub in Ernie W. Coopers "Button, Button" tun. Oder auch wie die kleine Nachtbrut-Gemeinschaft in Christopher Monfettes "The Farmhouse", das "Midian Unmade" auf einer positiven Note enden lässt.
Wo ist Cabal?
Am Ende von Monfettes Erzählung wird auch auf Cabal bzw. Boone Bezug genommen: den Mann, der sich in Barkers Roman der Nachtbrut anschloss, ungewollt den Untergang Midians einleitete und dem zuletzt die Mission zuteil wurde, die Nachtbrut an einem neuen Ort wieder zusammenzuführen. In "Midian Unmade" wird noch deutlicher, wie sehr die Nachtbrut der Gemeinschaft der Urchristen ähnelt: Sie glauben (manche mehr, manche weniger), dass die prophezeite Erlösung noch zu ihren Lebzeiten kommen wird. Ihr von Gott Baphomet bestimmter Erlöser Boone, den einige noch persönlich kannten, ist noch nicht ganz zum Mythos geworden. Aber erste Apostaten zeigen sich auch bereits.
Letzteres führt Durand Sheng Welsh in "The Jesuit's Mask" aus, einem weiteren grimmigen Highlight des Bands. Niemand Geringeres als Boones Sohn wird hier nach Australien geschickt, um eine häretische Nachtbrut-Gemeinschaft auf Linie zu bringen. Was sich einerseits mit Shaun Meeks' "And Midian Whispered Its Name" beißt (ohne dass ich spoilern dürfte, warum), in dem der soziopathische Psychiater Decker wiederaufersteht(!), andererseits aber einmal mehr für eine böse, blutige Überraschung sorgen wird. Und was die Inkongruenzen anbelangt: Welches Evangelium ist schon frei von Widersprüchen?
Blendet man die Vielzahl an Subebenen aus, war "Cabal" eigentlich vor allem die Liebesgeschichte von Boone und Lori. Beide haben in diesem Band leider keinen direkten Auftritt – entweder wollten oder durften die AutorInnen hier Barkers Hauptfiguren nicht übernehmen. Insofern kann man "Midian Unmade" nicht als Sequel bezeichnen. Aber es macht verdammt viel Appetit auf eines. Mister Barker, übernehmen Sie!
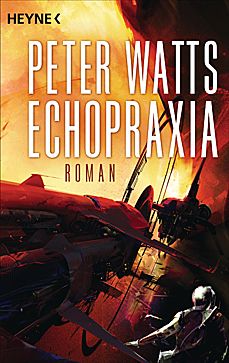
Peter Watts: "Echopraxia"
Broschiert, 559 Seiten, € 10,30, Heyne 2015 (Original: "Echopraxia", 2014)
Das ist wieder so ein Buch, das man ewig vor sich her schiebt, weil man schon vorab weiß: Es wird hervorragend – aber mögen wird man's nicht. Zu kalt und unmenschlich ist Peter Watts' biologistische Sicht auf die Welt (siehe die "Rifters"-Trilogie), die er auch hier wieder betont, wenn er über die Farce vom freien Willen schreibt. SF-Rezensent James Nicoll, der einmal meinte, dass er Watts immer dann lese, wenn sein Lebenswille zu stark werde, hat es mit seinem Zitat nicht umsonst in die Wikipedia geschafft; es fasst den Effekt von Watts' Romanen einfach perfekt zusammen. Aber natürlich ist auch Watts' jüngstes Werk wieder brillant.
"Echopraxia" ist ein Sequel zum Erfolgsroman "Blindsight" ("BIindflug") von 2006 ... gewissermaßen jedenfalls. Zeitlich ist es nämlich zwischen den Ereignissen im Hauptteil von "Blindflug" und dem, was sich an dessen Schluss aus der Ferne andeutete, angesiedelt. Und wir haben es mit anderen ProtagonistInnen zu tun – von denen einer allerdings einen sehr persönlichen Bezug zur Hauptfigur von "Blindflug" hat, wie sich noch zeigen wird.
Simplexe in der Sackgasse
Zur Erinnerung bzw. für Neuhinzugekommene als Orientierungshilfe: Wir befinden uns am Ende des 21. Jahrhunderts. Auf der Erde wimmelt es mittlerweile dank fortgeschrittener Technologie von Post-, Trans- oder schlicht Nonhumanen diverser Art. KIs, Schwarmintelligenzen, "Zombies" ohne eigenes Bewusstsein und nicht zu vergessen die "Vampire": Eigentlich ein im Pleistozän ausgestorbener raubtierhafter Seitenzweig der menschlichen Evolution, den man wegen seiner überragenden geistigen Fähigkeiten rückgezüchtet hat. Zum Preis, dass man nun hyperintelligente Soziopathen in Schach halten muss, die kein dem Menschen vergleichbares Bewusstsein haben. Intelligenz ohne Ich-Bewusstsein war eines der großen Themen von "Blindflug".
"Echopraxia" geht auf eine weitere Variante der künstlichen Evolution ein. Der Bikamerale Orden hat durch Genmanipulation die Fähigkeit der Mustererkennung und den Einblick in für Menschen verborgene Zusammenhänge so weit getrieben, dass die Grenzen zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und göttlicher Eingebung verschwimmen. Die klassische Wissenschaft tauge dazu, Alltagsphänomene zu beschreiben – darüber- und darunterhinaus könne sie jedoch nicht mehr blicken. Wir sind auf einem lokalen Maximum gefangen, heißt es zu Beginn des Romans: Ein schönes Bild für den ungemütlichen Umstand, dass die Menschheit auf ihrem bisherigen Weg alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat und in einer Sackgasse gelandet ist. Neue Wege müssen beschritten werden – aber es ist zu befürchten, dass die Simplexe, wie herkömmliche Menschen im Roman genannt werden, dabei auf der Strecke bleiben werden.
Zur Handlung
Daniel Brüks, Hauptfigur des Romans, ist ein solcher Simplex: ein Parasitologe, der im verwüsteten Oregon Tiere einfängt und seziert, um zu dokumentieren, wie sehr sich manipulierte DNA über die gesamte Biosphäre ausgebreitet hat. Seine schaurig-beschauliche Arbeit schlägt bald in eines der ersten Action-Highlights des Romans um: den Angriff von Zombies auf ein Hightech-Kloster, das einen künstlichen Tornado gegen sie ins Feld führt. Von nun an ist Daniel Gast der Bikameralen, und sie nehmen ihn sogar auf eine Weltraummission mit. Auf Ikarus, einer Station im Sonnenorbit, die die Erde mit Energie versorgt, ist nämlich eine Sendung aus dem äußeren Sonnensystem eingegangen. Also von dort, wo "Blindflug" spielte – da sollte man doch besser nachsehen.
Es folgt eine Studie in Paranoia, die sich gewaschen hat. Daniel, der selbst einige Geheimnisse verbirgt (er hat ein paar tausend Menschenleben auf dem Gewissen, nanu?) ist fast der einzige Simplex an Bord des Raumschiffs Dornenkrone. Da gibt es noch den nur leicht augmentierten Soldaten Jim und die schon stärker geistig modifizierte Lianna, deren Gottgläubigkeit Dan mindestens so sehr frustriert wie ihre Bewunderung für die Bikameralen. Vor allem aber ist da einerseits das fremdartige Kollektiv der Bikameralen selbst – und andererseits die furchterregende Vampirin Valerie, bei der niemand so recht einschätzen kann, warum sie sich der Mission angeschlossen hat. Zwischen all diesen Über- und Nichtmenschen bleibt einem Simplex nur mehr eines übrig: (...) dass Daniel Brüks sich auf dem Deck zusammenkauerte wie eine Maus, die sich in einem Glasterrarium voller Kobras in den hintersten Winkel drückte, das Licht so weit aufgedreht wie nur irgend möglich.
Und was sie draußen im All finden werden, ist natürlich noch schlimmer.
Die Summe der Teile
"Echopraxia" kann auch ohne vorherige Lektüre von "Blindflug" gelesen werden. Wie schon "Blindsight" (das wörtlich eigentlich mit dem wenig SF-ischen Titel "Rindenblindheit" übersetzt werden müsste) handelt es sich um einen Begriff aus der Gehirnforschung. Watts, selbst ein Meeresbiologe mit Doktortitel, legt größten Wert auf das wissenschaftliche Fundament seiner Bücher; siehe das Quellenverzeichnis am Ende des Romans, das einem Sachbuch alle Ehren machen würde. Physiologische Prozesse, die die Forschung heute analysiert, sind in seiner Zukunftswelt längst entschlüsselt und nach Belieben manipulierbar – womit Watts seine ultrabiologistische Weltsicht unterstreicht.
Vor allem die Illusion des Ichs hat es dem Kanadier angetan. Beziehungsweise deren Zerstörung. Das Bewusstsein ist für ihn nicht mehr als eine vermittelnde Instanz zwischen unabhängig voneinander stattfindenden und einander manchmal auch zuwiderlaufenden Prozessen. Ein evolutionäres Konstrukt, das seinen Dienst erfüllt hat, nun aber kurz davor steht, von etwas Effektiverem abgelöst zu werden. Man vergleiche das mit der Art, in der Watts die Dornenkrone beschreibt: Sie ist keine Enterprise oder Moya, kein Schiff "mit Charakter", dem man "God bless her and all who sail in her" mit auf den Weg geben würde. Sondern ein Konglomerat aus funktionellen Einzelteilen, die als System agieren – die aber auch beliebig verstümmelt, erweitert oder neukombiniert werden können. Ganz wie das menschliche Bewusstsein.
Zum Ausgleich am besten eine Romantasy lesen
Als Phänomen bezeichnet Echopraxie übrigens zwanghaftes Nachahmen bzw. Wiederholen von Vorgezeigtem. Was irgendwie witzig ist, weil der Roman durchaus Züge einer Wiederholung seines Vorgängers hat: Von seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten über die philosophischen Fragen, die hier gestellt (und von Watts auf gewohnt ernüchternde Weise beantwortet) werden – bis hin zum eigentlichen Plot. Auch hier ist wieder eine human bis posthuman zusammengesetzte Crew auf einer Weltraummission unterwegs. Wobei mir die Mission des Vorgängerromans ein wenig besser motiviert schien als diese. Aber sei's drum: Watts spielt einmal mehr seine Stärken aus und erschafft das, was er am besten kann: einen Hard-SF-Roman von höchster Qualität. Oder anders ausgedrückt: einen Albtraum.
... und einmal mehr hatte man dank Peter Watts a jolly bad time. Ich zitiere eine weitere Rezensentin, die die düsteren Ereignisse am Schluss von "Blindflug" nüchtern Punkt für Punkt aufzählte und mit den Worten schloss: "You know, I sometimes get the feeling that Watts needs a hug or something."
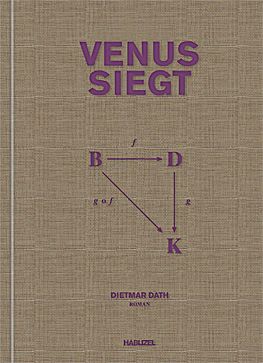
Dietmar Dath: "Venus siegt"
Gebundene Ausgabe, 300 Seiten, € 24,90, Hablizel 2015
Das Protokoll einer gesellschaftlichen Revolution liefert uns Dietmar Dath in seinem jüngsten Roman und wandert dabei durch alle Stationen: Von den Hoffnungen und Plänen der Anfangszeit, Fort- und Rückschritten sowie dem Spannungsfeld von visionären Utopien und nüchternem Alltag zwischen Plansollerfüllung und Problemen, über Fraktionenbildung, zunehmend autoritäre Züge des Systems, Ausschaltung von Dissidenten, Bürgerkrieg und Massenmord, bewaffnete Selbstbehauptung gegenüber einem äußeren Aggressor bis hin schließlich zum stückweisen Scheitern der Ursprungsidee und dem bleibenden Erbe, das diese hinterlassen hat.
Klingt jetzt vielleicht etwas banal, das Ganze als Geschichte der Sowjetunion zu lesen, verlegt auf die Venus und ein paar Jahrhunderte in die Zukunft. Andererseits: wenn der Schuh passt ... In einigen der Figuren könnte man schließlich durchaus Personen der Geschichte – von Stalin bis Trotzki – wiedererkennen.
Blick zurück im Zorn
Erzählt wird der Roman rückblickend aus der Warte von Nikolas Helander, dem Sohn eines hochrangigen Venus-Politikers. Und da kommt gleich eines der Leitmotive des Romans ins Spiel, auf die der diskursfeste Dath Wert legt: Quellenkritik. Schon im Vorwort steht, dass man Ich-Erzähler Nikolas nur bedingt vertrauen darf. Nicht zuletzt deshalb, weil der mittlerweile im Exil auf der Erde lebt und gegenüber seinem Vater sowie dem gesamten Bundwerk der Venus eine äußerst zwiespältige Haltung einnimmt. Zugleich greift Nikolas selbst immer wieder Daths Vorgabe auf und merkt wiederholt zu einzelnen Geschehnissen an, wie gut/schlecht/zweifelhaft diese durch Fakten belegt seien. Diese Geschichte ist von Anfang an ein Interpretationsprozess.
Zugleich ist "Venus siegt" wie schon das großartige "Pulsarnacht" von 2012 wieder (auch) ein eindeutiger Genreroman; beim dazwischen erschienenen "Feldeváye" oder bei "Die Abschaffung der Arten" von 2008 wäre das nicht ganz so leicht zu sagen gewesen. Trotz dieser Zuordenbarkeit wurde "Venus siegt" aber wieder fleißig im Feuilleton besprochen – ganz einfach, weil es Dietmar Dath ist. Schön für ihn und das Genre insgesamt – nur wenn Dath dort bescheinigt bekommt, der einzige relevante deutschsprachige SF-Autor zu sein, kann man den tatsächlichen Wert dieser Aussage freilich nur berechnen, indem man sie mit der Zahl der anderen an derselben Stelle besprochenen deutschsprachigen SF-AutorInnen multipliziert.
Aus der Genre-Perspektive
Dass die meisten Besprechungen von Daths Roman auf die Elemente fokussieren, die über Science Fiction hinausgehen, macht es andererseits umso leichter, ihn hier in der Rundschau aus der Genre-Perspektive zu betrachten. Schließlich ist Dath in der SF-Literatur ebenso sattelfest wie in politischen oder popmusikalischen Diskursen, wie diverse Verweise im Roman zeigen – da spielt Greg Egan keine geringere Rolle als Voltaire.
Ein besonders verlockendes Gedankenspiel wäre es, Daths Roman in Bezug zu Iain Banks zu setzen. Die postkapitalistische Venuskommune firmiert unter dem Kürzel D=B=K. "D" steht dabei für Diskrete (Roboter und Androiden mit körpergebundenem Ich-Bewusstsein), "B" für Biotische, also Menschen, und K für Kontinuierliche: Künstliche Intelligenzen, die weitgehend frei in den Info-Netzwerken kursieren. Diese drei Lebensformen gelten im Bundwerk als gleichberechtigt – als vierte Komponente kämen noch die Neukörper dazu: Menschen, die ihre Körper zu chimärenhaften Mischwesen wie aus dem Märchenbuch umgestaltet haben und zugleich diejenigen sind, die die Freiheitsutopie der Revolution am stärksten ausleben. Eine solche Gesellschaft könnte tatsächlich der Beginn einer Zivilisation wie Banks' Kultur sein ... vorausgesetzt, sie bleibt ihren Idealen treu.
Der Mann hinter dem Vorhang
Auch an Ausstattung wird – wiewohl im Vergleich zur Techno-Magie von "Pulsarnacht" deutlich heruntergefahren – so einiges geboten: Fantastische Venusstädte, die durch kilometerlange Zilien verbunden sind, das Écumen (eine auf der Venus omnipräsente "Smart Liquid", die auch als Interface fungiert) oder das Schwarze Eis – verkürzt gesagt ein Antischwerkraftmaterial. Die korrekte Definition ist natürlich etwas komplexer: "Das Schwarze Eis ist ein System von ... eine Vermählung von Gravitationskollaps einerseits und extremer Kühlung andererseits. Gefrorene Raumzeit. Und wir stellen es her, weil wir die elektrische Ladung als Kraftlinien, die in der Topologie eines multikonnektiven Raums aus Wurmlöchern gefangen sind, zu beherrschen gelernt haben. Wir stricken und nähen mit Hyperkondo-Isolation. Wir arbeiten mit der Energie der Vakuumfluktuation, der Involution von Gravitation. Vielfingrige Zeit."
Oder so. Klingt fast ein wenig nach der Techno-Poesie von Hannu Rajaniemi, auch wenn ich bei dem als gelerntem Physiker naturgemäß etwas mehr Substanz hinter dem Zauberer-von-Oz-Rauch vermute. Auf jeden Fall gelingt Dath aber das für den Menschen erniedrigendste Zwiegespräch mit einer überlegenen Künstlichen Intelligenz seit Lems "Also sprach Golem". Und das nebenbei bemerkt zum Kaffeeplauschthema Mengenlehre.
Zwischen Gegenwart und Frühgeschichte der Science Fiction
Weniger gelungen ist, dass der Roman mit jeder Menge Infodumps beginnt. Die Story scharrt in den Startlöchern, aber uns werden erst mal ausführlichst Geschichte und Geometrie der Rennbahn erläutert – und das wird sich auch später fortsetzen. Daths essayistischer Stil hat durchaus seine Nachteile, wenn es um Dynamik geht ... oder um Figuren, die lebende Wesen sein sollen. Alle hier sprechen so, wie Dath schreibt (also so, wie kein Mensch abseits einer Diskussionsveranstaltung spricht). Und da sie tendenziell auf uns gerichtete Sprachrohre sind, formal aber miteinander sprechen, neigen sie de facto leider dazu, einander in steifen Sätzen Begriffe zu erklären, die sie eigentlich eh kennen, was mitunter absurd wirkt.
Nicht, dass es in der Geschichte der SF keine Beispiele dafür gäbe, Romane als Vehikel für die Ausformulierung von Ideen und Konzepten zu verwenden. Man muss nur etwas zurückgehen – noch vor das Golden Age, zu Hugo Gernsback, H. G. Wells, Jules Verne, Edward Bellamy. Auf eine ganz eigentümliche Art und Weise haftet "Venus siegt" ein altertümliches Feeling an. Keine Ahnung, ob der Retro-Effekt beabsichtigt war oder nur eine Folge von Daths Lust am Diskurs ist. Aber er passt gut zur schlicht gestalteten Leinenbindung, in der das Buch erschienen ist.
Komplexität, Baby
High on intellect, rather low on emotion. Das wäre mein Gesamteindruck von "Venus siegt", das mir aufgrund dieser fehlenden 50 Prozent als Roman zwar nicht so gut gefällt wie "Pulsarnacht", das aber trotzdem eine meiner Nominierungen für den nächsten Kurd-Laßwitz-Preis sein wird. Denn mag es den formal in der Handlung ja durchaus vorhandenen Beziehungen und Problemen zwischen den (vielen!) ProtagonistInnen auch an Fleisch und Blut fehlen – auf der Ebene von Reflexion und Gedankenaustausch ist "Venus siegt" beeindruckend.
Und vielleicht sind Gefühle ja einfach nicht präzise genug. So legt Dath einer seiner Figuren eine Tirade in den Mund, die man aus dem Kontext herausgenommen auch als witzige Replik auf Gestöhne über Daths anspruchsvollen Schreibstil verstehen darf: "Wenn du keinen komplexen Satz mehr bilden kannst, kannst du auch keinen komplexen Zusammenhang mit wenigen Invarianten und vielen abhängigen Variablen mehr schildern. Dann bleibt nur noch übrig: Subjekt Prädikat Objekt, die Sprache der Befehle und der Unterwerfung, verkleidet als Sprache der lebendigen Teilhabe aller an allem."
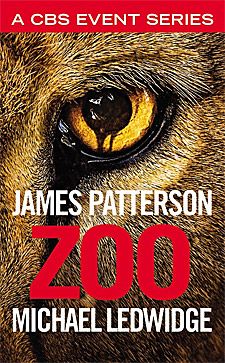
James Patterson & Michael Ledwidge: "Zoo"
Broschiert, 390 Seiten, Grand Central Publishing 2015 (Erstausgabe 2012)
Aus gegebenem Anlass ein Buch, das schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Der Anlass: Hollywood ist auf den Hund gekommen. Beziehungsweise auf den Löwen, den Affen und natürlich den Dinosaurier. Von der Verfilmung von Frank Schätzings "Der Schwarm" hat man zwar nichts Konkretes mehr gehört, seit sich Uma Thurman vor neun Jahren die Rechte gekrallt hat. Doch ansonsten wird die Erde wieder mit zunehmender Häufigkeit in eine Wildnis voller gefährlicher Tiere zurückverwandelt – und nicht nur im Film, sondern auch im TV: Etwa in der SF-Romance "The 100", die für ihr Szenario einige Anleihen bei M. Night Shyamalans "After Earth" genommen haben dürfte.
Und seit Ende Juni läuft in den USA auch die Serie "Zoo", basierend auf James Pattersons gleichnamigem Roman aus dem Jahr 2012, der rechtzeitig zum TV-Start noch einmal neu aufgelegt wurde. Bislang nur auf Englisch. Die durchaus an den "Schwarm" oder auch "Phase IV" erinnernde Prämisse: Weltweit beginnen Tiere gezielt Menschen anzugreifen und gehen dabei immer strategischer vor. Diesmal sind es aber keine Dinos, von Mikroben gesteuerte Meeresbewohner oder kleine Krabbler, sondern unsere eigenen Peers: die Säugetiere.
Eine Geschichte von Oz
Einer hat es ja schon immer gewusst: Der US-amerikanische Forscher Jackson Oz war ein aufstrebender Evolutionsbiologe, bis er seiner fixen Idee vom beginnenden HAC (Human-Animal-Conflict) nachzuhängen begann und von der Wissenschaftsgemeinde ausgestoßen wurde. Ganz wie in einem Katastrophen-B-Movie haben wir es also mit einem dissidenten Schlaukopf zu tun, der von der Welt solange nicht ernst genommen wird, bis diese erkennen muss, dass er leider recht hat. Was nicht das einzige filmische Element ist: Patterson setzt das ganze Geschehen wie in einem Drehbuch in Szene – selbst bei Traumsequenzen glaubt man beim Lesen die Kameraeinstellungen zu sehen.
Der Roman beginnt mit einem Zoowärter, einem Löwenpärchen und einem Biss ins Gesicht, und mit Löwen geht es auch weiter. Oz, der sich seine Wohnung übrigens mit einem heranwachsenden Schimpansen teilt (was auch ohne HAC eine ziemlich schlechte Idee ist), fliegt nach Botswana. Ein alter Bekannter hat ihm berichtet, dass sich die dortigen Löwen nicht nur ungewöhnlich aggressiv, sondern generell äußerst seltsam verhalten. Rasch erhält Oz die blutige Bestätigung, als er vor Ort miterlebt, wie sich Löwenrudel ganz entgegen ihrer sonstigen Art verhalten und in koordinierten Angriffen ganze Touristencamps auslöschen. Auf seiner Flucht durch die Wildnis rettet Oz dann noch die aparte französische Biologin Chloe Tousignant, womit auch der Faktor Love Interest abgehakt wäre.
An dieser Stelle verlassen wir aber den erwartbaren Ablauf: Patterson ist erstaunlicherweise realistisch genug, nicht den "Day After Tomorrow"-Apokalypseturbobooster anzuwerfen, und setzt stattdessen einen Fünfjahressprung. Oz' HAC-Hypothese hat sich in der Öffentlichkeit zwar immer noch nicht vollständig durchgesetzt – dass etwas im Argen liegt, lässt sich aber nicht länger ableugnen. Immer mehr Tierarten – allesamt Säugetiere – attackieren Menschen; selbst beim treuen Wuffi daheim kann man sich nicht mehr sicher sein. Mittlerweile hat die Zahl der Angriffe ein Ausmaß erreicht, dass es zu ersten Problemen in Wirtschaft und Infrastruktur kommt. Verzweifelt versuchen daher Wissenschafter weltweit eine Erklärung für die eskalierende Gewalt zu finden – unter ihnen auch der rehabilitierte Oz und Chloe (mittlerweile verheiratet und mit einem kleinen Sohn gesegnet). Und dann geht's erst so richtig los.
Der Schnellfeuerschreiber
US-Autor James Patterson ist ein Fließbandschreiber vor dem Herrn. So groß ist sein Ausstoß, dass er sich dabei gerne – wie auch in diesem Fall – von Koautor Michael Ledwidge die Arbeit abnehmen lässt (in welchem Ausmaß, darüber kann man nur rätseln). Und bei allen literarischen Abstrichen, die man durch eine solche Schnellproduktion machen muss, kann man es Patterson zumindest nicht absprechen, dass er sich dadurch eine professionelle Schreibe erarbeitet hat, wie sie der eine oder andere Autor, der später noch in der Rundschau folgt, erst trainieren muss. So durchsetzt Patterson die Handlung zwar mit reichlich Tongue-in-cheek-Humor und superflapsigen Kommentaren seiner Hauptfiguren, wahrt aber gerade noch die Balance. Das eine oder andere Mal rollt man dabei vielleicht mit den Augen – aber man schlägt das Buch nicht zu.
Pattersons Schwerpunkt liegt auf Krimis, im deutschsprachigen Raum sind vor allem seine beiden Reihen um die ErmittlerInnen Alex Cross bzw. Lindsay Boxer bekannt. Aber dazwischen wildert er schon auch mal in genau dem Segment von "Wissenschaftsthrillern", wie es von Autoren wie Michael Crichton, Douglas Preston und Lincoln Child definiert wurde. Und die diversen zoologischen Fun Facts (bzw. Gore Facts), die er in den Text einbaut, sind tatsächlich korrekt. Am unpassendsten erscheint da noch, wie bereitwillig sich Oz und Chloe in apokalyptische Wallungen hineinsteigern – kein sehr wissenschaftliches Verhalten.
Tierisches Lesefutter
Das alles geht zumindest so lange gut, bis die Ursache des HAC gefunden wird. Dann fällt die Logik in sich zusammen. Patterson setzt auf eine naturwissenschaftliche Erklärung – die passt allerdings weder zu dem Umstand, dass die Tierangriffe in der Wildnis begannen, noch zu den getroffenen Gegenmaßnahmen, noch ... ach, sie hinkt einfach auf allen vier Beinen. Ist aber immerhin originell. Und was soll's: Das ist man von einer Mystery eh gewohnt, dass sie nur so lange funktioniert, wie das Geschehen geheimnisvoll vor sich hin eskaliert, bis die ernüchternde Aufklärung kommt. Unterm Strich bleibt eine gewisse Öko-Botschaft (was für sich noch nichts Besonderes ist, "Sharknado" hatte auch eine ...) und – das ist nun wieder wirklich gelungen – eine Schlusswendung, mit der nicht zu rechnen war. Obwohl sie eigentlich auf traurige Weise logisch ist.
Kurz gesagt: typisches Sommerlesefutter vom laut "San Francisco Chronicle" page-turningest author in the game right now. Bin gespannt auf die Serie.
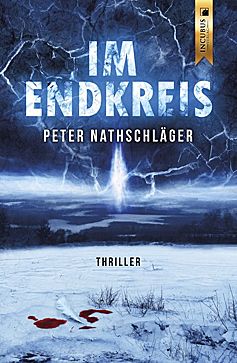
Peter Nathschläger: "Im Endkreis"
Gebundene Ausgabe, 315 Seiten, € 12,30, Incubus 2014
Ein gewisses Faible für apokalyptische Szenarien kann man dem österreichischen Autor Peter Nathschläger nicht absprechen. Nach der "Legende vom heiligen Dimitrij" und "Fluchtgemälde" ziehen auch in "Im Endkreis" dunkle Wolken am Horizont auf. Diesmal macht sich etwas ans zerstörerische Werk, das waschechte Engel sein könnten – gefiedertes Arschloch ist btw ein sehr schöner Ausdruck für einen Bösewicht. Kurz: Da liegt ein Hauch "God's Army" in der Luft, falls sich an den Film mit Christopher Walken noch jemand erinnert.
Aus Ost ...
Katalysator der Handlung wird der junge Iwan Ruslan Abt, kurz Ivo, der aus einem sibirischen Kaff stammt – nicht allzuweit von der Stelle entfernt, an der 1908 das berühmte Tunguska-Ereignis stattfand: Eine gigantische Explosion, die auf einen Meteoriteneinschlag, einen Vulkanausbruch oder auch einen Gasaustritt zurückgeführt wird. In Nathschlägers Roman hat dieses Ereignis eine Wunde in der Welt hinterlassen. Und Ivo, der erfährt, dass er das Blut schamanischer Vorfahren in sich trägt, könnte diese Wunde heilen.
Zunächst ist er davon allerdings noch in jeder Beziehung weit entfernt. Nach einer kurzen Vorstellung in seiner alten Heimat finden wir ihn in Wien wieder ... und offenbar ca. 200 Meter von meiner Haustür entfernt. (Typisch. Mein spektakulärstes Erlebnis an dieser Kreuzung war der Kauf eines Grahamweckerls. Andere begegnen dort gestaltwandelnden Schamanen oder brettern wie mein Installateur auf der Harley durch ein Schaufenster ...) Ivo trifft auf den Musikstudenten Leon Masahiro und ist nach einer kurzen Affäre auch schon wieder verschwunden. Leon, von Ivo völlig gebannt, beschließt ihm zu folgen und lässt sich auch nicht davon beirren, dass in Ivos Hotel einige verstümmelte Leichen gefunden werden und Ivo als Hauptverdächtiger gilt.
... und West
Eine gleichermaßen zugerichtete Leiche findet auch Nicholas Rousseau, ein Geheimpolizist im Ruhestand, im Südwesten Frankreichs. Und zwar genau in dem Ort, in dem er als Kind seine Familie verlor, als eines Nachts 2.200 Menschen spurlos verschwanden. In einem Traum sieht Nicholas nun, wie diese einer UFO-artigen Leuchterscheinung folgten – diese Vision zusammen mit dem Leichenfund bringt ihn dazu, wieder aktiv zu werden. Was vor ihm lag, erfüllte ihn mit Bitternis, aber es erfüllte ihn. Schöner kann man die Motivation eines vereinsamten Pensionisten nicht zusammenfassen.
Nicholas reist erst zum Tatschauplatz in Wien und von dort zusammen mit Leon immer weiter nach Osten, auf Ivos Spur. Unterwegs werden sie die trinkfeste Ex-Pilotin Olga Wetschinski aufgabeln. Und wenn dann noch Ivo dazustößt, haben wir unser Quartett beisammen: Vier Personen respektive zwei Liebespaare gegen den Weltuntergang.
Nathschläger fährt für seine Apokalypse-Mystery so einiges auf: Ein sowjetisches Geheimprojekt rund um das Tunguska-Ereignis und sadistische Experimente an Kindern. Übernatürliche Akteure und eine Organisation – das Engelfeld – mit guten Connections zu Pharmakonzernen und der Medienindustrie. Bedrohliche Graffiti, Gestaltwandler und folgenreiche Schwingungen im Bereich von 808,8 Megahertz. SF- und Fantasyelemente reichen sich fröhlich die in Blut getauchte Hand.
The Good, the Bad and the Neutral
Liebesgeschichten sind bei Nathschläger immer ein mindestens so wichtiger Bestandteil der Handlung wie die Phantastik-Action. Und in seinem Fall heißt das: zwischen Mann und Mann. Das ergibt in der Konstellation Ivo/Leon & Nicholas/Olga eine reizvolle Umkehrung der üblichen Hierarchie von Alpha- und Beta-Paar. Hier dreht sich alles um Wohl und Wehe des schwulen Paars, während Nicholas und Olga die in der Regel undankbare Rolle des Beta-Paars zuteil wird. Das muss in zahllosen Büchern und Filmen entweder als Comic Relief herhalten oder ein trauriges Ende finden, um durch seine Tragödie das Glück des Alpha-Paars gefühlvoll zu unterstreichen. In Spannung hat mich daher nicht zuletzt die Frage gehalten, ob Nathschläger mit seinen NebendarstellerInnen wohl gnädiger umgehen wird als seine MainstreamkollegInnen mit ihren. (Die Antwort kann ich natürlich nicht spoilern.)
Seine größten Stärken hat der Roman für mich in den Actionpassagen – allen voran die spektakuläre Schilderung eines Zugsunglücks in Moskau. Überhaupt geht's in "Im Endkreis" immer wieder ziemlich drastisch zur Sache: Da werden ausgeweidete Leichen an die Wand getackert, Kinder von einem an Mengele erinnernden Mediziner verstümmelt – und wenn sich Ivo in Wolfsgestalt durch die Reihen seiner Feinde frisst, muss die Putzfrau anschließend auch öfter als einmal feucht durchwischen.
Auf die religiöse Komponente des Romans hätte ich hingegen gerne verzichtet. Religion und Logik gehen selten zusammen und das nimmt Handlungslogik nicht aus. Gerade bei Weltuntergangsszenarien sind religiöse Erklärungen knifflig, weil sie letztlich immer darauf hinauslaufen, dass der Mythologie einer Religion Deutungshoheit über die gesamte Menschheit zugeschrieben wird. An der Oberfläche scheint das hier anders zu sein, weil Nathschläger ein interkonfessionelles Bündnis gegen den Weltuntergang schmieden lässt. Aber wenn im "Endkreis" Vertreter diverser Religionen "das Bündnis mit Gott" erneuern wollen, wird erst wieder allen die christliche Matrix übergestülpt. Welches Bündnis sollten ein Buddhist, ein Hindu oder ein Animist erneuern wollen? Und mit welchem Gott?
Kurz gesagt
Bilanz: Positiv, aber durchwachsen. Was letzten Endes aber ohnehin zu erwarten war. Im Gegensatz zum Magischen Realismus von "Fluchtgemälde", der viel mehr gestalterischen Freiraum ermöglichte, hat Nathschläger mit "Im Endkreis" den deutlich konventionelleren Stil einer Mystery gewählt. Und eine Mystery – man kann's nicht oft genug sagen – ist eben immer nur solange gut, bis die Auflösung kommt.
P.S. für diejenigen, die sich Sorgen gemacht haben: No installateurs were harmed during the making of this review. At least not dauerhaft.

George R. R. Martin (Hrsg.): "Wild Cards: Der Sieg der Verlierer"
Klappenbroschur, 572 Seiten, € 15,50, Penhaligon 2015 (Original: "Wild Cards: Busted Flush", 2008)
Die wechselvolle Geschichte des von George R. R. Martin betreuten Shared Universe der "Wild Cards" kann man in seinem Story- und Essayband "Traumlieder 3" nachlesen. "Der Sieg der Verlierer" ist die direkte Fortsetzung von "Das Spiel der Spiele" aus dem vergangenen Jahr. Insgesamt neun AutorInnen haben am aktuellen Band mitgeschrieben, darunter prominente Namen wie Ian Tregillis, Carrie Vaughn und Melinda Snodgrass. George R. R. Martin selbst zählt übrigens nicht dazu, der hat nur als Herausgeber fungiert.
Liest man viele Bücher im Jahr, braucht man natürlich einige Zeit, sich im höchst umfangreichen Personal der "Wild Cards"-Romane wieder zurechtzufinden. Es sind jedenfalls fast alle aus "Spiel der Spiele" wieder mit dabei: Amazing Bubbles, die Energiestöße absorbieren, als Körpermasse speichern und in Form explosiver Blasen wieder absondern kann. Drummer Boy, der als Schlagzeuger einer Rockband praktischerweise auf vier Arme und körpereigene Trommelfelle zurückgreifen kann und dabei Superschall produziert, dass es nur so knallt. Oder John Fortune, der mit einem antiken Skarabäus in der Stirn gleichzeitig die altägyptische Löwengöttin Sachmet in sich trägt. Kurz gesagt: Es ist das ungewöhnlichste Superheldenteam diesseits von China Miévilles "Dial H".
Helden im Einsatz
Und inzwischen werden die aus einer Casting-Show hervorgegangenen Helden ihrem Namen tatsächlich gerecht: Unermüdlich ziehen sie im Auftrag der UNO von einem Krisenschauplatz zum nächsten und leisten Hilfe – oft auch noch unbedankt. Manchmal machten sich die Kritiker über sie lustig: Was, ihr Kinder glaubt, ihr könntet die Welt retten? Aber das konnten sie. Sie taten es. Immer ein kleines Stück nach dem anderen.
Ihre Arbeit für die UNO bringt sie zudem in Konflikt mit der Regierung ihrer US-amerikanischen Heimat, der globale Ziele weit weniger wichtig sind als der eigene Vorteil. Dieser Konflikt wird in einem der Haupthandlungsstränge des Romans virulent: Abgelegen in der Wüste befindet sich das Biological Isolation and Containment Center, in dem Menschen mit potenziell gefährlichen (oder nützlichen) Superkräften oft gegen ihren Willen gefangen gehalten werden – es erinnert mitunter an das berühmte Arkham Asylum von Gotham City. Jüngster Insasse ist der zehnjährige Drake, der ungewollt eine Explosion in Atombombenausmaßen ausgelöst hat; ihn gilt es zu befreien.
Komplexes Szenario
Mehrere Handlungsebenen sind vor dem Hintergrund einer globalen Wirtschaftskrise angesiedelt; ausgelöst dadurch, dass das den Nahen Osten beherrschende Kalifat dem Rest der Welt den Ölhahn zugedreht hat. Das führt nicht nur zu einem brutalen, dreckigen Stellvertreterkrieg voller Kollateralschäden (=Massaker) auf den Ölfeldern Nigerias. Es kommt auch zur Invasion des Kalifats durch UN-Truppen – die UNO beschränkt sich hier keineswegs auf eine pazifistische Rolle.
Und dann droht noch auf einer weiteren – und weitestgehend entbehrlichen – Handlungsebene ein Hurrikan in New Orleans. Dieser Strang zieht sich so richtungslos dahin wie Amazing Bubbles' Liebesleben, die von einer Freundin zur nächsten wandert und außer Explosivblasen in erster Linie eine "Ich will etwas haben, ich weiß nur nicht was"-Haltung verströmt. Ach ja, und hier treten auch Zombies auf. Die Voodoo-Variante.
Action, Humor und Desillusionierung
Im Verlauf der Handlung wird es zu einigen wahrlich bizarren Showdowns kommen, in denen die groteskesten Superkräfte aufeinanderprallen, die man sich vorstellen kann. Einer davon findet auch noch vor adäquatem Hintergrund statt, nämlich dem Barbarian Day von Pecos: einem Fantasy-Festival, auf dem Herr Smith und Frau Jones aus der texanischen Provinz im Fellkostüm antanzen und Barbarenburger und Zauberzuckerwatte mampfen.
Aber wie Martin schon sagte: Die "Wild Cards" sind eine düstere Variante von Superheldengeschichten. So idealistisch zumindest einige Mitglieder des Teams auch sein mögen – sie können nicht übersehen, dass sie zu Figuren auf dem Spielbrett der internationalen Politik gemacht wurden. Am weitesten treibt Ian Tregillis die Desillusionierung mit seiner Figur der Genetrix: Deren Fähigkeit ist es, Homunculi mit Superkräften zu gebären. Und nicht nur dass sie sich völlig falsche Vorstellungen von deren "Vater" macht, der diese Kinder in Wahrheit gegen Geld in vollkommen lieblosen Akten zeugt. Sie baut auch noch zu jedem ihrer Kinder eine liebevolle Beziehung auf, obwohl sie weiß, dass deren Lebenserwartung meist nur wenige Stunden beträgt. Tragischer geht's kaum noch.
Zwischenbilanz
"Der Sieg der Verlierer" ist ein typischer Fall von Middle-Book-Syndrome. Wer Band 1 nicht gelesen hat, wird sich hier nur schwer zurechtfinden. Und einen wirklichen Abschluss gibt es auch nicht, weil ja ein weiterer Band ansteht. Nur für einzelne ProtagonistInnen wird sich der Handlungsbogen runden. Hervorgehoben sei hier Double Helix, der hermaphroditische Doppelagent mit Teleportationskraft, der für den britischen MI6 arbeitet, in männlicher Gestalt dem Kalifat als Assassine zu dienen scheint und in weiblicher Inkarnation dem Superheldenteam hilft. Und als würde ihn/sie die fragile Balance zwischen den wechselnden Loyalitäten nicht schon interessant genug machen, entwirft seine/ihre Erfinderin Melinda Snodgrass auch noch eine traurige Familiengeschichte für Double Helix. Eindeutig die spannendste Figur des ganzen Romans.
Ich habe dieses Buch am Anfang der Rundschau-Sommerpause gelesen, die Rezension dummerweise aber erst gegen Ende, also zwei Monate später, zu schreiben begonnen. Mit so mancher Notiz auf meinem Stichwortzettel konnte ich daher nichts mehr anfangen und musste einiges wieder durchblättern. Was "Der Sieg der Verlierer" eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt: Es war unterhaltsam, solange es anhielt, hinterließ aber keinen bleibenden Eindruck.
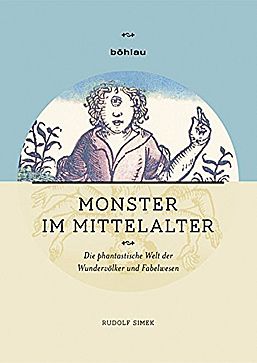
Rudolf Simek: "Monster im Mittelalter. Die phantastische Welt der Wundervölker und Fabelwesen"
Broschiert, 360 Seiten, € 30,80, Böhlau 2015
Ein Herzensprojekt, mit dem er laut eigenen Angaben ein Vierteljahrhundert schwanger ging, hat sich der österreichische Skandinavist und Mediävist Rudolf Simek verwirklicht: Nämlich ein Lexikon all der wundersamen halbmenschlichen Völker zu erstellen, die man im Mittelalter in fernen Regionen der Welt ansässig wähnte und – anders als Elfen oder Zwerge – durchaus für real hielt. Sein "Monster im Mittelalter" gibt damit Überblick über etwas, das man durchaus die Science Fiction des Mittelalters nennen könnte; aber mehr zu diesem speziellen Aspekt später.
Zunächst einmal muss man sich wundern, dass heutige Fantasy-AutorInnen, die doch so gerne nach mythologischem Material in der Klamottenkiste wühlen, von den hier aufgezählten Wesen so gut wie keinen Gebrauch machen. Denn so exotisch diese heute auch anmuten – sie hatten mal, zumindest unter Schriftkundigen, einen ebenso großen Bekanntheitsgrad und eine genauso lange Tradition wie die heutzutage endlosrecycelten Elfen, Zwerge & Co. Fresh stuff here!
Ein Panoptikum ohnegleichen
Mal sehen, da hätten wir etwa die Blemmyae: Menschen ohne Kopf, denen Augen, Nase und Mund aus dem Brustkorb wachsen (zu unterscheiden übrigens von den grundsätzlich ähnlichen Epiphagi, bei denen die Augen allerdings in Achselnähe sitzen). Kranichschnäbler mit langem Hals und hundsköpfige Cynocephales. Die fantastischen Skiopodes, die nur ein Bein und einen Fuß haben, auf dem sie – wie auch immer – rasend schnell laufen können. Außer wenn sie sich auf den Rücken legen und ihren übergroßen Fuß als Sonnenschirm über sich halten ... Die Panotii mit ihren riesigen Schlappohren, in die sie sich wie in ein Gewand wickeln. Und zum Ausgleich die Psambari, die gar keine Ohren haben, was verblüffenderweise auch für alle ihre Tiere gilt. Im 80-seitigen lexikalischen Teil seines Buchs listet Simek sie alle auf, von Menschenfressern bis zu behaarten Frauen.
Womit wir auch schon zur zweiten Hauptattraktion des Buchs kommen: Den zahlreichen enthaltenen Fotos, die Illustrationen aus mittelalterlichen Schriftstücken ebenso wie Ornamente der kirchlichen Bauplastik zeigen. Und die zum Großteil unfassbar komisch sind. Nicht nur wegen der Motive an sich, sondern auch weil – let's face it – das Mittelalter nun einmal nicht unbedingt die Blütezeit naturalistischer oder perspektivengetreuer Illustrationskunst war. Da sehe ich etwa ein paar Menschen neben einem großen Hund, lese in der Bildlegende das Wort "Elefant", werde stutzig, blicke zurück und: tatsächlich. Dem Hund ist vorne eine Art Trichter angeflanscht. Ein Elefant! Gleich auf der nächsten Seite reitet jemand auf etwas, das als Krokodil ausgewiesen wird, aber aussieht wie ein Hase mit Schwimmhäuten.
Einige besondere Highlights entstammen der Abschrift eines Werks von Thomas von Cantimpré, das wundersamen Meeresbewohnern gewidmet war und in dem sich eine Seekuh beispielsweise als Fisch mit Rindskopf präsentiert. Überhaupt war die See damals recht gut befüllt: Außer Meerjungfrauen hielt man auch Meermönche und Meerritter für möglich. Letzterer prangt uns in derselben Schrift als Fisch mit Schutzhelm entgegen, es ist zum Niederknien.
Literaturwissenschaftliche Perspektive
Zu beachten ist: Als Skandinavist und damit Germanist zieht Simek das Thema von der motivgeschichtlichen Seite auf. Der Großteil des Buchs ist also der Frage gewidmet, wie sich die Beschreibungen der diversen "Wundervölker" von ihren größtenteils aus der Antike stammenden Wurzeln weiterentwickelt haben, als sie von späteren Autoren aufgegriffen und verändert wurden – einerseits in der epischen Dichtung des Mittelalters, noch mehr aber in Enzyklopädien und anderen Werken der damals üblichen Mischung aus naturwissenschaftlicher und theologischer Betrachtung. Für den Leser bedeutet diese Form der literaturwissenschaftlichen Evolutionsgeschichte kurz gesagt: Namen, Daten und Quellenangaben galore.
Sehr genau nimmt Simek es auch mit der Unterscheidung zwischen den "Wundervölkern", "Fabelrassen" oder kurz "monstra", denen dieses Buch gewidmet ist, und all denjenigen Märchenwesen, die im Mittelalter nicht unter den "Monster"-Begriff fielen. Der konnte dem heutigen Verständnis nämlich durchaus widersprechen: Ein Drache etwa hätte nicht als Monster gegolten, da laut Simek ein Monster damals zumindest eine menschliche Komponente enthalten musste (bei Meeresbewohnern scheint man es allerdings weniger genau genommen zu haben). Nachvollziehbar ist die Abgrenzung gegenüber übernatürlichen und körperlosen Wesen wie Dämonen. Warum allerdings sehr menschlich wirkende Wesen der "niederen Mythologie" wie etwa Wichtel oder Elfen keinen Eingang in Wundervölkerkataloge fanden – anders als diverse Mischwesen aus Mensch und Tier – erschließt sich einem in biologischen Kategorien denkenden Menschen von heute nicht. Leider auch nicht nach der Lektüre von Simeks Buch.
Einblicke in das mittelalterliche Denken
Die einzige verbindende Komponente scheint gewesen zu sein, dass die Wundervölker allesamt in fernen Weltgegenden angesiedelt wurden. Womöglich sogar auf dem damals heiß diskutierten hypothetischen "Australkontinent" auf der anderen Seite der Welt. Simek widmet sich in einem sehr lesenswerten Kapitel ausführlich der Irrmeinung, dass man im Mittelalter die Erde für eine Scheibe gehalten habe. Die Kugelgestalt galt als weithin akzeptiert – nur über die Frage, ob auf der Rückseite der Erde mehr als nur Wasser sei, konnte man sich nicht einigen.
Durch ihre Abgelegenheit konnten die Wundervölker als Projektionsflächen für alle möglichen Moralvorstellungen dienen. Allegorische Auslegungen ihrer Besonderheiten wichen offenbar extrem voneinander ab; jeder theologische Autor bog sie sich zurecht, wie es ihm gerade ins Konzept passte. Einige – etwa die Amazonen oder die zum Volk umgedeutete indische Brahmanenkaste – hatten ein besseres Image als andere, aber im Prinzip galten die "Monster" als wertneutral. Angst machten sie nicht, schon eher erregten sie Mitleid und manchmal sogar Respekt. Oft sahen sie anders aus als (europäische) Menschen, manchmal hatten sie auch einfach nur als ungewöhnlich empfundene Sitten – an ihrem Status als Menschen bzw. beseelte Kinder Gottes herrschte aber kaum Zweifel.
SF-Aspekte
Und damit schlagen wir den Bogen zur anfänglich erwähnten "Science Fiction des Mittelalters" zurück. Dieser Ansatz von "anders, aber ungefähr gleichwertig", also die "Monster" als theoretisch denkbare alternative Formen menschlichen Lebens zu betrachten, wie Simek es nennt, entspricht im Grunde exakt der Stellung von Aliens in der Science Fiction. Wir haben bloß den Rand unserer Welt längst erreicht und mussten daher die Wundervölker auf andere Planeten verschieben.
Bei der Beispielsfindung für diesen Gedankengang, dem Simek das Abschlusskapitel widmet, zeigt sich freilich, dass er kein SF-Analytiker ist (was er ja auch nicht sein muss). Außer ein paar Altklassikern wie Wells und Laßwitz zitiert er nur die populärsten, man könnte auch sagen banalsten Beispiele: "Alf", "E.T." und "Star Trek". Dieses sehr eingeschränkte Sample führt auch zu einer Oberflächlichkeit, die in starkem Kontrast zu der Exaktheit steht, auf die Simek zuvor gepocht hatte (siehe die unterschiedliche Augenposition von Blemmyae und Epiphagi). Nimmt man's erst so genau, kann man nachher allerdings nicht die Fühler der Andorianer mit den Hörnern von Satyrn über einen Kamm scheren, um eine Art kultureller Kontinuität herbeizureden. Und "hundsköpfig" sehen Klingonen beim besten Willen nicht aus.
Immerhin schränkt Simek solche an den Hörnern herbeigezogene Vergleiche selbst ein: Diese Parallelen müssen nicht unbedingt auf die Entlehnungen bei den mittelalterlichen Fabelrassen zurückgehen, sondern verweisen auch auf ähnliche kreative Muster bei der Erschaffung von Wundervölkern. In der Tat. Oder sie verweisen auch einfach nur auf die eingeschränkten Möglichkeiten, mit denen die Make-up-Abteilung eines TV-Studios einen Schauspieler zum Alien umstylen kann.
Die Anderen als unser Spiegel
Da Simek in der Science Fiction erkennbar weniger zuhause ist als im Mittelalter, entgehen ihm allerdings auch Beispiele, die seine Verknüpfung von Wundervölkern mit SF sehr wohl stützen. Wenn er schreibt, dass sich die Science Fiction fast nur auf die äußerlichen Besonderheiten von Außerirdischen beschränke, dann verkennt er ein ganzes riesiges Teilgebiet der SF mit langer Tradition: Von Ursula K. LeGuin bis zu Iain Banks' Kultur wimmelt es in der Science Fiction nur so vor Zivilisationen, deren Angehörige nicht körperlich, sondern in der Art ihrer sozialen Organisation von uns abweichen. Und die uns und unserer Kultur damit einen Spiegel vorhalten, um uns selbst zu überdenken – wie es einstmals die Amazonen und Brahmanen/Bragmani taten.
"Monster im Mittelalter" hat seine Stärken dort, wo Simek sich auf sein Kernthema beschränkt und faszinierende Einblicke in die Denkweise einer Zeit gibt, die von der unseren oft beträchtlich abwich – ihr manchmal aber auch überraschend ähnlich war. Bei Bezügen zur Gegenwart wäre noch einige Luft nach oben. Offen bleibt nicht zuletzt die Frage, warum fast alle der hier beschriebenen Völker aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden sind, während Elf und Zwerg so populär sind wie eh und je. Aber vielleicht ändert sich das ja nun und Piper lässt bald eine ganz neue Welle von Völkerromanen auf den Markt los. Ich warte gespannt auf die erste Einfüßler-Trilogie.

Axel Kruse: "Glühsterne"
Broschiert, 215 Seiten, p.machinery 2015
Zurück in eine Zukunft, die es nicht mehr gibt. Drei Weltraumkrimis im Novellen- bzw. Novelletten-Format hat der deutsche Autor Axel Kruse im Band "Glühsterne" zusammengefasst. Vom Feeling her steigen wir damit in eine Zeitmaschine und gehen in eine SF-Ära lange vor dem heutigen Quantenbarock, vor Cyperpunk und sogar vor der New Wave zurück. Bis wir bei ... sagen wir Poul Anderson und dessen Dominic-Flandry-Romanen angekommen sind. Auch dort wurde vor dem Hintergrund eines interstellaren Imperiums ermittelt. Doch während Andersons Imperium im Verfall begriffen war, ist das von Kruse gerade auf Expansionskurs.
Bei besagten Glühsternen handelt es sich übrigens um Schmuck, der aus den leuchtenden Fischfossilien eines abgelegenen Kolonialplaneten geschnitzt wird: Daria, 500 Jahre lang isoliert, dann vor einem Jahrzehnt von der Erde wiederentdeckt und nun Ziel einer neuen Einwanderungswelle. Zugleich bilden die Glühsterne den äußerst losen Rahmen der drei Erzählungen; ein kleines Leitmotiv ähnlich wie in der Stephen-King-Verfilmung "Katzenauge".
Die ersten beiden Fälle
Da ist die formale Klammer fast stärker: Drei Verbrechen, drei Spurensuchen, drei nicht hauptberufliche Ermittler als Ich-Erzähler. In der ersten Geschichte, "Ein Job in Sreser", heißt er Leem Baldwin und kommt als Besucher in ein Fischerdorf auf Daria. Dass er sich täglich betrinkt, nährt das Misstrauen gegen den Fremden – erst recht, da das Dorf von einer Mordserie heimgesucht wird. Das Ganze mündet in einen gelungenen Twist und ergibt für mich die beste der drei hier versammelten Erzählungen.
Der Erzähler von Geschichte 2), "Glühsterne", heißt Marek t'Larien und arbeitet im Amt für außerplanetarische Angelegenheiten auf der Erde. Als seine Familie ermordet wird und sich herausstellt, dass der Täter von Daria kam, entwickelt der unbedarfte Bürohengst ungeahnte Tatkraft. Marek beschließt, nach Daria zu fliegen ... was unter anderem beinhaltet, einem Trupp Regierungssoldaten weiszumachen, er wäre ihr Vorgesetzter. "Glühsterne" ist somit eine waschechte SF-Köpenickiade – erst im Weltraum, dann fortgesetzt als Planetenabenteuer. Bedauerlich ist nur der viel zu überhastete Schluss, in dem das Ende von Mareks Mission kaum mehr als ein Nachgedanke bleibt.
Yours sincerely, Alex Benedict
Im dritten Fall, "... wo noch niemand zuvor gewesen ist", geht Kruse stärker auf das große Szenario ein. Seine Erzählungen sind wie gesagt vor dem Hintergrund eines interstellaren Imperiums der Menschheit angesiedelt. Anders als bei "Star Trek", auf das der Titel der dritten Geschichte anspielt, ist es jedoch ein ziemlich unsympathisches Reich: Autoritär bis faschistisch, zunehmend fremdenfeindlich – und nun auch gewillt, gegen die galaktischen Nachbarn Eroberungskriege zu führen.
Viel stärker als an "Star Trek" erinnert die Erzählung aber ohnehin an die Alex-Benedict-Romane von Jack McDevitt (dessen klassizistischen Zugang zur Science Fiction Kruse ja teilt). Hier fungiert als Ich-Erzähler, Bruno Demin mit Namen, nämlich ein interstellarer Antiquitätenhändler, der es mit einem seltsamen Artefakt zu tun bekommt, das zum Schlüssel für ein galaktopolitisches Geheimnis wird und ihn auf eine wechselvolle Schnitzeljagd durchs All führt. Auch hier ist der Schluss übrigens abrupt – anscheinend ein Markenzeichen Kruses. Was in Erzählung 1) noch gut funktioniert, kommt in 2) und 3) allerdings eher als nicht ausreichend auserzählt rüber.
Der Fluch ...
Demin kommt übrigens von einem Kolonialplaneten mit dem schönen Namen Eberhardts Irrtum. An netten Ideen mangelt es Kruse nicht – etwa die, einen Weltraumlift in Verbeugung vor "The Fountains of Paradise" schlicht einen Clarke zu nennen. Fraglich, ob man das auch noch unbedingt in Form eines Dialogs erklären musste, aber Kruse neigt eben generell dazu, lieber eine Erklärung oder vermeintliche Präzisierung zu viel als zu wenig einzubauen. Und landet damit immer wieder bei Redundanzen. Ich blinzelte mit den Augenliedern ... ja, womit denn sonst? (Das -e- tut hier nichts zur Sache.)
Womit wir schon beim Sprachlichen wären. "Was war das?", fragte Simone, während ihre Zähne, der Tatsache Rechnung tragend, dass sie ungeschützt der Kälte der Nacht ausgesetzt war, bibbernd aufeinanderschlugen. Gehen ja mit geradezu beamtenhafter Sachlichkeit vor, diese Zähne. Wie auch die Kinder, die sich hier auf der Straße herumtreiben. Anderswo würden sie um Geld betteln oder um Essen – bei Kruse betteln sie um Honorierung. Warum so gestelzt?
... des unnötigen Umschreibens
An Jahren gemessen, kann man Kruse nicht als Jungautor bezeichnen. Der vorerst noch überschaubare Umfang seines Werks macht es aber wenigstens nicht ganz unmöglich – und tatsächlich teilt Kruse mit gar nicht so wenigen anderen einen Grundzug, auf den ich gerade in deutschsprachigen Anthologien immer wieder stoße: den Fluch des Umschreibens. Anstatt zu sagen, was Sache ist, wird allzuoft nach einem vermeintlich originelleren oder "edleren" Ausdruck gesucht.
Wenn dann – Achtung, jetzt kommen viele U's – auf unnötige Umständlichkeit auch noch Unsicherheit in der Verwendung trifft, kommt dabei eine schiefe Formulierung heraus, die einfach ungeschickt wirkt. Wie jemand, der nicht mit einem Lächeln davongeht, sondern mit einem Strahlen auf den Lippen. Solange die betreffende Person kein Lipgloss verwendet – und das käme bei einem ruppigen Dorfwirt doch überraschend – strahlen Lippen aber im Gegensatz zu Augen, einem Lächeln oder einem Gesichtsausdruck nicht. Knapp daneben ist eben leider auch daneben.
Dabei sind diese selbstgesetzten sprachlichen Stolpersteine, die die Geschichten ja vermutlich stilistisch aufwerten sollen, komplett unnötig (mal ganz davon abgesehen, dass sie sehr leicht herauszulektorieren wären). Denn ich mag die Golden-Age-Atmosphäre von "Glühsterne". Ich mag Kruses Figuren und ich mag es, dass sie einem Überraschungen bereiten können, die aber trotzdem zu ihrem Charakter passen. Passt eigentlich alles – jetzt noch das Holz aus den Formulierungen schlagen und künftig besser gleich gar keine Energie mehr auf die Suche nach "gewählten Formulierungen" verschwenden. Denn eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Oder um es mit einem Zitat aus dem Austropop zu sagen: Verkrampf di net.
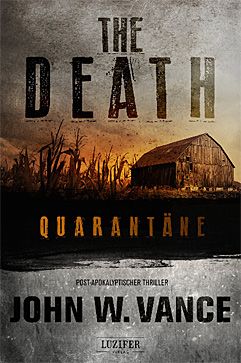
John W. Vance: "The Death. Quarantäne"
Klappenbroschur, 280 Seiten, € 14,40, Luzifer Verlag 2015 (Original: "The Death – Quarantine", 2014)
Wir schreiben das Jahr 2021. Eine Pandemie – schlicht der Tod genannt – hat den Großteil der Menschheit ausgelöscht und auch vor Tieren und Pflanzen nicht Halt gemacht. Ein eingeschlagener Asteroid soll das Virus aus dem All mitgebracht haben; das legt zumindest der Prolog nahe, in dem eine Wissenschafterin, die den Brocken untersucht hat, in Windeseile erkrankt. Allerdings kursieren natürlich auch Verschwörungstheorien über eine geheime Biowaffe, das versteht sich ja von selbst.
Die ProtagonistInnen
Ein halbes Jahr, nachdem der Tod um die Welt gegangen ist, wagt sich Devin Chase, der Freund der Wissenschafterin, aus seinem Loch. Monatelang hatte er sich auf einer abgelegenen Farm versteckt, ehe er der tatkräftigen Tess und ihrem Hund begegnet und sich von den beiden buchstäblich mitreißen lässt: Auf zu einer Überlebenssafari durch das weitgehend verwaiste Illinois. Aus dem zumindest teilweisen Verschwinden von Flora und Fauna – eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber ähnlichen Postapokalypse-Szenarien – macht Autor John W. Vance erstaunlicherweise nichts. Dafür treten mal wieder kannibalische Banditen auf.
Der zweite Handlungsstrang dreht sich um die Architektin Lori Roberts, die zusammen mit ihrem Mann und Sohn in einem Katastrophenschutzlager in Colorado festsitzt. Dort kommt einem so einiges fischig vor: Etwa dass sich der Lagerleiter als "Kanzler" ansprechen lässt und offenbar größenwahnsinnige Pläne hegt: Er will auf der grünen Wiese eine neue Stadt bauen, und dieses "Arcadia" soll der Pracht des alten Washington in nichts nachstehen. Und dann wäre da noch der Umstand, dass regelmäßig Lagerinsassen nach einem undurchschaubaren Auswahlverfahren zur Umsiedlung in ein anderes, angeblich viel besseres Lager bestimmt werden. Das lässt natürlich sofort an die vermeintliche Lotterie im Film "The Island" denken – bei Vance läuft es darauf hinaus, dass [gelöscht durch die automatische Spoiler-Entfernung von Skynet®].
In der Déjà-Wüste
So weit, so gut. Was dem Roman allerdings komplett fehlt, ist irgendeine Form von individueller Note. "Quarantäne" liest sich, als hätte sich jemand aus heiterem Himmel gedacht: Jetzt setze ich mich hin und schreibe einen postapokalyptischen Thriller. Ganz offensichtlich hat sich Vance Gedanken gemacht, wie er ein nicht eben selten abgehandeltes Szenario mit Twists versehen kann. Tatsächlich gelingt ihm die eine oder andere überraschende Wendung. Und auch das Pacing des Romans passt.
Woran es jedoch hapert, ist die Ausgestaltung: Zum einen, was die Romanwelt betrifft – das ist reine Postapokalypse-Konfektionsware ohne irgendein neues Element. Und auch am Stil ließe sich noch deutlich feilen; speziell die Dialoge wirken des Öfteren reichlich hölzern.
Mit militärischer Schreibdisziplin
Nicht, dass das sonderlich überraschen oder enttäuschen müsste: "The Death" ist das Erstlingswerk von US-Autor (und nach eigenen Angaben Ex-Marine) John W. Vance. Dass jemand seine Autorenkarriere gleich mit einer Trilogie startet ... nun, Zeichen der Zeit. Und faul ist er nicht: Alle drei Teile sind im Original binnen eines Jahres erschienen, plus zwei Teile aus einer anderen Reihe. Alle diese Bände bewegen sich im Bereich von 200+ Seiten: Das ist nicht lang – aber auch nicht sooo kurz, dass da in Summe nicht eine enorme Textmenge zusammenkäme. Und die wurde in Rekordzeit produziert!
Anscheinend möchte sich Vance in der Nische des Vielschreibers einrichten. Das sollte immerhin den Effekt haben, dass er mit der Zeit noch eine professionellere Schreibe entwickeln wird und daraus vielleicht sogar ein eigenes Profil. Vorerst aber ist noch genug Luft nach oben: "Quarantäne" reicht als Spannungslektüre für eine Bahnfahrt oder einen Nachmittag am Strand, mehr nicht. Teil 2 der "The Death"-Trilogie, "Ausrottung", müsste bei Erscheinen der Rundschau bereits erhältlich sein.

Hugh Howey: "Exit"
Gebundene Ausgabe, 464 Seiten, € 20,60, Piper 2015 (Original: "Dust", 2013)
Déjà-vu! Nachdem es doch schon einige Zeit her ist, dass ich "Silo", den Beginn von Hugh Howeys höchst erfolgreicher postapokalyptischer Reihe, gelesen habe, wollte ich zur Gedächtnisauffrischung noch mal schnell meine alte Rezension durchschauen. Und prompt begann diese exakt so, wie ich eigentlich diese starten wollte: Mit einer Entschuldigung, dass ich mit der Rezension ein wenig spät dran war, und Gestöhne über die Hitzewelle, in der ich das Buch dann gelesen habe. Das Leben scheint doch in Zyklen zu verlaufen.
Nur eines ist diesmal anders: Überraschung über die Qualität gibt's nun keine mehr. Der größte Selfpublishing-Star in der Science Fiction (zumindest bis Andy Weir mit seinem "Martian" kam) hat inzwischen ja hinlänglich bewiesen, dass er es versteht, ein faszinierendes Garn zu spinnen. Und das mit erstaunlicher Mühelosigkeit. Das Wort "schlicht" habe ich schon bei Scalzi verwendet – Howey aber erhebt die Schlichtheit zu etwas Kunstvollem. Etabliert wird dieser Stil schon im Dialog, der höchst effektiv böse Vorahnungen auf das Kommende weckt. Der Ton ist – auch das wird sich durch den ganzen Roman ziehen – gedämpft und spiegelt damit die Enge der Welt wider, die Howey entworfen hat.
Life in Sub-Urbia
Zur Erinnerung: Ein mit Nanotechnologie geführter Weltkrieg hat die Erde verwüstet. Überlebt haben nur diejenigen, die in riesigen Silos in der Erde vergraben wurden. Jahrhunderte später sind deren Nachkommen auf ein Steampunk-artiges Niveau zurückgefallen und leben in ihrer hermetisch versiegelten Welt zwischen riesigen Maschinen. Das kann man sich in etwa so vorstellen, als wären die unteren Ebenen von Metropolis (Lang, nicht Superman) verschüttet worden. Das Wissen um ihre Vergangenheit hat man den SilobewohnerInnen absichtlich genommen, Manipulation, Kontrolle und Rituale halten die Gemeinschaft in einer Art Starre. Bis in "Silo" die junge Mechanikerin Juliette Nichols auf den Plan tritt, deren revolutionäre Gedanken ihre Welt für immer verändern werden.
Im zweiten Band "Level" schilderte Howey die Vorgeschichte vom Bau der Silos Mitte des 21. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Mit einem Trick konnte er dabei den langen Zeitraum überspannen: Im zentralen Silo 1, wo sich die Initiatoren des Projekts aufhalten, sehen die Verhältnisse nämlich etwas anders aus als in den künstlichen Gesellschaften der übrigen Silos. Hier verbringen die Insassen die meiste Zeit im Kälteschlaf und werden immer nur für relativ kurze "Schichten" geweckt. Jahrhunderte später gibt es also immer noch Zeitzeugen der globalen Katastrophe (darunter auch deren Auslöser ...).
Silo-Architekt Donald Keene war die zentrale Figur von Band 2. Er hat die dort geschilderten Ereignisse überstanden, ist vom Mithelfer zum Gegner des Silo-Projekts geworden und versucht nun mit allen Mitteln, es zu stoppen. Denn die Uhr tickt: Vor dem Hintergrund eines gnadenlosen Ausleseprozesses sieht der ursprüngliche Plan nämlich vor, vor der Wiederbesiedelung der Erdoberfläche alle Silos bis auf einen zu vernichten – Bevölkerung inklusive.
Zurück zum Hauptstrang der Handlung
Derweil hat Juliette ihren heimatlichen Silo 18 auf den Kopf gestellt und ist von der Querdenkerin zur neuen Bürgermeisterin geworden – nachdem sie ungewollt einen Bürgerkrieg ausgelöst hatte, der viele Opfer forderte. Juliette möchte die Dinge zum Besseren wenden, doch stoßen ihre neuen Ideen nicht allseits auf Gegenliebe. Skepsis und Widerstand wachsen – erst recht als Juliette mit dem "blasphemischen" Unternehmen beginnt, einen Tunnel zum benachbarten Silo zu graben.
Die Frage, wie man mit Macht und Verantwortung umzugehen hat und ob Revolutionen immer in Diktaturen umschlagen müssen, gehört zu den zentralen Themen des Romans. Ebenso wie die Dichotomie von alt versus neu und von Chaos (=Leben) versus Kontrolle. Und natürlich die Frage, ob es am Ende so etwas wie Hoffnung gibt.
Was das anbelangt, hat Howey wieder mal die Härte. Erneut drohen alle Anstrengungen in Richtung Verbesserung zunichte gemacht zu werden, wieder stirbt die eine oder andere Hauptfigur, in die man große Hoffnungen gesetzt hatte. Und wenn man sich der Mitte des Romans nähert, bereite man sich auf einen heftigen Schlag in den Magen vor. – Davon mal abgesehen, überrascht Howey auch in diesem Band wieder mit einigen Volten. Sogar zentrale Phänomene der "Silo"-Reihe, die man längst zu kennen glaubte, können hier noch einmal umgedeutet werden.
Figuren zum Mitfiebern
Verblüfft habe ich einige Rezensionen gelesen, in denen Howeys "flache Charaktere" kritisiert wurden. Also ich kann das nicht wirklich bestätigen – meiner Meinung nach macht Howey auf seine typisch unaufgeregte Art einen wirklich guten Job darin, uns die verschiedenen Figuren näherzubringen. Sei es nun Juliette, die ständig von Zweifeln geplagt wird, ob sie für die ihr anvertrauten Menschen das Richtige tut, sei es der von Schuld und Sühne getriebene Donald oder das kleine Mädchen Elise mit seiner ganz eigenen Sicht auf die Welt. Kindliche Logik glaubhaft zu schildern ist nicht einfach – Howey gelingt es.
Insbesondere Jimmy Parker alias "Solo" ist eine Figur, die man einfach ins Herz schließen muss. Eher schlicht gestrickt, wuchs er allein in einem entvölkerten Silo auf – bis er eines Tages dann doch anderen Menschen begegnete und sogar in eine Ersatzvaterrolle für eine Gruppe Kinder gedrängt wurde. Dass er plötzlich in Gesellschaft lebt, hat er noch keineswegs verdaut; seine Überforderung sorgt immer wieder für Komik. Aber Solo gibt sich alle Mühe – und er verkörpert vielleicht mehr als alle anderen Howeys zentrale Aussage: nämlich dass es wichtig ist weiterzumachen.
Fazit zu "Exit" sowie zur ganzen hiermit abgeschlossenen Reihe: rundum gelungen.
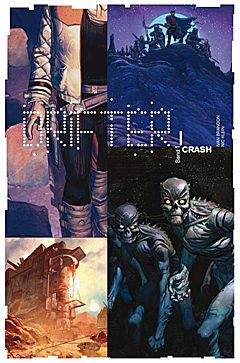
Ivan Brandon & Nic Klein: "Drifter: Crash"
Graphic Novel, gebundene Ausgabe, 128 Seiten, € 25,80, Cross Cult 2015
Wenn bei Romanen gilt, dass der erste Satz die Weichen stellen kann, ob man dem Folgenden mit freudiger Erwartung entgegensieht oder nicht, dann ist das beim ersten Panel eines Comics nicht anders. "Crash", erster Band der "Drifter"-Reihe von Autor Ivan Brandon und Illustrator Nic Klein, beginnt mit einem ganzseitigen Raumschiffabsturz in Azurblau. Und schon bin ich in Stimmung.
Der Drifter
Der auf einer Wüstenwelt bruchgelandete Pilot, ein Raumfahrer mit dem mœbiusischen Namen Abram Pollux, fungiert als Ich-Erzähler – seine inneren Monologe der leicht entrückten Art werden die Stimmung prägen; nicht umsonst heißt die Reihe "Drifter". Zumindest wenn Abram mal zum Nachdenken kommt und ihn nicht gerade die Ereignisse überrollen. Gleich nachdem er sich aus dem Wrack befreit hat, führt er nämlich eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einem blauen Alien. Und unmittelbar danach schießt ihm ein Unbekannter in den Rücken.
Das nächste Mal erwacht Abram in einer Ghost Town genannten Siedlung, die wie ein Westernstädtchen mit SF-Elementen aussieht. Westernmäßig ist auch die anschließende Saloonprügelei und mehr noch der Handlungsfaden um Abrams Wunsch nach Rache an seinem Angreifer. Mit der Pistole in der Hand zieht er auf dessen Spur hinaus in die Wüste – gefolgt vom örtlichen Marshal Lee Carter, die auch die Ärztin von Ghost Town ist. Love is in the air ... naja, vielleicht später einmal. Vorerst sind die beiden noch viel zu knarzig für mehr und eigentlich hilft Lee Abram vor allem deshalb, weil sie sich solche Mühe gegeben hat, ihn wieder zusammenzuflicken. Die ganze Arbeit soll schließlich nicht umsonst gewesen sein. Abrams lakonische Zwischenbilanz nach dem ersten Kapitel: An jenem Ort wurde mir zweimal in den Rücken geschossen, von einem Mann, dessen Namen ich nie erfuhr. Drei Tage lang blieben meine Augen geschlossen, aber mir wurde gesagt, dass ein Jahr vergangen war. Mein Name ist Abram Pollux. Ich bin spät dran und ich brauche eine Waffe.
Zur Struktur
"Drifter" ist episodisch aufgebaut, was vor allem daran liegt, dass es sich eigentlich um eine Serie handelt, deren erste fünf Ausgaben dieser Band umfasst. Das Original erscheint beim US-Verlag Image Comics, dessen KünstlerInnen das Copyright für ihre Werke behalten. Im konkreten Fall sind dies der US-amerikanische Comic-Autor Ivan Brandon ("Viking" sowie diverses bei Marvel und DC) und der deutsche Illustrator Nic Klein, der ebenfalls schon für alle großen US-Verlage gearbeitet hat und dem in der deutschsprachigen Ausgabe natürlich besonderes Interesse gilt. Der Band enthält im Anhang auch ein Interview, in dem Klein von seiner Arbeitsweise erzählt.
Kleins Zeichnungen sind es auch, die "Drifter" zu einem echten Genuss machen: Die beeindruckenden Panoramen, vor allem aber die grandiosen Farbwechsel, da jede Szene bzw. jeder Schauplatz in einen eigenen Grundton getaucht ist. Und US-Verlag hin oder her, für mich sieht der Stil sehr europäisch aus, mit Wurzeln, die – ob beabsichtigt oder nicht – bis in die klassische "Métal hurlant"-Schule zurückreichen. Wie zur Bestätigung prangt auf einem Grabstein in der Wüste der Name "Giraud".
Rätsel über Rätsel
Zu den SF-Highlights der "Drifter"-Episoden zählen unter anderem: Eine Harpunenschießerei mit Plünderern, die an die Sandleute aus "Star Wars" erinnern. Ein bulliges Monster, das in Symbiose mit Blitzen lebt und Menschen frisst. Oder eine Mine, in der der Kot riesiger Würmer/Zecken als Energiequelle abgebaut wird. Und in der man furchterregenden Außerirdischen begegnen kann, die wie Plastinate mit glühenden Augen aussehen. In der Regel ignorieren sie Menschen vollkommen. Sollten sie dich eines Tages aber doch wahrnehmen, ist die Kacke am Dampfen.
Während Abram auf der Suche nach seinem verlorenen Gedächtnis von Seltsamkeit zu Seltsamkeit stolpert, türmen sich die Rätsel immer höher. Warum sind für Abram nur drei Tage seit dem Absturz vergangen, während das Wrack laut Zeugenaussagen seit einem Jahr in der Wüste liegt? Wer ist der schweigsame Wanderer, der Abram erst in den Rücken schoss und ihm später das Leben rettet? Was hat der irre Prediger Arkady auf dem Kerbholz? Und verbirgt sich da hinter der Atemschutzmaske eines Fremden in der Wüste etwa ein Doppelgänger Abrams?
"Drifter: Crash" bedeutet nicht zuletzt über 100 Seiten Exposition für das, was noch kommen wird. Es ist eine SF-Mystery, die vorerst noch keines ihrer Geheimnisse preisgibt und folgerichtig auch mit einem weiteren Rätsel als Cliffhanger endet. Ziemlich beeindruckend, das Ganze – bin gespannt, wie's weitergeht!
Mit der Zeit, mit der Zeit wird aus dem Maulbeerblatt ein Seidenkleid
Die nächste Rundschau ... wird bedeutend schneller kommen als diese Ausgabe, versprochen (urlaubsbedingte Personalknappheit im Ressort, viele Nebenarbeiten und dazu noch die Hugo-Leserei, da bin ich um eine Sommerpause nicht herumgekommen). Vielleicht kommt sie sogar so schnell, dass ich gar keine Rundschau-in-progress verlinken werde wie sonst. Plötzlich ist sie dann einfach da, wie hingebeamt.
P.S.: Ach ja, und das wird jetzt vielleicht nicht allen gefallen: Für die restlichen Rundschauen dieses Jahres wird die Quote englischsprachiger Bücher ein wenig angehoben. Liegt einfach zuviel davon herum bei mir daheim – mehr als auf Deutsch. (Josefson, 5. 9. 2015)