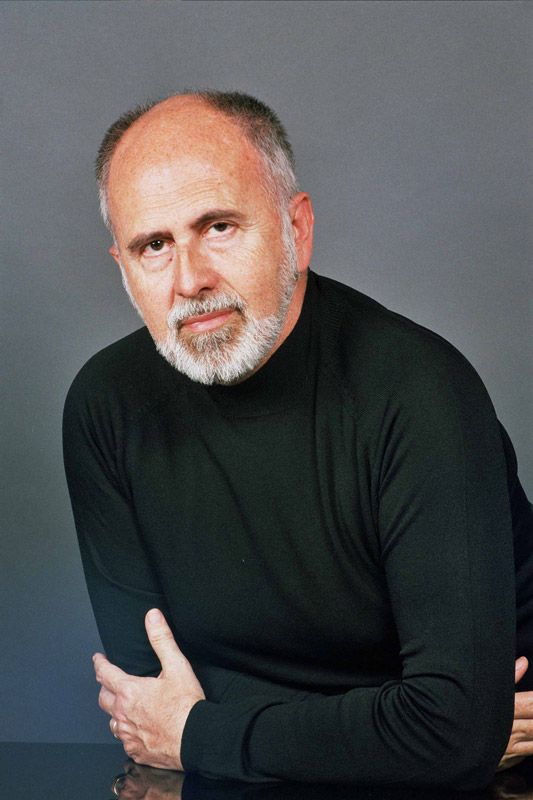STANDARD: Seit drei Jahrzehnten war "Don Pasquale" nicht an der Staatsoper. Wie schwer ist es, das Stück lebendig zu machen?
López-Cobos: Donizetti wollte am Ende eines langen Lebens, nachdem er lange nur tragische Opern geschrieben hatte, nochmals eine komische Oper komponieren. Man erkennt die Erfahrung, die Freude, die er bei der Arbeit hatte. Das Stück ist konzentriert, die Personen sind präzis gezeichnet. Das einzige Problem ist die große Orchestrierung. Eigentlich ist es eine Buffo-Oper mit der Instrumentation einer tragischen Oper - das ist schon eine Herausforderung. Da habe ich viel am Orchestermaterial gearbeitet, um den heiteren Charakter herauszubringen.
Brook: Das Schwierigste im Theater ist der Rhythmus. In der Oper ist er durch die Musik schon mehr oder weniger vorhanden. Das ist für die Regie angenehm. Für mich folgt die Szene dem Klang, aber nicht in der Art einer Verdopplung wie beim klassischen Tanz. Donizetti ist auf natürliche Weise zu inszenieren. Das Stück ist brillant geschrieben, Musik, Text, Handlung passen wunderbar ineinander. Nur das Finale ist etwas zu schnell geschrieben - in den letzten Minuten passieren etwa 20 Geschichten gleichzeitig, man hat fast keine Chance, das alles zu zeigen. Das ist wie eine olympische Disziplin.
STANDARD: Ist Leute zum Lachen zu bringen auch so schwer?
Brook: Wenn ich Komödien inszeniere, kann es nicht meine Intention sein, das Publikum zum Lachen zu bringen. Das merkt man erst in der Aufführung. Ich kann nur Dinge zeigen, über die ich selbst lachen würde. Bei Proben hatten wir jedenfalls viel Spaß.
López-Cobos: Es ist immer viel leichter, eine tragische Oper zu dirigieren als eine Buffo. Sie ist manchmal eine undankbare Aufgabe, da viele glauben, ein Barbiere di Siviglia sei leichter umzusetzen als eine Tosca. Das Gegenteil ist wahr! Das Schöne an diesem Stück ist, dass es sich nicht um eine reine Buffo-Oper handelt. Es sind auch einige traurige Tropfen enthalten, vor allem bei der Figur des Don Pasquale.
STANDARD: Wie viel Freiheit sehen Sie in der Interpretation?
López-Cobos: Das hängt vom Stück, von seinen Problemen ab - ich denke aber schon 30 bis 40 Prozent. Es ist klar, dass niemals alles in der Partitur stehen kann. Wenn ein Stück ein Meisterwerk ist, gibt es noch mehr Möglichkeiten.
STANDARD: Ihr Wiener Lehrer Hans Swarowsky meinte, Werktreue sei zu erzielen, wenn man die Partitur möglichst objektiv wiedergebe, es stehe alles schon in den Noten. Hat Sie das geprägt, inwiefern ist dieser Gedanke hilfreich?
López-Cobos: Für seine Schüler war diese objektive Vision sehr gut. Er hat uns eine solide Basis gegeben - wir konnten uns dann selbst auf sehr unterschiedliche Weise entwickeln. Und: Er war gegen die Show beim Dirigieren! Vor 30 oder 40 Jahren hat man zudem eine Bellini- oder Donizetti-Oper noch ganz anders gespielt. Man hat damals viele Striche gemacht, die Sänger waren nicht bereit, eine Cabaletta (Schlussteil einer mehrteiligen Arie, Anm.) zweimal zu singen. Das hat sich geändert. Heute spielen wir viel authentischer, was die Partituren anbelangt.
STANDARD: Die Freiheit der Regie?
Brook: Ich versuche, mich möglichst wahrhaftig dem Werk und seiner Logik anzunähern. Das hat nichts mit der Entstehungszeit eines Werks oder dem Kontext zu tun, sondern mit den Gefühlen der Menschen, die sich nicht verändert haben. Männer und Frauen sind dieselben geblieben - insofern ist Shakespeare zeitgenössisch. Mir geht es nicht darum, Gags zu finden und die Personen mit Handys herumlaufen zu lassen, sondern um psychologische Fragen, um emotionale Wahrheit - besonders in dieser Oper. Dazu muss man genau hinhören. Es gibt Stellen, da ist der Text komisch, die Musik aber klingt ganz sanft. Will man da den Sinn ergründen, muss man sehr tief graben.
STANDARD: Wie tief kann man denn gehen, wenn man weiß, dass in der nächsten Aufführungsserie die Sänger andere sein werden?
Brook: Daran kann ich gar nicht denken. Manche am Haus haben mich gefragt, warum ich so detailliert arbeite, wenn das nächste Mal andere Sänger auf der Bühne stehen werden. Aber mit solchen Vorstellungen im Kopf wäre es für mich unmöglich zu arbeiten. Man sagt mir auch manchmal, dass man die vielen Details in einem großen Opernhaus gar nicht sehen würde. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass es wirkt, auch wenn man nicht jede Geste sieht. Die Schönheit steckt im Detail.
López-Cobos: Die Staatsoper ist eines der wenigen großen Repertoiretheater. Davon gibt es immer weniger. Ich war lange in Berlin und habe kürzlich bemerkt, dass es sich dort schon etwas geändert hat. Ich finde es großartig, dass man hier in Wien 40 Stücke pro Jahr spielt, trotz aller Probleme, die das etwa für die Einteilung der Proben mit sich bringt. Hier spürt man noch einen ganz starken Ensemblegeist - wunderbar. (Daniel Ender, DER STANDARD, 25.4.2015)