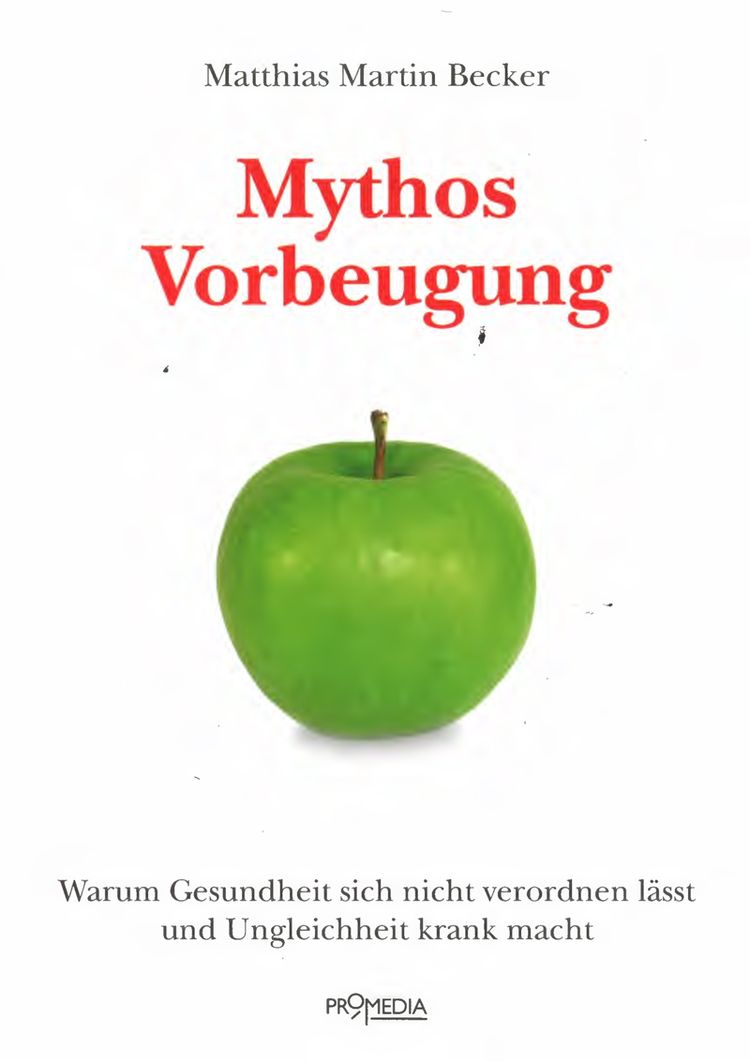
"An apple a day keeps the doctor away": Mehr als gesunde Ernährung bestimmt die soziale Herkunft, ob man gesund bleibt, schreibt Matthias Martin Becker.
Gesunde Ernährung, nicht rauchen, viel Bewegung, wenig Stress und regelmäßig zum Arzt: So klingt die Anleitung für ein gesundes und langes Leben. Die Wirkung des Lebensstils auf die Gesundheit des Menschen ist gut belegt – und wird maßlos überschätzt. Das zeigt die Sozialmedizin sehr klar: So wird die vermeidbare Sterblichkeit eines Menschen gerade einmal zu zehn Prozent von seinem Lebensstil beeinflusst. Den Rest erledigen gesellschaftliche Faktoren.
Wer gut verdient, gebildet ist, über eine befriedigende Job- und Wohnsituation und ein stabiles soziales Netzwerk verfügt, wird nachweislich seltener krank. Wer Stress regelmäßig abbauen kann und die Erfahrung macht, dass er sein Leben durch eigenes Handeln positiv beeinflussen kann, bleibt eher gesund.
Arme Raucher sterben früher als reiche
Doch die Gesundheitspolitik appelliert vor allem an die Eigenverantwortung, wenn es um Gesundheit geht – an den Beitrag jedes Einzelnen zu seinem körperlichen Wohlergehen. Und natürlich beeinflusst das Verhalten die Gesundheit: Studien belegen, wie schädlich Rauchen und cholesterinreiche Kost sind, wie schnell chronischer Schlafmangel dem Körper zusetzt, wie wichtig Bewegung ist. Die Faktenlage ist derart erdrückend, dass kaum jemand auf die Idee kommt, dass es da noch etwas geben könnte: Dass sich dasselbe Verhalten auf unterschiedliche Menschen unterschiedlich auswirken kann – abhängig von der jeweiligen Lebensrealität. Es gibt keinen neutralen Effekt, der auf alle Menschen gleich wirkt.
Nehmen wir die Zigaretten: Arme Raucher sterben früher als reiche Raucher – bei gleichem Zigarettenkonsum. Rauchen ist für den schlecht bezahlten Straßenarbeiter, der an einer verkehrsreichen Straße wohnt und ständig Feinstaub einatmet, schädlicher als für den Büroangestellten, der am Wochenende mit Freunden in den Bergen wandert.
Oder Alkohol: Dem einsamen Trinker, der rauchend und verloren in der Eckkneipe hockt, setzt Alkohol mehr zu als dem gut situierten Gesellschaftstrinker, der in freundschaftlicher Runde gerne das Glas mit dem edlen Tropfen hebt.
Was stärkt, was schwächt
Freundschaft und soziale Kontakte stärken nachweislich den menschlichen Organismus. Genau wie das Wissen, gehört zu werden und das eigene Leben aktiv gestalten zu können. Dagegen schwächen Einsamkeit und das Gefühl, ausgeschlossen und isoliert zu sein, das Immunsystem.
"Einer der wichtigsten Faktoren für die Berechnung der Lebenserwartung ist die Postleitzahl", schreiben die US-Gesundheitswissenschafter David Stuckler und Sanjay Basu. In London werden Menschen in den wohlhabendsten Gegenden im Durchschnitt um 17 Jahre älter als Bewohner der ärmsten Viertel. "Man kann einen Menschen mit einer feuchten Wohnung genauso töten wie mit einer Axt", notierte der Zeichner und Satiriker Heinrich Zille zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Der deutsche Wissenschaftsjournalist Matthias Martin Becker zitiert Zille in seinem nun im Promedia-Verlag erschienenen Buch "Mythos Vorbeugung. Warum Gesundheit sich nicht verordnen lässt und Ungleichheit krank macht". Becker zeigt beispielreich, wie Gesundheitskampagnen heute an die Selbstverantwortung appellieren, die Lebensrealität der Menschen aber oft ausblenden.
Initiativen für mehr Sport und weniger Salz seien sinnlos, wenn Menschen keine Chance auf bessere Lebensumstände haben. Die schichtarbeitende Alleinerzieherin, die sich mit Zigaretten beruhigt, mit Energy Drinks wach hält und nach einem 14-Stunden-Tag mit Salamipizza und Bier belohnt, wird Appelle an die Selbstverantwortung vielleicht hören, aber kaum umsetzen können. Doch die Solidargemeinschaft baue heute auf die Selbstverantwortung des Einzelnen, schreibt Becker – daher gelte jeder, der sich nicht um sich kümmert, als ein klein wenig asozial. Wer nicht anders kann, kann sich auch noch anhören, auf Kosten der Allgemeinheit zu leben.
Ungleichheit macht krank
Becker verknüpft in seinem profund recherchierten und faktenreichen Band die historische Entwicklung der Sozialmedizin mit neuesten Studienergebnissen zum Einfluss von Prävention und sozialer Herkunft auf die Gesundheit. Der Text ist übervoll von interessanten Details und ist streckenweise fast zu dicht geraten.
Der Autor erklärt, warum schwierige Lebensumstände krank machen: Weil Prekarität und die fehlende Möglichkeit, Belastungen abzubauen, zu chronischem Stress führen. Der wiederum behindert die Immunantwort im Körper und kann chronische Krankheiten begünstigen. Bronchitis, Bluthochdruck, Magenkrebs – fast alle Krankheiten sind in der untersten Einkommensgruppe doppelt bis dreimal so häufig wie in der obersten.
"Besonders schädlich sind permanente Besorgnis, kein Nachlassen der Anforderungen, keine Erfolgserlebnisse und Gefühle von Machtlosigkeit", schreibt Becker. Existenzieller Stress und die Möglichkeit zu seiner Bewältigung sind in der Bevölkerung aber höchst ungleich verteilt: Der soziale Unterschied findet sich bei praktisch allen Erkrankungen.
Wie die Sozialversicherung "wirkt"
Auch die Einführung des allgemeinen Sozialversicherungssystems in den westlichen Sozialstaaten konnte die gesundheitlichen Chancen zwischen "oben" und "unten" nicht gänzlich ausgleichen. Obwohl es der Allgemeinheit insgesamt besser geht als in früheren Jahrzehnten, behaupten die oberen Klassen bis heute ihren Vorsprung – und bauen ihn weiter aus: Während die meisten Staaten seit der Wirtschaftskrise am Sozialsystem sparen, floriert die Privatmedizin. Die Zwei-Klassen-Medizin ist längst Realität, das Dogma der Selbstverantwortung hat den Boden für die Privatisierung von Gesundheit bereitet.
Es ist übrigens nicht nur absolute Armut, die krank macht, sondern auch relative Armut – als Folge von Ungleichheit bei der Einkommens- und Vermögensverteilung in einer Gesellschaft. "Ein armer Mensch in Österreich verfügt über einen Fernseher, einen Kühlschrank, seine Zahnschmerzen werden behandelt", schreibt Becker in seinem Buch. "Er verfügt also über einen materiellen Reichtum, der für die meisten Togolesen traumhaft erscheint. Dennoch schadet dem Österreicher seine relative Armut." (Lisa Mayr, DER STANDARD, 19.11.2014)