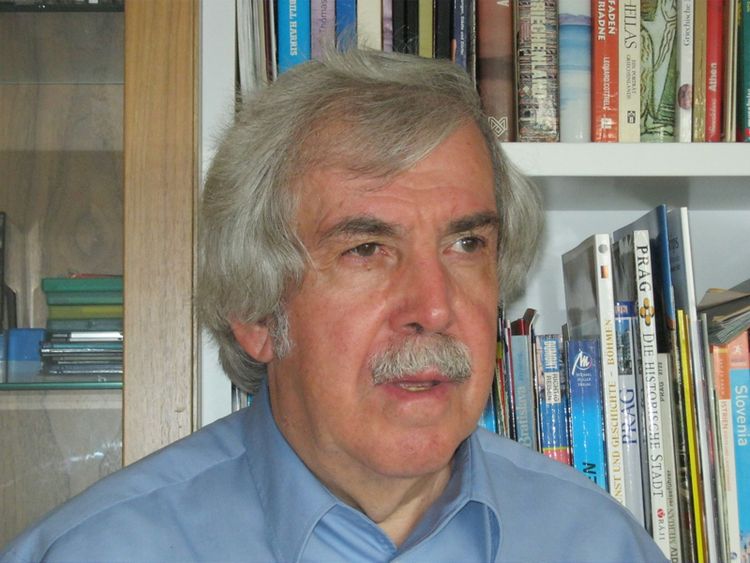
"Das Problem bei der Diagnostik von Seltenen Erkrankungen: Es gibt wirklich sehr viele", sagt Kinderarzt Franz Waldhauser.
STANDARD: Wie oft sehen Kinderärzte Patienten und können Symptome nicht zuordnen?
Waldhauser: Dazu gibt es offiziell keine Zahlen. Nur eine generelle Statistik. In Österreich gibt es 6.000 bis 7.000 Erkrankungen, von denen jede jährlich fünf bis sieben Mal oder auch noch seltener auftritt. Dies über das ganze Land verteilt. Die meisten Ärzte sehen eine bestimmte dieser Erkrankungen höchstens ein bis zwei Mal im Leben und haben somit keine Erfahrung im Erkennen und Therapieren einer bestimmten dieser Erkrankungen. Die Folge: Patienten bekommen jahrelang keine Diagnose und keine Therapie. Ein Großteil der Erkrankungen hat genetische Ursachen, aber nicht alle. Wir Kinderärzte sind deshalb oft die ersten, die mit Patienten mit Orphan Diseases, wie sie auch genannt werden, konfrontiert sind. Insgesamt sind davon 400.000 Menschen in Österreich betroffen. Das ist nicht wenig.
STANDARD: Wie sieht die "Karriere" von Patienten mit Seltenen Erkrankungen denn aus?
Waldhauser: So unterschiedlich die Erkrankungen sind, so charakteristisch ist das Schicksal. Wenn ein Kinderarzt nicht weiter weiß, versucht er Symptome zu ergründen, überweist dann zu einem anderen Spezialisten. Dort gehen die Untersuchungen weiter. Ein Ärzte-Hopping beginnt. Kein Arzt weiß Genaues, das ist für die Eltern solcher Kinder sehr schwierig. Denn ohne Diagnose gibt es ja auch keine Therapie.
STANDARD: Irgendwann kommen sie dann aber wohl auch an die Uniklinik, oder?
Waldhauser: Schon, ich habe 35 Jahre dort gearbeitet und wir hatten solche Kinder, bei denen wir einfach nicht wussten, was los ist. Das Problem bei der Diagnostik von Seltenen Erkrankungen: Es gibt wirklich sehr viele. Viele davon haben wir auf der Klinik auch noch nie gesehen. Eine zusätzliche Schwierigkeit kommt dazu: Ein und dieselbe Erkrankung kann ganz unterschiedliche Symptome haben. Das ist wie Detektivarbeit.
STANDARD: Warum macht man nicht gleich eine Gen-Sequenzierung?
Waldhauser: Weil nicht alle genetisch bedingt sind, etwa Kinder die als Frühgeburten unter 1000 Gramm auf die Welt kommen und dann an den Folgen laborieren. Wenn man eine Gen-Analyse erwägt, dann muss man erst einmal eine Idee haben, wo das Problem liegt. Nur dann weiß man auch, welche Gen-Abschnitte man genauer betrachten muss. Eine Gensequenzierung ohne konkreten Verdacht bringt nichts. Zusätzlich braucht man Speziallabors. Für Menschen, die fern von universitären Zentren leben, ist so etwas auch logistisch eine große Herausforderung.
STANDARD: Hat sich die Situation nicht durch das Internet verbessert?
Waldhauser: Sicherlich. Nur wir wissen alle, was passiert, wenn wir bei Krankheiten zu googlen beginnen. Die eigene Betroffenheit verstellt einem den objektiven Blick. Wie sollte sich ein Laie durch ein paar tausend Erkrankungen ackern. Die Gefahr, in Panik zu geraten, ist groß. Vielleicht schaffen das Akademiker, Leute mit niedrigerem Bildungsstand sind aber schnell überfordert.
STANDARD: Was sollte besser werden?
Waldhauser: Wir von der Politischen Kindermedizin setzen uns dafür ein, dass Zentren geschaffen werden. Derzeit ist es ja so, dass Kliniken meistens alles zu machen versuchen. Wir sehen die Zukunft in der Schwerpunktsetzung. Bei unserem föderalistisch organisierten Gesundheitssystem ist das sehr schwierig. Keiner will da etwas abgeben. Doch die Schweizer haben das auch geschafft – und dort gibt es 26 Kantone! Auf der Tagung in Salzburg wollen wir über landes- und europaweite Vernetzung sprechen, auch über die Grenzen blicken und schauen, wie andere Länder die Versorgung von Seltenen Erkrankungen bereits geregelt haben. Schließlich sind auch internationale Netzwerke bei Seltenen Erkrankungen wichtig.
STANDARD: Können Sie ein Beispiel geben?
Waldhauser: Es muss eine Stelle geben, die weiß, wo in Österreich eine bestimmte, seltene Erkrankung behandelt wird. Alle würden davon profitieren. Das Spital: Jeder Fall erweitert die Expertise. Die Patienten: Weil ihnen diese Expertise zugutekommt. Dafür nimmt man als betroffene Familie auch Anreisen in Kauf, denke ich. Es gibt auch schon einen nationalen Aktionsplan. Wir warten, dass er umgesetzt wird.
STANDARD: Wer sträubt sich?
Waldhauser: Die Errichtung von Kompetenzzentren sind immer eine Mischung aus Politikum und Fachkompetenz. Beide Seiten waren bei den Verhandlungen dabei. Till Voigtländer, der medizinische Leiter der Nationalen Koordinationsstelle für seltene Erkrankungen in der Gesundheit Österreich (GÖG), wird in Salzburg berichten.
STANDARD: Wo hat diese Spezialisierung bereits gut funktioniert?
Waldhauser: In der Kinderonkologie. Auf Leukämie ist etwa das St. Anna Kinderspital besonders spezialisiert - dort haben wir die geringsten Sterberaten europaweit. Der Grund dafür ist die Kompetenz und die Erfahrung, die dort gebündelt sind. Das ist ein Paradebeispiel mit Vorbildwirkung.
STANDARD: Welche Baustellen fallen Ihnen spontan bei Seltenen Erkrankungen ein?
Waldhauser: Lebertransplantationen bei Kindern. Es gibt eine Reihe von Erkrankungen, die eine solch schwere Operation erfordern. Das können nicht alle Chirurgen machen, ein Kompetenzzentrum wäre wichtig. Ich habe mich in meiner beruflichen Erfahrung im AKH Wien mit Intersex-Kindern befasst, also Kinder, bei denen das Geschlecht nicht eindeutig ausgeprägt ist. Da gibt es fünf bis zehn Patienten pro Jahr in Österreich. Es wäre doch gut, eine Anlaufstelle für sie zu schaffen.
STANDARD: Warum haben, von allen Seltenen Erkrankungen, die Schmetterlingskinder so eine gute Anlaufstelle in Österreich?
Waldhauser: Ja, weil ein betroffener Vater eines Kindes hier grandiose Arbeit geleistet hat und sein Leben dieser Aufgabe gewidmet hat. Doch solche Initiativen können wir nicht von anderen betroffenen Eltern verlangen, die ohnehin durch die Erkrankung ihres Kindes schwer belastet sind. (Karin Pollack, derStandard.at, 31.10.2014)