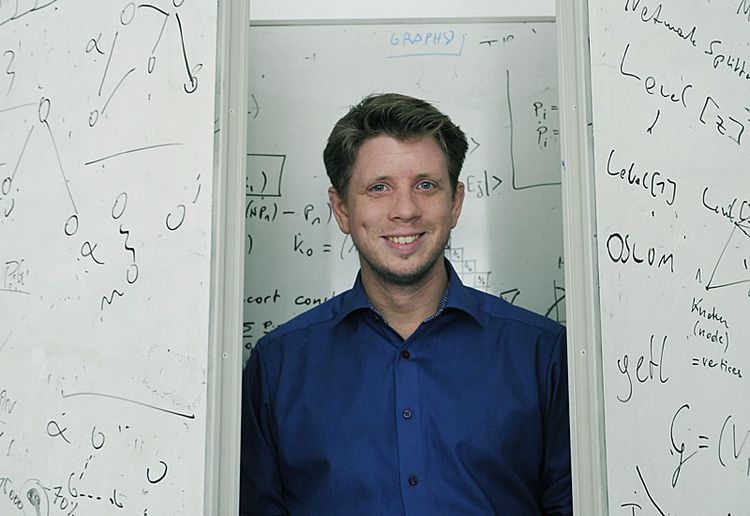
Der gelernte Physiker Peter Klimek versucht mit mathematischen Modellen komplexe Zusammenhänge zu verstehen.
STANDARD: Welchen Ansatz verfolgen Komplexitätsforscher bei der Analyse von Krankheitsverläufen?
Klimek: Wir wollen verstehen, wie Krankheiten entstehen und wie sie sich ausbreiten können. Dabei gehen wir von mehreren Netzwerken aus, die ihre Funktion nicht erfüllen. Nehmen wir das Beispiel Ebola: Das Virus schleust seine DNA in das Netzwerk der Zellen, in ein System von 25.000 Genen beim Menschen, und verändert die Abläufe. Menschen werden krank. Da die Krankheit ansteckend ist, ist es wichtig, auch das soziale Netzwerk der Patienten zu verstehen. Wen kennen sie, mit wem sind sie in Kontakt? Und dann muss man auch noch begreifen, wie die Transportnetze funktionieren. Durch welche Flugverbindungen kann sich die Krankheit weltweit ausbreiten? Wie lange dauert es, bis auch außerhalb der Seuchenregion Krankheitsfälle auftreten? Wenn man für eine Computersimulation dazu Daten von Epidemien wie Sars oder H1N1 heranzieht, ergibt sich ein Muster.
STANDARD: Geben Komplexitätsforscher auch Empfehlungen ab, um diese Szenarien zu verhindern?
Klimek: In besonderen Fällen ja. Wir arbeiten mit den Daten und ziehen unsere Schlussfolgerungen daraus. Die Interpretationsmöglichkeiten für Präventionsstrategien liegen bei den Auftraggebern solcher Datenanalysen. Im Fall der Ebola-Seuche analysiert die Weltgesundheitsorganisation WHO laufend derartige Szenarien mittels Computersimulationen und trifft sicher auch die Maßnahmen, um das zu verhindern. Ebola ist aber nur ein Beispiel. Man kann derartige Analysen auch auf andere Krankheiten anwenden, zum Beispiel auf die Entstehung von Diabetes oder Krebs.
STANDARD: Ist das Institut für die Wissenschaft komplexer Systeme, dem Sie angehören, an ähnlichen Analysen beteiligt?
Klimek: Ja. Wir haben Studien über epigenetische Einflüsse bei Diabetes durchgeführt - zum Beispiel über die Häufigkeit von Diabetes bei den Geburtsjahrgängen 1940, 1944 und 1945. Da gibt es deutliche Unterschiede. Der Jahrgang 1945 hat ein doppelt so hohes Risiko, krank zu werden.
STANDARD: Warum?
Klimek: 1945 herrschte hierzulande eine Hungersnot - wie auch am Ende des Ersten Weltkriegs 1917/1918 und in den Zeiten der großen Wirtschaftsdepression in den 1930er-Jahren. Auch schwangere Frauen hatten Hunger, weshalb die ungeborenen Kinder daran gewöhnt wurden, wenig Nährstoffe zu bekommen. Man spricht hier von fetaler Programmierung der Ungeborenen. Als sie auf die Welt kamen, war die Hungersnot vorbei, aber ihr Stoffwechsel in vielen Fällen nicht in der Lage, dieses überraschende Angebot zu verarbeiten. Wir analysieren aber auch, wie Diabetes mit anderen Krankheiten zusammenhängt - zum Beispiel mit Depressionen. Da gibt es deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber auch zwischen Typ-1- und Typ-2-Diabetikern. Frauen sind da statistisch anfälliger.
STANDARD: Wie kommen Sie zu den Daten?
Klimek: Es handelt sich dabei um einen Forschungsdatensatz des österreichischen Hauptverbandes. Man kann über das Abrechnungsdatum von Krankenkassen den Gesundheitszustand einer Bevölkerung ablesen. Wann immer Sie zum Arzt gehen, in die Apotheke oder ins Krankenhaus kommen: Es wird verbucht. Der österreichische Hauptverband wacht über diese Forschungsdaten, wir nützen unsere Modelle, um sie interpretieren zu können.
STANDARD: Beschäftigt Sie dabei die Kritik von Datenschützern und die Fragen, wem eigentlich die Daten über Patienten gehören?
Klimek: Natürlich ist das ein wesentliches Thema. Die Daten sind aber vollkommen anonymisiert. Wir wollen mit unseren Arbeiten aufzeigen, dass die Ergebnisse dieser Forschung der gesamten Bevölkerung zugutekommen. Man kann ja so auch Risiken abschätzen und in der Bevölkerung mit Vorsorge gegensteuern. Wenn man weiß, dass Frauen mit Diabetes nach zwanzig Jahren der Erkrankung eher zu Depressionen neigen, kann das auch helfen, diese Patienten davor zu bewahren. Damit wollen wir dazu beitragen, einen Grundkonsens in der Bevölkerung herzustellen, inwiefern solche Daten zum Wohle aller verwendet werden können.
STANDARD: Aber reichen Daten aus, um zu einem derartigen Ergebnis in der Analyse zu kommen?
Klimek: Ich zitiere da gerne einen Satz des ehemaligen Präsidenten des Santa Fe Institutes, Geoffrey West: "Big data withouth big theory is bullshit." Das heißt: Man muss schon von einer Annahme ausgehen, sonst weiß man selbstverständlich nicht, wo man bei der Simulation von Daten ansetzen soll. Ein Kollege aus Russland hat uns einmal gebeten, die Wahlergebnisse zu analysieren. Er war besorgt um die Demokratie und nahm an, dass in vielen Bezirken gefälschte Stimmen für das Vereinte Russland zugefügt wurden. Wir entwickelten ein mathematisches Modell und kamen zum Schluss, dass die Wahlbeteiligung dort besonders hoch war, wo besonders viele Stimmen für Wladimir Putin abgegeben wurden. Das lässt die Vermutung zu, dass seine Annahme stimmte. Wir haben dann das Modell auf aller Herren Länder angewandt und fanden für Uganda ganz ähnliche Ergebnisse. Das sind dann schon Momente, in denen wir Aha-Erlebnisse haben. (Peter Illetschko, DER STANDARD, 3.9.2014)