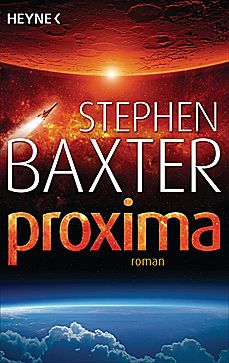
Stephen Baxter: "Proxima"
Broschiert, 669 Seiten, € 11,30, Heyne 2014 (Original: "Proxima", 2013)
Kaum ein Science-Fiction-Autor ist in seinem Werk so weit in Raum und Zeit vorgedrungen wie der Brite Stephen Baxter. Und keiner so oft. Wenn er sich in seinem jüngsten Roman auf einen Flug zu unserem direkten Nachbarstern Proxima Centauri beschränkt, dann wirkt das wie die Baxter'sche Variante der modernen "Wir backen kleinere Brötchen"-Space-Opera unserer Tage. Die beschränkt sich überhaupt gleich auf unser Sonnensystem. Ganz kann er's dann aber doch nicht lassen: Was für Baxter-Neulinge wie ein Twist kommen mag, wird Altfans vermutlich weniger überraschen. Nämlich dass der Roman doch noch einen Drall in größere Dimensionen bekommt. Es lassen sich ein paar Anklänge an frühere Baxter-Reihen wie "Multiversum", "Die Zeit-Verschwörung" und "Zeitodyssee" feststellen, aber mehr will ich dazu nicht verraten.
Angesiedelt ist der Roman zunächst in den 2060er Jahren und arbeitet sich dann mit einem größeren Figurenpool ein halbes Jahrhundert in die Zukunft vor; aufgemacht wird er an der Reise eines Raumschiffs, das 200 KolonistInnen zum Proxima-System bringt. Und als würden Proxima und Alpha Centauri nicht schon retro genug klingen, heißt das Schiff auch noch "Ad Astra" und es taucht sogar ein Raumfahrer mit dem herrlichen Namen Lex McGregor auf ... Baxter scheint uns direkt ins Golden Age of Science Fiction zurückführen zu wollen.
Per ardua ad astra
Aber nix da. Die Fährte ist eine falsche, wie uns erste Einblicke in die Gesellschaft des späten 21. Jahrhunderts rasch zeigen. Denn die Menschen an Bord sind keineswegs von Pioniergeist erfüllt. Sie wurden "ausgehoben", enteignet und an Bord verfrachtet, damit sich die westliche Hälfte der Welt den neuentdeckten Exoplaneten unter den Nagel reißen kann, ehe es China tut. Als sie nach dreieinhalb Jahren Reise schließlich das Proxima-System erreichen, ist dies daher kein hehrer Moment - stattdessen bricht ein Aufstand los. Und die PionierInnen in spe betreten ihre neue Heimat in Handschellen.
Die Kolonisierung des mit einem originell beschriebenen Ökosystem versehenen Planeten ist ebenfalls keine Heldengeschichte. Aufgeteilt auf genetisch optimale Kleingruppen müssen sich die unfreiwilligen KolonistInnen fürderhin auf Steinzeitniveau durchgfretten.
Es war alles fabelhaft - zugleich aber auch irgendwie erstaunlich öde. So beschreibt es die Hauptfigur dieses Handlungsstrangs, Yuri Eden. Ein Sturkopf, von dem ich viel später im Roman überrascht gelesen habe, dass er zu Beginn etwa Anfang 20 gewesen sein muss (liest sich nicht so). Die Gruppe um Yuri ist wegen diverser Streitigkeiten rasch von 14 auf zwei zusammengeschrumpft, ohne ein einziges Kind gezeugt zu haben - soviel zu den Kolonisierungsplänen. In sarkastischer Ergänzung des Namens ihres wieder davongeflogenen Raumschiffs nennen sie den Planeten übrigens Per Ardua.
We don't need another hero
Yuri ist gleich mehrfach aus seinem ursprünglichen Leben herausgerissen worden, denn vor seinem interstellaren Abenteuer lag er jahrzehntelang im Kälteschlaf. Er stammt also aus der mittlerweile angefeindeten Heldengeneration, die all das vollbracht hat, was man klassischem SF-Pioniergeist so zuschreibt: Raumfahrt, Konstruktion von Mega-Infrastrukturen und anderen technischen Wundern, Verlängerung des Lebens und Künstliche Intelligenzen.
Zur Handlungszeit sieht man das alles nicht mehr so gern, am wenigsten die KIs. Allerdings muss man nolens volens hinnehmen, dass man sich den Planeten inzwischen mit drei Mega-KIs teilt, die sich in Bunkern tief unter der Erdoberfläche geschützt haben und in der Politik durchaus mitmischen. Eben wegen solcher brisanter Erbstücke gilt "Held" nun als Schimpfwort.
Da kann es nicht verwundern, wenn eine weitere Hauptfigur nicht nur eine KI ist, sondern auch noch den Pioniergeist viel stärker "verkörpert" als alle Menschen zusammen. Angelia wird - mit einem langsameren Antrieb als Yuris Mission - nach Proxima vorausgeschickt. Sie ist optimistisch, aufgeschlossen, flexibel und voller Tatendrang, kurz: so, wie man sich eine echte Pionierin vorstellt. Da darf von digitaler Seite aus also durchaus berechtigt gegen den Fleisch-und-Blut-Humanismus geätzt werden, den die Post-Helden-Generation an den Tag legt. Deren Motto lautet: "Wenn es darum geht, die Hand nach einer neuen Welt auszustrecken, kommt es auf echte, physische menschliche Präsenz an. Eine KI wie dich hinzuschicken zählt nicht." Schön, wenn man als empfindungsfähiges Wesen solche Abschiedsworte mit auf den Weg bekommt. Und Angelia wird auf ihrer interstellaren Reise erst noch merken, welch unmenschliche (oder vielleicht besser lebensverachtende) Seiten ihre Mission wirklich hat.
Ziemlich viel auf einmal
"Proxima" ist ein typischer Baxter. Das heißt zunächst mal, dass die Wissenschaft nicht nur eine wichtige Rolle spielt, sondern im Wesentlichen auch passt. Zumindest in der Astronomie hält sich Baxter offenbar stets auf dem Laufenden - so ist z.B. die Idee, dass auch Rote Zwerge wie Proxima Centauri lebensfreundliche Planeten haben könnten, erst in den vergangenen zwei Jahren aufgekommen. Das verknüpfe man dann mit der Chronologie einer planetaren Kolonisierung und besagter Umkehrung des Heldenbegriffs samt deren politischen Implikationen - schon hat man reichlich Stoff für einen Roman.
Wobei es allerdings nicht bleibt. Da wäre ja auch noch die wachsende Kriegsgefahr zwischen dem westlichen Teil der Welt und China. Und nicht nur eine, sondern gleich zwei Expeditionen, die Yuris Mission vorausgeschickt wurden: Die von Angelia und eine noch frühere, für die sich ein einzelner Mann auf eine jahrzehntelange Reise zum Proxima-Planeten hatte schießen lassen; eine ziemliche Wahnsinnstat eigentlich. Die Frage, ob und wann und unter welchen Umständen die Angehörigen dieser drei Missionen schließlich aufeinandertreffen werden, sorgt ebenfalls für Spannung.
Aber das ist IMMER NOCH NICHT alles. Denn da gibt es auch noch die mysteriösen Kernels, die auf dem Merkur gefunden wurden: unerschöpfliche Energiequellen, die den neuen Sternenschiffen der Menschen überhaupt erst ihre hohe Geschwindigkeit ermöglichen. Diese Kernels sind möglicherweise die Hinterlassenschaft von Aliens - was, einmal mehr, Erzählstoff genug böte. Doch ihre Erforschung wird in ein ganz anderes, noch größeres und erfreulicherweise völlig unerwartetes weiteres Rätsel münden: Man stelle sich auf eine große Überraschung ein. Baxter hat sich echt was einfallen lassen! Vielleicht aber auch ein kleines bisschen zuviel.
Ad ultimo
Denn am Ende sehen wir betroffen das Wurmloch zu und alle Fragen offen. Oder so. Dass hier nicht mehr alles geklärt werden wird, zeichnet sich spätestens im letzten Drittel des Buchs ab, wenn Baxter eher immer neue Fässer aufmacht, anstatt auf eines mal den Deckel draufzunageln. Aber verzaget nicht: Die Fortsetzung "Ultima" erscheint - zumindest in der Originalfassung - bereits Ende November.
P.S.: An einer Stelle gibt es übrigens einen indirekten Österreich-Bezug. Und womit sind wir der Nachwelt wohl in Erinnerung geblieben? Mit Josef Fritzl. Brrrrrr.

Jack Skillingstead: "Life on the Preservation"
Broschiert, 405 Seiten, Solaris Books 2014
Nicht vom Cover täuschen lassen - dies ist kein Young-Adult-Roman; und daran ändern auch die beiden jungen Hauptfiguren nichts. Dafür orientiert sich "Life on the Preservation" denn doch zu sehr an Philip K. Dick'schen Existenzfragen, um als reines Abenteuer mit Feelgood-Faktor rüberzukommen. Abgesehen davon haben einige eher verbiesterte LeserInnen noch einen weiteren Grund gefunden, warum es nicht YA sein kann: Es kommt (ein bisschen) Sex drin vor. Warum sie das als Grund ansehen, ein Buch lieber nicht lesen zu wollen, erschließt sich mir zwar auf die Schnelle nicht, aber bitte.
Seattle ist der Schauplatz der Handlung, und dort ist es auch, wo Autor Jack Skillingstead lebt: Ein relativ spätberufener Schriftsteller, der mit knapp 60 erst seinen zweiten Roman vorgelegt hat - ganz im Gegensatz zu seiner Ehefrau, der beliebten und hochproduktiven SF-Autorin Nancy Kress. Während Kress seit den späten 70ern aktiv ist, veröffentlichte Skillingstead erst ab 2003 seine ersten Kurzgeschichten. Auf einer davon, erschienen 2006, basiert dieser Roman.
Und täglich stirbt das Murmeltier
Wir schreiben den 5. Oktober 2012, und den schreiben wir jeden Tag. Es ist stets das gleiche Datum, wenn der 22-jährige Ian Palmer unter ungefähr denselben Umständen zuhause erwacht, sich seinen ersten Kaffee braut und bald darauf einen Anruf von seinem Kumpel Zach erhält. Zach glaubt etwas auf der Spur zu sein: Er erzählt Ian von einem mysteriösen Boogeyman, den er immer wieder in den Straßen zu sehen glaubt - und überhaupt stimme mit der Stadt und ihren Menschen etwas nicht. Alles wiederhole sich, alles sei eine einzige Illusion, wie in "Matrix" oder "Dark City". Das klingt für Ian erst mal fantastisch - allerdings glaubt auch er ständig von einem Déjà-vu-Erlebnis ins nächste zu stolpern. Und die Graffiti, die er nachts heimlich unter seinem Tagger-Namen WHO gesprüht hat, scheinen ihm nun eine Bedeutung zu enthalten, die er nicht mehr ganz versteht.
Um zu testen, ob sein Seattle real oder doch eine Illusion ist, beschließt Ian eines Tages, über die Stadtgrenze hinauszufahren. Und erlebt dies: Then everything changed. Silence enclosed him, and the space was saturated in yellow and emerald light. Ian hung in the void, able to move his limbs but without effect, like a stranded astronaut. (...) Distance and dimension became meaningless. As his eyes adjusted he perceived that his green-yellow universe swarmed with the detritus of a vanished world. Cars, planes, boats, people and animals - all of them propelled outward as if in a very slow and controlled explosion. Ian stirbt. Und am nächsten Tag ist für ihn alles wieder so wie immer.
Anderswo in der Stadt erleben wir derweil noch einen weiteren Tod mit. Für den Selbstmörder Charles Noble wird danach jedoch nicht alles wie zuvor sein: Eine Entität namens Curator nistet sich in seinem Körper ein - Skillingstead beschreibt dies aber nicht wie einen Parasitenbefall. Es ist eher so, dass aus der Synthese der beiden Persönlichkeiten eine neue entsteht. Und aus ihrer erweiterten Perspektive kann uns der Autor ein paar Begriffe vor die Füße werfen, die zur Lösung des Geheimnisses von Seattle gehören - es ohne Erklärung des Kontextes zunächst aber natürlich noch vergrößern: Cloud. Preservation city. Hunters.
Draußen in der Ödnis
Soweit Handlungsebene 1, die Stadt. Im nahegelegenen Oakdale hingegen schreiben wir zur selben Zeit längst schon 2013. Oakdale ist einer der wenigen Orte, an denen noch Menschen leben, nachdem Aliens die Erde verwüstet haben. Die paar Überlebenden sind allesamt verseucht und unfruchtbar - bis auf die 18-jährige Kylie. Die Nachstellungen eines irren Predigers zwingen Kylie jedoch zur Flucht. Father Jim ist nebenbei bemerkt eine klassische Bösewicht-Kombination aus Selbsthass, verkorkster Sexualität und Gewaltbereitschaft - recht interessant insofern, wie sich sein Zusammenspiel mit Kylie später noch entwickeln wird. Erst mal ist aber Flucht angesagt - hinaus in die verseuchte Wüste, durch die sonst nur noch verstreute "SABs" stolpern (die skin-and-bone-people: optisch Zombies ähnlich, aber ohne jeden Beißtrieb).
"Life on the Preservation" setzt also auf eine erzählerische Doppelstrategie: Mehr oder weniger handelsübliche Postapokalypse-Action zum einen (Alles hin, hin, hin + Menschen jagen Menschen). Das Ringen mit der Realität und der eigenen Identität zum anderen. Die vom Grundprinzip her sehr unterschiedlichen Plots zeigen dabei durchaus Parallelen: Wenn Kylie zum wiederholten Mal aus einer Bredouille entkommt, nur um Father Jim und dessen Schergen gleich wieder in die Falle zu gehen, dann mag das für sich genommen nach einem überstrapazierten Handlungsmuster aussehen. Andererseits spiegelt es die unendlich frustrierenden Versuche Ians und Zachs wider, dem Geheimnis von Seattle auf die Spur zu kommen ... nur um stets wieder auf "Los" zurückgeworfen zu werden.
Skillingstead durchbricht hier das übliche Dystopie-Muster: Das lässt auf geistiges Erwachen stets das Wachbleiben, verbunden mit einer Konfrontation mit dem System, folgen. Hier jedoch ist der Ablauf nicht so linear. Fortschritte werden gemacht ... und immer wieder von zermürbenden Rückschlägen gefolgt. Mehr als einmal wachen Ian und/oder Zach auf und haben keine Ahnung mehr, dass ihre Welt nicht das ist, was sie zu sein vorgibt. Bis der nächste kleine Realitätsbruch sie wieder ins Grübeln bringt.
Philip K. Dick lässt grüßen
Skillingstead versteht es sehr gut, die große existenzielle Unsicherheit, die Ian befällt, darzustellen (und ohne dass es tranig wird). In jeder seiner Handlungen und jedem seiner Gespräche klingen Echos früherer Variationen an - bis Ian kaum noch weiß, ob er etwas gerade wahrnimmt oder sich an etwas erinnert. Er findet auch gelegentlich Indizien dafür, dass er am Abend zuvor einen Selbstmordversuch unternommen hat - und das eine oder andere Mal könnte der durchaus "erfolgreich" gewesen sein, wer weiß.
Es wäre auch nicht der erste in seinem Umfeld - die Vorgeschichte psychischer Erkrankungen in Ians Familie hat ihren Teil dazu beigetragen, dass Ian in gewollter Distanz zum Rest der Welt lebt und kaum aus seiner sicheren Blase herauskommen mag. Dass die Menschen um ihn herum vielleicht gar nicht "echt" sind, ist ihm deshalb insgeheim gar nicht so unrecht: ein ungewöhnlicher psychologischer Mix für einen Romanhelden. Und Ians Distanzbedürfnis geht sogar so weit, dass die plot-technisch unvermeidlich scheinende Zusammenführung mit Love Interest Kylie in Frage gestellt wird. Alles in allem fügen sich die verschiedenen Mosaiksteine sehr schön zu einem Gesamtbild zusammen.
Darüber hinaus ist "Life in the Preservation" schlicht und einfach packend. Erst wegen der Frage: In was zum Teufel stecken die Romanfiguren da eigentlich drin? Und später umso mehr mit: Werden sie da jemals rauskommen? Spannende Lektüre!

K. J. Parker: "Academic Exercises"
Gebundene Ausgabe, 529 Seiten, Subterranean Press 2014
Und da ist es wieder, das bestgehütete Pseudonym der Phantastik seit James Tiptree, Jr. Bis vor ein paar Jahren galt es ja wenigstens als allgemein akzeptierte Tatsache, dass es sich bei K. J. Parker um eine Frau handelt, aber inzwischen ist selbst diese kleine Gewissheit erodiert. (Hmm, das hier ist eine limitierte Edition mit persönlichem Autogramm - vielleicht sollte ich sie einem Graphologen vorlegen.)
Whodunnit, dammit?
Ein paar Indizien sprechen dafür, dass Parker eine Frau ist: Zum einen natürlich der oben erwähnte Wissensrest; klingt so, als wäre am Anfang von Parkers Karriere eine Info durchgeschlüpft, ehe der Vorhang der Geheimhaltung mit voller Professionalität geschlossen werden konnte. Außerdem hat es mir mal ein normalerweise vertrauenswürdiger Verleger versichert (wenn er auch leider nicht mit weiteren Infos rausgerückt ist). Ja, und dann wären da noch die Texte selbst: Da finden sich immer wieder ein paar Boshaftigkeiten über das Wesen der Frau eingestreut, die zwar stets einem männlichen Erzähler in den Mund gelegt werden ... die ich in der Art, wie sie formuliert werden, aber nur von Autorinnen kenne. Einen männlichen Phantastikautor, der sich das traut, habe ich schon lange keinen mehr gelesen. Zumindest keinen, der auch nur über einen Bruchteil der Intelligenz verfügen würde, wie Parker sie Mal für Mal aufs Neue demonstriert.
Andererseits können solche Indizien natürlich auch genau gar nichts wert sein, wie wir spätestens seit dem vielgerühmten "männlich-kraftvollen" Stil von James Tiptree, Jr. alias Alice B. Sheldon wissen.
Der Grund, warum sich so viele vergnügt auf das "Wer ist K. J. Parker?"-Spiel einlassen, liegt natürlich darin, dass Parkers Erzählungen brillant sind; ansonsten könnt's einem ja wurscht sein. Neben einigen Romanen hat Parker in den vergangenen Jahren vor allem kürzere Erzählungen verfasst. 13 davon - Kurzgeschichten, Novellen und Essays - wurden nun erstmals zu einem Sammelband zusammengefasst. Für mich das Fantasy-Ereignis des Jahres. Bei zweien davon kann ich mich übrigens auf Links beschränken, weil ich sie schon als Einzelwerke rezensiert habe: Die Novellen "Blue and Gold" und "Purple and Black", beide unbedingt lesenswert.
Ein Fundament aus Recherche
Der Titel "Academic Exercises" ist zweifach berechtigt: Sämtliche Erzählungen spielen sich in einem akademischen Umfeld ab bzw. haben die Figuren einen entsprechenden Hintergrund. Und dazu kommen drei Essays über verschiedene Aspekte der Kriegsführung, die demonstrieren, dass Parkers an das renaissancezeitliche Europa erinnernde fiktive Welt auf einem festen Untergrund aus solider Recherche steht. In "Cutting Edge Technology" schreibt Parker über die Herstellung und Handhabung von Schwertern (und streut verschmitzt ein, beides selbst schon ausprobiert zu haben). In "Rich Men's Skins" geht es um Rüstungen und die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass sich im historischen Wandel des Kriegshandwerks und der dahinter stehenden "Philosophien" nicht immer die effektivsten Strategien durchgesetzt haben.
Diese Essays sind ganz so wie Parkers Erzählungen: Scharfsichtig und präzise - es würde kühl wirken, wenn das Ganze nicht mit Ironie und schwarzem Humor aufgelockert wäre. Beispiel 3, der Text "On Sieges" über das Belagerungswesen, zeigt dies sehr schön. Parker demonstriert, dass eine Belagerung kein Schlacht-an-der-Hornburg-Spektakel war, sondern stets das Resultat einer nüchternen Kalkulation, ob sich der ganze Aufwand auch wirklich lohnt. Das Ergebnis habe im Grunde immer schon vorher festgestanden (zumindest wenn der Belagernde keine Fakten ignoriert hat). Die jahrtausendelange Rüstungsspirale aus immer neuen Belagerungsmaschinen und entsprechenden Abwehrmaßnahmen nennt Parker zusammenfassend probably the most expensive hobby in history, at least before the start of the space race.
Und die Amoral von der Geschicht' ...
Vergleichsweise konventionell kommt noch die preisgekrönte Geschichte "Let Maps to Others" daher. Der Erzähler ist ein Historiker, der sein Lebenswerk dem mythischen Land Essecuivo verschrieben hat. Als endlich ein Dokument auftaucht, das seine Thesen bestätigt, wird das unschätzbar wertvolle Stück von seinem Erzrivalen an der Universität verbrannt, nur um ihm eins auszuwischen. Was tut er also? Er produziert eine Fälschung ... und setzt damit ungewollt eine geradezu unglaubliche Ereigniskette in Gang. Für die er am Schluss allerdings - ganz der rationale Denker - doch noch ein paar plausible Erklärungen aus dem Hut zaubert.
Moralische Dilemmata sind ein ganz großes Thema in Parkers Erzählungen - und in aller Regel enden sie ambivalent. In "A Small Price to Pay for Birdsong" etwa haben wir es mit einem Musiktheoretiker und Komponisten zu tun, dem trotz seines hohen Ansehens der geniale Funke fehlt. Ganz im Gegensatz zu einem seiner Studenten, den er in der Todeszelle besucht und ihm ein unmoralisches Angebot unterbreitet: Fluchthilfe gegen Musik. Parker zeichnet eine an Macht und Geld orientierte frühkapitalistische Welt - "Let Maps to Others" beispielsweise geht vom nicht gerade fantasytypischen Szenario einer geplatzten Investitionsblase aus. Man darf darüber spekulieren, wie sehr sich dieses Worldbuilding in den egogetriebenen Figuren widerspiegelt. Parkers Blick auf den Menschen an sich ist jedenfalls ... na sagen wir mal unsentimental.
Eine Schraubenwindung weiter
Nachdem wir es trotz aller Realpolitik und -ökonomie aber immer noch mit Fantasy zu tun haben, können die Szenarien, die zu einer Grundsatzentscheidung zwingen, natürlich auch ungewöhnlicher aussehen. Die Hauptfigur von "One Little Room an Everywhere" beispielsweise ist ein sympathischer Betrüger. Es fehlt ihm an Talent, um seine Magier-Ausbildung beruflich umzusetzen. Also wird er Ikonenmaler - und zwar ein begehrter, weil er seine Werke heimlich mit einem gestohlenen Zauberspruch aufmotzt. Dass dieser möglicherweise Nebenwirkungen hat (wir sprechen von Morden, Feuersbrünsten, Erdbeben und Ähnlichem an den Orten, an denen seine Bilder hängen) ... nun, das kann niemand belegen, nicht einmal er selbst. Gibt es also etwas noch "Besseres" als das perfekte Verbrechen? Ja: Eines, für das man nicht einmal dann verurteilt werden kann, wenn man es gesteht - einfach weil sich kein Zusammenhang beweisen lässt. Soll er also seinen Zweifeln nachgeben oder einfach mit seinem Tun weitermachen? Die Antwort können wir uns denken.
In den meisten Erzählungen wird die Staatsreligion um The Invincible Sun erwähnt - in "The Sun and I" erfahren wir nachträglich, wie sie entstanden ist: Als Schnapsidee einiger junger Habenichtse, die nach einer Methode gesucht haben, den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Durch eine Mischung aus Talent, Ausnutzung von Placebo-Effekten und einer Reihe von Zufällen wird die künstliche Religion tatsächlich zum Erfolg. Derart unglaubliche Zufälle übrigens, dass man sich langsam zu fragen beginnt, ob da nicht doch eine höhere Macht ihre Hand im Spiel hat. Denn wen würde sich eine Gottheit wohl dafür aussuchen, andere Menschen von der göttlichen Botschaft zu überzeugen: Irgendeinen frommen Naivling oder jemanden, der ein Profi im Leuteüberzeugen ist? Wie die falsche Religion zur echten wird und doch weiterhin ein Business bleibt, ist einfach herrlich zu lesen und transportiert womöglich sogar so etwas wie eine moralische Anwandlung Parkers: "Gut" und "schlecht" hängen nicht vom Motiv einer Tat ab, sondern von deren Resultat.
Magie und Machiavellismus
Dass Parkers Werke auch Fantasy-abholden LeserInnen wärmstens empfohlen werden können, liegt daran, dass bis zum Klischee ausgereizte Motive darin so gut wie gar nicht auftauchen. Die meisten kommen sogar ohne Magie aus. "There is no such thing as magic. Instead, there is a branch of natural philosophy of which we are adepts and the rest of the world is blissfully ignorant", so sehen es die Magier selbst. In "A Room with a View" wird die Anwendung von Magie wie Fließbandarbeit beschrieben, in "Amor Vincit Omnia" und "Illuminated" kommt sie in Form von Profiling- bzw. CSI-Methoden zum Einsatz. (Fantasy-Fans dürfen sich hingegen über ein ebenso originelles wie ausgeklügeltes Magie-System freuen, das ist die andere Seite.)
Bezeichnend auch hier: Wenn es in "Amor Vincit Omnia" zum magischen Duell mit einem Gegner kommt, der sich unverwundbar gemacht hat, dann wird der nicht als "dunkle", sondern als politische Bedrohung betrachtet. Zynischer geht's kaum: Imagine a rebel who stood in front of the entire army, invulnerable, untouchable, gently forgiving each spear-cast and arrow-shot while preaching his doctrine of fundamental change. It would mean the end of the world.
Language is a virus from inner space
Parker ist das Mastermind des Zweifels, sowohl in Bezug auf die eigene Person als auch auf die Handlungsfiguren und die moralischen Implikationen der Entscheidungen, die diese treffen. Parkers Erzählern sollte man stets ein gesundes Misstrauen entgegenbringen, wie schon die beiden oben verlinkten Novellen "Blue and Gold" und "Purple and Black" zeigten. Und manchmal geht es auch über die Moral hinaus - dann beginnt die Wirklichkeit selbst zu verschwimmen:
So tritt in "A Rich Full Week" ein mittelmäßiger Magier gegen einen "Zombie" zum Psychoduell an - bis es im Zweikampf der Bewusstseine immer unklarer wird, wer wer ist. Und in "Illuminated" betritt Parker die Meta-Ebene und beschreibt die Beziehung zwischen Autor und Leser wie eine Infektion. Hier stößt ein magisches CSI-Team auf Schriftstücke, deren Texte einem sich selbst replizierenden Virus ähneln. Im Verlauf der mit raffinierten Twists versehenen Geschichte wechselt mehrfach die Identität des Erzählers - ein Beunruhigungsfaktor, wie man ihn aus der SF und dem Horror-Bereich sehr gut kennt. In der Fantasy hingegen ist es eher ungewöhnlich, mit Philip K. Dick'schen Fragen wie "Wer bin ich?" und "Was ist wirklich?" konfrontiert zu werden.
Noch irgendein Argument gebraucht, um von K. J. Parker überzeugt zu werden? Nehmen wir abschließend einfach ein Beispiel: Viele AutorInnen haben schon einen armen Wicht in einen Löwenkäfig werfen lassen. Aber erst in Parkers Welt ist man auf die Idee gekommen, ihn mit einem satten Löwen einzusperren. So bleibt viel mehr Zeit für Angst, bevor das Unvermeidliche geschieht ...

Robert A. Heinlein: "Mondspuren"
Broschiert, 464 Seiten, € 10,30, Heyne 2014 (Original: "The Moon is a Harsh Mistress", 1966)
Weltraumkolonisierung, Planung und Durchführung einer Revolution, das Entstehen einer Künstlichen Intelligenz, neue menschliche Beziehungsformen, originelles Ausnützen physikalischer Gegebenheiten, Humor und jede Menge Action: erstaunlich, was man alles in ein Buch von durchschnittlicher Länge packen kann. "The Moon is a Harsh Mistress" aus dem Jahr 1966 (auf Deutsch schon unter diversen anderen Titeln erschienen) gilt als einer der ganz großen Klassiker aus dem Schaffen von Robert A. Heinlein: Jenes Mannes, der insbesondere in seiner US-Heimat zum Giganten-Kanon gezählt und gleichauf mit Arthur C. Clarke oder Isaac Asimov genannt wird, während man im deutschsprachigen Raum stets eine gewisse Misstrauensdistanz zu ihm wahrte. Warum, lässt auch dieser Roman erahnen.
Das neue Australien
Im Jahr 2075 dient der Mond als Kornkammer der Erde und wird von etwa drei Millionen Menschen bewohnt – keine freiwilligen KolonistInnen, sondern straffällig oder sonstwie unliebsam gewordene Menschen, die man kurzerhand auf den Erdtrabanten abgeschoben hat. Plus deren Nachkommen, die zwar offiziell frei sind, aufgrund der Gewöhnung an die geringe Schwerkraft aber de facto von der Erde verbannt bleiben. Und ein Ticket zum Mutterplaneten könnte sich ohnehin niemand leisten.
Die Ausgangslage erinnert nicht zu knapp an die Besiedlungsgeschichte Australiens. Und Heinlein unterstreicht dies noch, indem er den "Loonies" vergnügt einige Charakterzüge verleiht, in denen alte Aussie-Klischees anklingen: Sie interessieren sich nur für Bier, Wetten, Frauen und Arbeit (nicht notwendigerweise in dieser Reihenfolge). Und sie sind zwar auf eine hemdsärmelige Art freundlich, zugleich aber auch ... ruppig. Mit körperlicher Gewalt ist man schnell bei der Hand – Gesetze werden auf dem Mond nicht gebraucht, weil sich jeder Missetäter binnen kurzem ohne Schutzanzug auf der luftleeren Seite einer Schleuse wiederfindet.
Neu – insbesondere für die Zeit, in der der Roman entstanden ist – sind die lunaren Formen menschlichen Zusammenlebens. Da starker Frauenmangel herrscht, haben sich alle möglichen Formen von Vielehen entwickelt. In der TV-Serie "Caprica" kam Vergleichbares als das große gewagte Ding rüber ... Heinlein hat es schon vor einem halben Jahrhundert vorweggenommen. Zumindest in diesem Punkt zeigte er sich immer wieder mal ganz gerne als Freigeist (siehe auch "Fremder in einem fremden Land").
Das große Revolutionsspiel
Die Geschehnisse kommen ins Rollen, als den Loonies klar wird, dass ihre natürlichen Ressourcen langsam, aber sicher ausgebeutet sein werden. Das in den Mondkavernen angebaute und zur Erde geschickte Getreide verbraucht sämtliches Mondeis – irgendwann wird es verschwunden sein und die Kolonie vor dem Hungertod stehen. Eine Revolution ist unvermeidlich. Und die verfolgen wir in "Mondspuren" mit: Vom Aufbau erster revolutionärer Zellen über Sabotageakte, Putsch und Unabhängigkeitserklärung (symbolträchtig am 4. Juli 2076, dem "Tricentennial" der amerikanischen) bis zum Konflikt mit der Erde und der Drohung, "Steine zu werfen". Also mit einem Massebeschleuniger Felsbrocken auf die Erde zu lenken. Und wie es schon in der Bibel heißt, kämpft Gott immer auf der Seite mit den größten Geschützen.
Festgemacht wird diese Entwicklung an der Figur von Manuel Garcia O'Kelly, einem freischaffenden IT-Unternehmer, der sich selbst am besten charakterisiert, als er Einblick in seine Geheimdienstakte erlangt: "Ich wurde als 'unpolitisch' eingestuft, und irgendjemand hatte 'nicht allzu intelligent' hinzugefügt, was unfreundlich und zutreffend war, denn wie hätte ich mich sonst auf eine Revolution einlassen können?" "Mondspuren" ist nicht zuletzt die Geschichte der erstaunlichen Karriere, die Mannie machen wird. Heinlein bringt dies sehr geschickt unter, indem er sich auf beiläufige Bemerkungen beschränkt: Man beachte die aufeinanderfolgenden Titel, mit denen Mannie im Verlauf des Romans angesprochen wird.
Unterstützung erhält dieser mehr oder weniger zufällige Revolutionär der ersten Stunde von der jungen Agitatorin Wyoming Knott und "Prof" Bernardo de la Paz, dem machiavellistischen Kopf der Bewegung. Wichtigster Verbündeter allerdings ist Mike, der Supercomputer der lunaren Verwaltung, der ein eigenes Bewusstsein entwickelt hat und Mannie als seinen besten Freund betrachtet. Im Grunde ist es der totale Wahnsinnsplan, den Computer der Verwaltung für einen Aufstand gegen selbige einzusetzen – aber es funktioniert. Dass für den gelangweilten und stets zu Streichen aufgelegten Mike alles nur ein Spiel ist, steht quasi sinnbildlich für den Ton, in dem Heinlein das durchaus blutige Geschehen erzählt.
Flott und frisch
Man sollte meinen, dass die Zeit gerade mit Science Fiction besonders grausam umgeht. Doch dieses Buch ist fast 50 Jahre alt und wirkt dennoch keineswegs antiquiert. Da merkt man erst, was die erzählerische Intelligenz eines Autors ausmacht – und wie plump das Zeug von jemandem ist, dem selbige fehlt (ich nenne keine Namen ... Evan Currie).
Ein wesentlicher Grund für die flotte Erzählweise ist, dass wir das Geschehen aus Mannies laut Eigendefinition "schlichter" Perspektive miterleben. Die drückt sich nämlich auch sprachlich aus. In Rezensionen zur Originalversion war von einem "Mondkreolisch" die Rede, das Heinlein entworfen habe. Davon ist auf Deutsch zwar so gut wie nichts geblieben – aber es ist immer noch auffällig, wie oft wesentliche Dinge in einer vermeintlich ungebildeten Alltagssprache ausgedrückt werden (wie z.B. das "Steinewerfen" auf die Erde). Das wirkt einfach frisch.
Die Schattenseiten der sympathischen Revolutionäre
Die andere Seite ist allerdings, wie des Öfteren bei Heinlein, die ideologische. Also ich möchte in dem neuen Mond-Utopia, das da aufgebaut wird, nicht leben. Die Beiläufigkeit, mit der Heinlein alltägliche Gewaltakte schildert, setzt sich in der Revolution nahtlos fort – auch bereits gefangen genommene Soldaten werden wie selbstverständlich umgebracht. Selbiges gilt für entlarvte InformantInnen der alten Verwaltung ... und durchaus auch für einen Mit-Revolutionär, der nach dem Putsch "abweichende" (also von Profs Vorstellungen abweichende) Ideen entwickelt. Wahlen werden als Ritual abgetan und die verfassungsgebende Versammlung ist eine Farce; de facto bleibt die Macht ganz bei der Clique um Mannie und den Prof. Das dahinterstehende Konzept ist einfach: Alle "wirklichen" BürgerInnen ziehen ohnehin an einem Strang (wäre die erste Gesellschaft, in der das der Fall ist), und der kleine Rest wird beseitigt. Demokratie sieht anders aus – immerhin lässt Mannie gegen Ende ein paar zaghafte Ansätze erkennen, dass auch ihm das alles ein bisschen unheimlich wird.
Rein erzählerisch jedenfalls war Heinlein mit "The Moon is a Harsh Mistress" auf dem Höhepunkt seines Schaffens – und verstand es, den Leser von der ersten bis zur letzten Seite gefangen zu nehmen. Was man nicht zuletzt daran merkt, dass man viel länger zu diesem Haufen Betrüger, Agitatoren, Mörder und Kriegsverbrecher hält, als man eigentlich sollte.

Harlan Ellison: "Ich muss schreien und habe keinen Mund. Erzählungen"
Broschiert, 671 Seiten, € 19,60, Heyne 2014 (Original-Zusammenstellung)
Ein streitbarer Querdenker, ein Literat unter den jungen Wilden der US-amerikanischen Science Fiction in den späten 60ern und 70ern - flackernd und hungrig wie wütendes Feuer, wie Dietmar Dath heuer Harlan Ellison anlässlich dessen 80. Geburtstags würdigte. Skurrilerweise kommt mir Ellisons Name in letzter Zeit ständig bei der Neuausstrahlung von "Babylon 5" (immer noch so gut wie vor 20 Jahren) unter, wo er als Berater engagiert war und sogar ein-, zweimal durchs Bild gehuscht ist. Was genau genommen gar keine Randnotiz ist, weil Ellison im Lauf der Jahrzehnte für eine lange Reihe von TV-Projekten gearbeitet ... und auch dort zahlreiche Sträuße ausgefochten hat. Ein Mann eben, der etwas zu sagen hat und sich dafür kein Blatt vor den Mund nimmt.
Dem deutschsprachigen Publikum sind die Produkte, für die Harlan Ellison als Drehbuchautor oder "Creative Consultant" tätig war - von den "Outer Limits" bis zu "Star Trek" -, vermutlich sogar geläufiger als sein schriftstellerisches Werk. Als Autor von vorwiegend Kurzformaten konnte er hierzulande nie so sehr Fuß fassen wie im englischsprachigen Raum. Sehr schön also, dass Heyne ihn im Jubiläumsjahr mit einer Zusammenstellung würdigt, die es in dieser Form auf Englisch nicht gibt. Herausgeber Sascha Mamczak hat das Vorwort erkennbar mit Herzblut geschrieben! Der mächtige Band umfasst, chronologisch geordnet, 20 Erzählungen aus den Jahren 1965 bis 1993 - von diesen sind übrigens so viele mit Hugo und/oder Nebula ausgezeichnet worden, dass ich es bei den einzelnen Geschichten gar nicht erst erwähnen werde. Und ganz so, wie es mir mit Ellison immer gegangen ist, reicht deren Bandbreite von großartig bis zu solchen, mit denen ich rein gar nichts anfangen kann.
Gnadenlos zwischen den Genres
Beginnen wir mal mit der Erzählung, die dem Band den Namen gegeben hat: "Ich muss schreien und habe keinen Mund". In diesem atemberaubend albtraumhaften Szenario "leben" die letzten fünf Menschen im Inneren eines gottgleichen Supercomputers, der die Menschheit ausgelöscht hat. Diese fünf hat er sich extra aufgehoben und setzt sie nicht enden wollenden Qualen aus, um sich für seine sinnlose Existenz zu rächen. Starker Tobak und wirklich sehr, sehr, sehr gut.
Damit wären wir schon bei einem der Elemente angelangt, die in Ellisons Werk immer wieder auftauchen: einer gewissen Erbarmungslosigkeit. In "Das Winseln geprügelter Hunde" beobachten die MieterInnen einer modernen Wohnanlage teilnahmslos von ihren Fenstern aus einen Mord. Unter ihnen auch die Hauptfigur, die später noch die Kehrseite der Medaille kennenlernen wird: Zur Hälfte ist es eine Parabel über Gleichgültigkeit, zur Hälfte aber auch eine fantasyeske Annäherung an das Böse als externe, nicht im Menschen liegende Macht. Und auch das ist typisch für Ellison: Die Grenzen zwischen Science Fiction, Mystery, Fantasy, Horror und Realismus sind bei ihm so durchlässig, dass es sinnlos ist, sein Werk einem bestimmten Genre zuordnen zu wollen.
Keine erkennbaren Phantastik-Elemente enthält beispielsweise "Das weiche Äffchen", in dem die Hauptfigur - in diesem Fall eine Obdachlose - ebenfalls Zeugin eines Mordes wird und sich anschließend auf der Flucht vor den Tätern wiederfindet. In "Zauberhafte Maggie Moneyeyes" landet ein Spieler in Las Vegas an einem von einem Geist besessenen Glücksspielautomaten, was ebenso unversöhnlich endet wie "Die Stadt am Rande der Welt". Darin wird Jack the Ripper in eine sterile Metropole der fernen Zukunft versetzt und muss feststellen, dass es Schlimmeres gibt als ihn. (Die amoralischen posthumanen BewohnerInnen der Stadt, die Jack zu ihrem Spielzeug machen, erinnern mich irgendwie an "Zardoz".) Manchen Ellison-Geschichten möchte man nachts nicht in einer dunklen Gasse begegnen.
Die Vergangenheit lebt weiter
Er kann allerdings auch ganz anders. Eine meiner Lieblingserzählungen in dem Band ist das vielschichtige "Jeffty ist fünf". (Und nicht nur meiner - die LeserInnen des Fachmagazins "Locus" haben es vor einigen Jahren zur besten Kurzgeschichte aller Zeiten gewählt.) Sie erzählt von der ungewöhnlichen Freundschaft zweier Jungen, von denen einer älter und schließlich erwachsen wird, während der andere für immer fünf bleibt. Doch nicht nur das: Jeffty lässt um sich herum auch eine andere, seiner ewigen Kindheit entsprechende Realität entstehen. Er hört im Radio brandneue Episoden einer längst eingestellten Serie und kauft am Kiosk Comics, die es gar nicht mehr gibt. Und der älter werdende Erzähler der Geschichte, der - wie viele Ellison-Figuren übrigens - der Vergangenheit nachtrauert, kann es in Jefftys Nähe miterleben. Was sehr schön und leider auch sehr traurig ist.
Ellison ist zwar als großer Experimentator in Sachen Sprache, Form und Struktur - insbesondere was nichtlineares Erzählen anbelangt - bekannt. Aber ein gewisser Zug, die Vergangenheit zu verklären, zieht sich auch wie ein roter Faden durch sein Werk. Figuren, die an der Gegenwart und all ihren angeblichen Unsäglichkeiten herumraunzen, tauchen darin zuhauf auf. Ebenso wie Anspielungen auf diverses Popkulturgut von Film bis Literatur - und es sind stets Werke aus der Zeit, als Ellison selbst noch ein Kind war. Liest man dies zwei Generationen später, merkt man erst so richtig, dass es sich hier um pure Nostalgie handelt; da ist Ellison im Grunde nicht viel anders als heutige Eltern, die ihre ratlosen Kinder für "Wickie" begeistern wollen.
Schwarzer Humor
Schön schräg äußert sich dies in "Ein Junge und sein Hund". Hier versammeln sich jugendliche Bandenmitglieder einer postapokalyptischen Welt in einer Kinoruine, um sich Werke aus der Goldenen Ära Hollywoods reinzuziehen. Die sehr bekannte Novelle dreht sich um den Jungen Vic und seine Beziehung zu seinem Jagdgefährten Blood, einem intelligenten Hund mit telepathischen Fähigkeiten. Die beiden leben in ihrer eigenen perfekt ausgewogenen Harmonie - bis diese von einem Mädchen durcheinandergewirbelt wird. Die Geschichte wurde nicht nur zum Ausgangspunkt eines ganzen Erzählzyklus, sondern auch zur Vorlage eines Kultfilms mit dem blutjungen Don Johnson ("Miami Vice") in der Hauptrolle.
Das Ende von "Ein Junge und sein Hund" zeigt Ellisons Sinn für schwarzen Humor. Exzessiv ausgelebt hat er ihn in "Das Nachtleben auf Cissalda", einer der witzigsten Apokalypsen, die ich je gelesen habe. Ausgelöst wird sie von einem "Temponauten", der aus einer anderen Dimension ein widerliches Ding mitbringt ... das sich allerdings als der perfekte Sexpartner entpuppt. Schon bald kommen dessen Artgenossen nachgereist und belegen sukzessive die gesamte Menschheit mit Beschlag. Man beachte, dass Ellison nicht eben wenig Platz darauf verwendet, schamlos Promis aufzuzählen, die sich ihren Symbionten hingeben: Barbra Streisand sang den höchsten Ton ihrer Karriere, als sie penetriert wurde.
Ohne gemeinsamen Nenner
Erwähnen möchte ich noch drei weitere, kürzere Erzählungen: In "Croatoan" steigt ein Mann in die Kanalisation hinab, weil seine Freundin möchte, dass er ihren abgetriebenen Fötus zurückholt. Auf seinem surrealen Trip wird er mit dem konfrontiert, was er verloren hat und was er gewinnen könnte. Rührend und ein bisschen kitschig kommt "Der Wächter der verlorenen Stunde" daher (verfilmt für die "Twilight Zone"), in dem der Hüter der letzten Stunde der Welt seinen Nachfolger bestimmt - einen Mann, der ebenso einsam ist wie er. Aber auch ebenso bereit, Verantwortung zu übernehmen.
Und dann ist da natürlich noch das berühmte und im englischsprachigen Raum extrem populäre "'Bereue, Harlekin!', sagte der Ticktackmann": Eine in grellen Farben und mit wenigen Strichen gezeichnete allegorische Satire (oder satirische Allegorie?) über die moderne Zeitplanungsgesellschaft, der hier ein Mann im Narrenkostüm mit seinem Aktionismus Sand ins Getriebe streut. Kraftvoll, klar - in seiner Klarheit aber auch ein bisschen plakativ.
Anything goes
Womit wir auch schon bei einem weiteren Wesensmerkmal von Ellisons Erzählweise wären - und zwar dem, mit dem ich wie oben gesagt nichts anfangen kann. Besonders deutlich zu Tage kommt es etwa in "Der Todesengel", einer Art Anti-Genesis, dem Spätwerk "Der Mann, der Christoph Kolumbus an Land ruderte", "Die Bestie, die im Herzen der Welt ihre Liebe hinausschrie" (aus dem in dieser Ausgabe übrigens ein Textabschnitt rausgefallen zu sein scheint; schade, aber vielleicht auch bezeichnend, dass das niemandem aufgefallen ist) sowie einer Erzählung, deren Titel so unglaublich lange ist, dass ich ihn hier nicht anführe. Und die sich ähnlich wie "Croatoan" um eine Selbstfindung dreht - wofür hier allerdings ein Teilchenbeschleuniger, Dr. Frankenstein und eine Reise in den Mikrokosmos vonnöten sind.
All diese Erzählungen wirken nicht nur wie Kaleidoskope verschiedenartigster Elemente - anything goes. Ihre surrealen Settings und ihr nichtlinearer Aufbau haben mich auch die ganze Zeit über an die Stationendramen aus der Spätphase August Strindbergs à la "Das Traumspiel" erinnert, die ich seinerzeit im Schwedischunterricht lesen musste. Mit mäßigem Enthusiasmus. Einfach weil es mich nicht anspricht, wenn AutorInnen einen gewissen Abstraktionsgrad einhalten, um so mit diesem "Ich treffe Aussagen für die gesamte Menschheit"-Gestus auftreten zu können. Sorry, aber das finde ich immer etwas prätentiös.
Aber das ist ja auch nur meine Perspektive. Andere würden aus dieser Sammlung mit Sicherheit eine ganz andere Auswahl treffen und in ihren Wertungen entsprechend abweichen. Darum sollte man sich dieses fette Buch auch unbedingt gönnen: Es bietet jede Menge Stoff zum Schmökern, Denken und Diskutieren.

Franz Pichler: "Hugo Gernsback und seine technischen Magazine"
Broschiert, 174 Seiten, € 24,00, Trauner Verlag 2014
Meine erste bewusste Begegnung mit SF-Legende Hugo Gernsback war eine indirekte: In William Gibsons Kurzgeschichte "The Gernsback Continuum" aus dem Jahr 1981 treffen zwei sehr unterschiedliche Konzepte von Science Fiction aufeinander: Der damals gerade aufblühende Cyberpunk und die hehren Technik-Visionen des frühen 20. Jahrhunderts, für die Gernsback stand. In der Einleitung zu Franz Pichlers "Hugo Gernsback und seine technischen Magazine" nimmt Kunsttheoretiker Peter Weibel ebenfalls auf diese sehr symbolträchtige Geschichte Bezug und schreibt: Cyberpunk verkündet das Ende des goldenen Zeitalters der Science-Fiction. Drei Jahrzehnte später kann man allerdings an der Ironie nicht vorbeisehen, dass Cyberpunk mittlerweile selbst ein Fall für die Nostalgie ist, denn irgendwie hat die globale virtuelle Vernetzung doch eine ganz andere Gestalt angenommen als bei Gibson & Co.
Gestern, heute, morgen
Oder ist das zu oberflächlich gedacht? Parallelen zwischen Vergangenheit und Gegenwart bzw. die Korrektheit von "Prognosen" aufzuzeigen, ist einer der Hauptanreizpunkte dieses Buchs. Stichwort "Radiobewegung": Als der Luxemburger Hugo Gernsbacher 1904 im Alter von 20 Jahren in die USA auswanderte und sich einen leichter auszusprechenden Namen zulegte, mauserte er sich binnen kurzer Zeit vom Erfinder und Vermarkter seiner Ideen zum Dreh- und Angelpunkt dieser Bewegung - insbesondere durch die Vielzahl von ihm herausgegebener populärwissenschaftlicher Magazine. Die berichteten nicht nur von den neuesten technischen Entwicklungen, sie enthielten auch stets Bauanleitungen und riefen zum Selberexperimentieren auf.
Privatmenschen, die ihre eigenen Radios bastelten, um damit die Sendungen ebenso privat zusammengeschraubter Sender zu empfangen: Heute ist diese Pionierszene des frühen 20. Jahrhunderts weitgehend in Vergessenheit geraten - dabei erinnert sie verblüffend an spätere Bewegungen, erst im Homecomputer- und später im Internetbereich. Eine ähnliche und erst kürzlich wiederentdeckte Szene ist übrigens, wenn auch in diesem Buch nicht erwähnt, die der privaten Raketenbauer-Vereine der 20er und 30er Jahre. Der Zweite Weltkrieg machte ihnen ein Ende - bis sie viel später eine ungeahnte Renaissance erleben sollten. Heute fliegen Privatinitiativen anstelle der NASA zur ISS. Die Zukunft kommt zwar immer ein bisschen anders, als man denkt, aber ... tja.
Zur Machart
Biografien kommen mir in der SF im Wesentlichen in zwei Grundtypen unter: Der tendenziell episch angelegten Version (da gibt es zu Hugo Gernsback Larry Stecklers Riesenwälzer "A Man Well Ahead of His Time", allerdings nur auf Englisch) und der meist in einem akademischen Kontext entstandenen Variante, die eher den Charakter einer Bestandsaufnahme hat. Dazu zählt auch dieses Buch des langjährigen Professors für Systemtheorie an der Linzer Uni, Franz Pichler. Es ist 2013 in Zusammenhang mit einer Gernsback-Ausstellung in Karlsruhe entstanden und diente gewissermaßen als begleitender Katalog - zugleich handelt es sich meines Wissens um die bislang einzige Monografie zu Gernsback auf Deutsch.
Da man in einer Ausstellung schließlich was sehen will, setzt auch der Löwenanteil des Buchs auf Schauwerte. Pichler präsentiert aus seiner privaten Sammlung zahlreiche Cover von Gernsbacks Magazinen: Von "Modern Electrics" und "The Electrical Experimenter" über "Science and Invention", "Radio News" und "Television" (ab 1927/28, der Mann war wirklich seiner Zeit voraus!) bis zu "Radio-Craft". Titel, denen Gernsback seinen Ruf als einer der Väter der Science Fiction zu verdanken hat - "Amazing Stories" und "(Science) Wonder Stories" sind, dem Motto des Buchs entsprechend, nur mit wenigen Beispielen vertreten. SF-Fans lernen hier also vor allem Gernsbacks "andere" Seite kennen. Was aber durchaus passt, da die Mitbegründung der modernen US-amerikanischen Science Fiction für Gernsback ohnehin nur ein Nebenprodukt war. "Pädagogisch" motivierte Kurzgeschichten enthielten schon seine allerersten, noch ganz an Radiobastler gerichteten Titel. Da die Stories aber beliebt waren und Geld brachten, erhielten sie später mehr Platz in eigenen Pulp-Magazinen.
Schauwerte
An die 100 Seiten lang sieht der Aufbau so aus: Pro Seite eine farbige Reproduktion eines Magazincovers samt kurzer Zusammenfassung des Inhalts der jeweiligen Ausgabe. Und die heute retrofuturistisch wirkenden Bilder sind natürlich ein einziger Triumphzug. Gestaltet hat die Illustrationen Gernsbacks langjähriger Weggefährte Frank R. Paul. Wir staunen unter anderem über Eukalyptusbäume als Antennen, ein Riesenrad, das ins Meer taucht, Kalorienzufuhr mittels Bestrahlung als Ersatz für Essen, einen Schlittschuhläufer mit Propellerantrieb (der "Mopeller"), einen Polizeiroboter, der der kleine Bruder von Mechagodzilla sein könnte, oder den am lächerlichsten aussehenden Marsianer ever, ever, ever. Kurz: Sensationen, Attraktionen.
Vor allem die absurderen Technik-Visionen erinnern stark an den fantastischen Bildband "The Wonderful Future That Never Was" des "Popular Mechanics"-Magazins. Was aber keineswegs heißen soll, dass das alles hier ein Fall für Harharhar wäre. Pichler betont wiederholt, wo Gernsback mit seinen Vorstellungen für künftige Technologien recht gehabt hat, und listet dies im Anschluss unter "Cold Facts" auf - von Solarkraftwerken bis zu Mobiltelefonen.
Die verblüffenden, rührenden, grotesken, wunderbaren Bilder würden sich absolut verdienen, noch größer präsentiert zu werden, wenn sich denn ein Verlag für einen Bildband im Coffee-Table-Book-Format gewinnen ließe. Der könnte dann vielleicht auch gleich ein etwas ansprechenderes Layout finden und nicht zuletzt einen Lektor die Vertippser beseitigen lassen, von denen es im Hauptteil leider nur so wimmelt. Wer mehr von Frank R. Pauls Bildern sehen will, findet diese im Internet hier.
Nachbetrachtungen
Nachdem die 2013 erschienene erste Auflage von "Hugo Gernsback und seine technischen Magazine" vergriffen war, hat der Verlag nun eine zweite herausgegeben. Erweitert um ein Feature von Kulturjournalistin Heide Stockinger, das übrigens am 4. Oktober auszugsweise in Radio OÖ zu hören sein wird (ab 19.04 Uhr in der Sendung "Premiere"). Unter dem Titel "Hugo Award - nach wem ist der Preis für Science Fiction benannt?" geht Stockinger nochmals auf Gernsbacks Biografie ein, ergänzt unter anderem um eine Inhaltsangabe zu Gernsbacks (nebenbei bemerkt ziemlich schrecklichem, aber einflussreichem) SF-Roman "Ralph 124C 41+". Plus eine Collage von Reaktionen auf die Karlsruher Ausstellung sowie Bewertungen von Gernsbacks Bedeutung für die Science Fiction insgesamt.
Letztere fallen seit jeher sehr gemischt aus. Und ich würde mich nicht unbedingt der Meinung anschließen, dass es von "typisch europäischer Überheblichkeit" zeuge, dass Hugo Gernsback hierzulande in Vergessenheit geraten ist. Nun, für die verschiedenen europäischen SF-Traditionen hat er schließlich auch keine maßgebliche Rolle gespielt. Gernsback war eine zentrale Figur in der Kultur der Pulps; nur John W. Campbell spielte hier eine noch wichtigere Rolle. Aber die Pulps sind nur die bzw. eine Wurzel der US-amerikanischen SF, und das Genre insgesamt hat viele.
Ein Konsens lässt sich allerdings finden, wenn man ein bestimmtes Wort näher ins Auge fasst, das Pichler wiederholt verwendet und das in den Ohren heutiger SF-Fans seltsam klingt: "Vorhersage". Schon seit langem wehrt sich jeder in der Science Fiction mit Händen und Füßen gegen die von außen hereingetragene Anmutung, SF würde Prognosen für die Zukunft erstellen. Tut sie nicht, niemals. Sie beschäftigt sich mit den Problemen der Gegenwart, weitergedacht und übertragen auf fiktive Welten. Gernsback allerdings sah dies tatsächlich etwas anders: Bei ihm verschwammen Fiktion und Fakten (inklusive solcher, die noch nicht eingetreten waren) zu einer untrennbaren Einheit. Das ist nicht die Definition von Science Fiction - aber es steht für eine Variante davon. Und die wird für immer Gernsbacks Namen tragen.
+++
P.S.: Zu guter Letzt habe ich dem Buch auch zu verdanken, dass ich doch noch einen Titel für diese Rundschau-Ausgabe gefunden habe. Eine der abgebildeten Ausgaben von "Amazing Stories" aus dem Jahr 1928 enthielt nämlich eine Erzählung von Harold F. Richards mit dem schönen Titel "The Vibrator of Death". Der übrigens tatsächlich dem Vergnügen dienen sollte - allerdings in Form eines drei Stockwerke hohen Rummelplatz-Teils, das seine Passagiere durchrüttelte. War eben ein unschuldigeres Zeitalter damals.
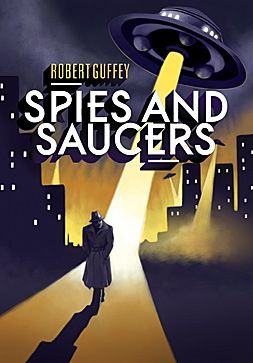
Robert Guffey: "Spies and Saucers"
Gebundene Ausgabe, 280 Seiten, PS Publishing 2014
Von Robert Guffey weiß ich exakt gar nichts, außer dass er in Kalifornien als Universitätsprofessor für Englisch arbeitet und ein Sachbuch mit dem verlockenden Titel "Cryptoscatology: Conspiracy Theory as Art Form" geschrieben hat. Auf die damit gemeinte study of secret shit wird auch in einer der drei hier versammelten Novellen angespielt, die zwar in den 50er Jahren - der Hochblüte von UFO-Hysterie und Kommunismusparanoia - angesiedelt sind, aber auch ganz klare Bezüge zur Gegenwart haben.
Deep Impact im Hanfgärtlein
Den wilden Einstieg bildet die Erzählung "The Fallen Nun" - und genau das ist es auch, was Kyle Black, der als Eremit im kalifornischen Hinterland lebt und dort Cannabis anbaut, eines Tages hinter seinem Haus vorfindet. Wie Kyle nüchtern deduziert, wann und aus welcher Fallhöhe besagte Nonne in seinem Garten aufgeschlagen haben muss, steht am überaus witzigen Beginn. - Nicht dass viel Zeit zum Überlegen wäre, denn schon klopfen zwei angebliche FBI-Agenten an, die sich bald darauf als gewaltbereite Journalisten eines Krawallblatts mit CIA-Connections entpuppen. Und noch später - zumindest für diejenigen, die den Bezug erkennen - als Figuren aus dem Bela-Lugosi-Film "The Devil Bat" (dass die Teufelsflattermaus selbst auch zu einem Auftritt kommt, hilft natürlich beim Entschlüsseln).
Bevor die Handlung gegen Ende hin in sehr vergnüglicher Weise völlig entgleist, serviert uns Guffey unter anderem einen Zyklopen, eine Zeitschleife, einen Trip zum Mond, reichlich Klamauk der alten Schwarz-Weiß-Schule und einen Konvent schießwütiger Nonnen, die ein Alien gefangen halten, dessen Haut psychedelische Substanzen absondert. Hui. Insgesamt ist die Erzählung eine ebenso absurde wie temporeiche Liebeserklärung an die Pulps und Schundfilme der 30er und 40er Jahre. Dass die einzig süße Nonne in dem ganzen Harpyiennest - für die Handlung wichtig! - Quantenphysik studiert hat, darf man als weitere Hommage an die haarsträubenden Plot-Konstrukte solcher Machwerke werten.
Im roten Nest
Kommt "The Fallen Nun" wie eine besonders schräge Episode der "Twilight Zone" daher, so setzt das folgende "Communist Town, USA" etwas stärker auf Psychologie. Im Mittelpunkt steht diesmal der junge Philip Trowbridge, der im Auftrag des FBI ein Kaff in Wisconsin besucht, wo an enemy worse than the Nazis dräut: rote Peaceniks. Eine ganze Reihe Agenten ist schon in der Stadt verschwunden - dieses Rätsel wird am Ende gelöst werden und dem Thema Paranoia einen ironischen Twist verleihen.
Erst einmal jedoch ist Philip zwischen zwei Frauen hin- und hergerissen: Seinem Kontakt vor Ort, der verführerischen Eva (ein Deckname, sonst wär's ein wenig gar plakativ). Und Brillenschlange Sophia, einer Friedensaktivistin, die als Kommunistin verdächtigt wird. Je näher wir die Figuren kennenlernen, desto mehr verschieben sich aber die anfänglichen Wahrnehmungen. Denn während die erfahrene Agentin Eva sich als Weibchen entpuppt, erfährt Philip Sophias BDSM-Vorliebe buchstäblich am eigenen Leib.
Es folgen diverse Enthüllungen, die uns die drei Figuren näherbringen, insbesondere Philip. Er verklärt das typische Kleinstadt-Amerika, wo alles noch gut und echt ist - aber vor allem deshalb, weil es ihm selbst nicht vergönnt war, in einer so (vermeintlich) heilen Welt aufzuwachsen. Die Erzählung gibt sich gezielt ambivalent, insbesondere bei der Frage, was gut und was schlecht ist. Wenn sich etwa Philip am Ende stolz an den seiner Meinung nach einzig heldenhaften Moment seines Lebens erinnert, dann werden wir diesen als verabscheuungswürdig und zum Weinen erbärmlich empfinden.
Bau eine Welt für Uncle Sam
Zur dritten Erzählung "Spies and Saucers" gibt es zwei lose Anknüpfungspunkte. Der UFO-Fanclub, der in "Communist Town, USA" als mögliche Tarnorganisation für Kommunisten dient, taucht hier noch einmal kurz auf. Zudem hat wie zuvor Philip auch die Hauptfigur dieser Novelle schon seltsame Lichter am Himmel über Los Angeles gesehen. Curt Adamson heißt er und arbeitet als Drehbuchautor für Hollywood. Bis ihn das berüchtigte Komitee für unamerikanische Umtriebe als Kommunisten verdächtigt und Curt ein Berufsverbot droht.
Und schwupps steht eine Unterorganisation der CIA vor seiner Tür und macht ihm ein unwiderstehliches Angebot: Sie regeln sein Problem, dafür soll er sich hinsetzen und in allen Details eine fremde Welt entwerfen. Könnte es für einen Autor eine reizvollere Aufgabe geben als Worldbuilding? Dafür nimmt Curt sogar ein Leben in Quasi-Gefangenschaft in Kauf ... und lässt sich erst mal sämtliche Ausgaben des Pulp-Magazins "Astounding" anliefern, um aus den gesammelten Ideen anderer seine Welt herauszudestillieren. Dass der Job wegen der dahinterstehenden politischen Idee - the colonization of idea-space - und deren skrupelloser Umsetzung in Wirklichkeit ein überaus dreckiger ist, wird sich noch zeigen. Die Geschichte wird allerdings weniger mit einem Knalleffekt als mit einem fortgesetzten moralischen Dilemma enden (das ist fast ein bisschen schade).
Gestern und heute, SSDD
Curts Pulp-"Recherche" bietet Guffey einmal mehr Gelegenheit, Popkulturgut der 50er Jahre einzubauen. Zum Beispiel wird ein fiktiver Autor und Psychologe erwähnt, der im Korea-Krieg einen genialen Weg gefunden haben soll, wie sich chinesische Soldaten ergeben können, ohne das Gesicht zu verlieren: Nämlich indem sie hintereinander die Wörter für Liebe, Pflicht, Tugend und Menschlichkeit rufen - was sich dann für einen Englischsprechenden in Summe wie "I surrender" anhört. Diese Episode wird in der Realität Cordwainer Smith (hier als "Carmichael Forrest" verklausuliert) zugeschrieben; ob sie tatsächlich stimmt, weiß ich allerdings nicht. Solche Anspielungen gibt es in diesem Buch zuhauf - und sicher mehr, als ich entdeckt habe.
Trotz eines 50er-Jahre-Settings und gewitzter Beschäftigung mit der damaligen Populärkultur sollte man Guffeys Buch aber nicht für ein Nostalgie-Vehikel halten. Wenn in "Communist Town, USA" beispielsweise behauptet wird, dass im Zweiten Weltkrieg der zu Deutsch klingende Hamburger zum Patriot Sandwich umgetauft wurde, erinnert man sich unwillkürlich an die groteske Idee der Bush-Regierung, aus French Fries "Freedom Fries" zu machen, nur weil Frankreich nicht mit in den Irak-Krieg ziehen wollte.
Die dritte Novelle macht die Parallelen zwischen Vergangenheit und Gegenwart besonders deutlich. "Kommunist" ließe sich 1:1 gegen "Terrorist" austauschen, was den undemokratischen Umgang des Staates mit Verdächtigen und die Spirale aus Paranoia und Überwachung anbelangt. In seinem 50er-Jahre-Tarnmäntelchen beschäftigt sich "Spies and Saucers" also genauso intensiv mit unserer Gegenwart, wie es das Buch auf der nächsten Seite aus der Warte der Zukunft tut.
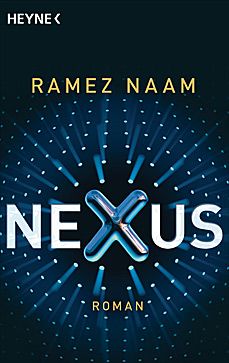
Ramez Naam: "Nexus"
Broschiert, 622 Seiten, € 10,30, Heyne 2014 (Original: "Nexus", 2013)
Manchmal glaubt man schon früh, die Limits eines Romans zu erkennen, und merkt dann erst nach und nach, dass man seinen ersten Eindruck revidieren muss. Zum Beispiel hier: Ramez Naams Romandebüt "Nexus" beginnt als konventioneller Technikthriller mit sehr konventioneller Personenkonstellation. Die Sprache ist straight, die Sätze kurz - und schon früh tauchen klischeehafte Formulierungen auf wie: Heiß glühte ihr Körper unter seinen Händen. Oder: Sie kamen, um ihn zu holen, und nur Gott konnte denen helfen, die sich ihnen in den Weg stellten. Und ich dachte schon: Oje.
Aber das bessert sich. Oder vielleicht ist es mir nur nicht mehr aufgefallen, weil "Nexus" immer mehr an Spannung gewinnt, bis es schließlich richtig packend wird. Und das Schöne daran ist, dass diese Spannung gar nicht in erster Linie durch die Action zustande kommt (von der es reichlich gibt, Naam erspart seinen Figuren und uns keine Grausamkeit). Nein, die kommt auf eine andere Weise ins Spiel - aber mehr dazu später.
Das Szenario
Wir schreiben das Jahr 2040 und befinden uns in einem Setting, das irgendwo zwischen "Mission Impossible" und "Johnny Mnemonic" angesiedelt ist: Es cyberpunkelt - aber noch nicht so stark wie in den Zukunftswelten der frühen 80er. Der Autor - ein US-amerikanischer Software-Entwickler und Experte für transhumane Technologien - kann hier seine Expertise ausspielen: Wir lesen von einer ganzen Reihe plausibel wirkender informations- und biotechnologischer Innovationen. Diejenige, um die es hauptsächlich geht, ist allerdings illegal. Und keiner weiß, woher sie gekommen ist: Nexus.
Nexus wird als "Droge" bezeichnet. Eigentlich handelt es sich dabei aber um nanotechnologische Konstrukte, die sich im Körper ansiedeln und in einem Gehirn-Computer-Interface resultieren können. Von der ursprünglich nur kurzfristig wirksamen Substanz gibt es inzwischen mehrere Ableger, die dauerhaft und zu kreativen Zwecken eingesetzt werden können: Etwa um sich eine programmierte Zusatz-"Persönlichkeit" mit speziellen Fähigkeiten (sagen wir: einen Casanova oder einen Bruce Lee) anzueignen, die in der passenden Situation die Körpersteuerung übernimmt. Am wichtigsten ist aber der Effekt, dass die NutzerInnen untereinander in quasi-empathischer bzw. -telepathischer Weise kommunizieren können. Und just diese friedlichste aller Anwendungen wird Mord und Totschlag auslösen.
Hauptgrund dafür ist, dass die USA mal wieder einen ihrer Motto-Kriege führen und die restliche Welt großteils mit reingezogen haben: Nach dem Krieg gegen den Terror und dem Krieg gegen Drogen steht nun der Krieg gegen posthumane Bedrohungen auf dem Menü. Und wird mit aller undemokratischen Härte geführt, die man sich nur vorstellen kann: Überwachungswahn und Zensur, Missachtung der Souveränität anderer Staaten, Ausschaltung der Justiz, gezielte Morde und keinerlei Bedenken wegen Kollateralschäden - kurz: eine völlige Skrupellosigkeit im Namen der Sicherheit.
Die Hauptfiguren ...
Und die geballte Staatsmacht stürzt auch sogleich wie eine Tonne Ziegelsteine auf Kaden Lane herab, einen Doktoranden der University of California, der etwas naiv mit seinem eigenen Nexus-Update herumexperimentiert. Der Heimatschutz erpresst Kaden zur Mitarbeit - andernfalls würden alle seine bei einer Razzia hopsgenommenen Freunde auf Nimmerwiedersehen in einem Staatsgefängnis verschwinden. So wird Kaden nach Thailand geschickt, um dort die geniale chinesische Wissenschafterin Su-Yong Shu zu treffen, deren technologische Innovationen die USA als Bedrohung einstufen.
Bewacht wird Kaden von der schlagkräftigen Agentin Samantha Cataranes. Unbemerkt folgt ihnen zudem Kadens Freund Watson Cole nach, ein ehemaliger US-Soldat, der sich von den Umtrieben seines Landes angewidert abgewandt hat. Er ist als einziger der Regierungsrazzia entkommen, versucht mit seiner Vergangenheit klarzukommen und dafür zu sorgen, dass die Zukunft besser wird.
... und ihr Dilemma
Wie gesagt: Es folgt jede Menge Hauen, Stechen, Schießen und Sprengen. Das allein wäre aber nichts Besonderes - viel interessanter ist der innere Konflikt, in den sämtliche Hauptfiguren der Reihe nach geraten. Samantha etwa, die klar die Anti-Transhumanismus-Linie ihrer Regierung vertritt. Allerdings kann sie auch schwer übersehen, dass sie aufgrund ihrer diversen Augmentierungen im Grunde selbst längst kein "normaler" Mensch mehr ist. Zudem empfindet sie eine Nexus-bedingte empathische Verschmelzung als etwas durchaus Positives.
Kaden wiederum droht zunächst im Konflikt der Mächte zerrieben zu werden und muss erst mal einen Überblick gewinnen, welche Seite ihm als die sympathischere (oder weniger schlimme) erscheint. Zum einen die mit rücksichtsloser Brutalität, aber auch echter Sorge vorgehende Regierung seines Landes. Zum anderen Su-Yong Shu, deren Vision von der transhumanen Zukunft auch nicht frei von Brisanz ist. Shu hat - wie übrigens die meisten Hauptfiguren - aufgrund ihrer Vergangenheit wirklich gute Gründe, die bestehenden Machthaber zu hassen. Doch verheißen auch ihre Rachepläne wenig Gutes.
Die Motive beider Seiten werden immer wieder in neuem Licht dargestellt und machen es schwer, zwischen "gut" und "böse" zu unterscheiden. Zudem blitzen auch ganz andere Sichtweisen des Themas auf. Etwa wenn Kaden mit buddhistischen Geistlichen in Kontakt kommt, die das Thema menschliche Weiterentwicklung ganz entspannt sehen und daher auch neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen sind. Sollte Technik-Nerd Kaden ausgerechnet hier eine Antwort auf die Frage finden, welchen Weg er - für sich und für die Menschheit - einschlagen soll? Und das ist es, woraus "Nexus" seine Spannung bezieht: Nicht aus bloßer Action, sondern aus der bis zum Schluss offenen Frage, wofür sich die Romanfiguren letztlich entscheiden werden. Eine der besten Arten, Spannung zu erzeugen, wie ich finde.
Standing on the shoulders of giants
Das Grundszenario des Romans kann in der SF auf eine lange Tradition zurückblicken. Das Entstehen einer neuen Spezies mit erweitertem Potenzial, die von der alten Menschheit bekämpft wird, das gibt es spätestens seit A. E. van Vogts Telepathen-Roman "Slan" aus dem Jahr 1940. Ein Beispiel für die jüngere, stärker technikbezogene Variante desselben Grundthemas wäre etwa Ian McDonalds "Cyberabad". Womit wir schon mitten im Thema Singularität wären, das wir unter anderem von Charles Stross, William Gibson oder Greg Bear sehr gut kennen und das in "Nexus" natürlich auch eine große Rolle spielt.
All diese Autoren haben jeweils eigenständige Szenarien für eine technologische Singularität entwickelt (am originellsten vielleicht immer noch das von Bears "Blutmusik"). "Nexus" erschien mir im Vergleich dazu zunächst wie die Hollywood-Version des Themas, eine Art gestreamlinte Version der Ideen anderer. Aber wie gesagt: Ich habe meine Meinung im Verlauf der Lektüre geändert. Auch Naam hat seine eigene Herangehensweise ans Thema (den berühmten Mehrwert) gefunden. In diesem Fall ist es die feste Verankerung des zukünftigen Geschehens in den politischen Problemfeldern unserer Gegenwart, insbesondere dem fundamentalen Kampf von "Sicherheit" versus Freiheit.
Besonders deutlich wird dies am Ende des Romans, wenn Naam noch einmal eine Figur zu Wort kommen lässt, deren Biografie wohl nicht von ungefähr der seinen ähnelt: Wie er kam auch sie als Kind von Einwanderern in jungen Jahren in die USA. Und wendet sich schließlich mit einem offensichtlich von Herzen kommenden Appell an die Öffentlichkeit, das einstige "Land of the Free" wieder auf den Weg zurückzubringen, für den es einst stand.
P.S.
Die letzte Strophe ist damit übrigens noch nicht gesungen: Die Fortsetzung "Crux" ist vor ein paar Wochen erst im Original erschienen und wird hoffentlich ebenfalls übersetzt werden. Ausgerechnet "Fraktal"-Autor Hannu Rajaniemi meinte dazu, dass ihm nach der Lektüre von "Crux" der Kopf geschwirrt habe. Das klingt ... beängstigend.

Naomi Oreskes & Erik M. Conway: "The Collapse of Western Civilization"
Broschiert, 91 Seiten, Columbia University Press 2014
Und jetzt zu etwas ganz anderem: Das Duo Naomi Oreskes und Erik M. Conway kennen manche vielleicht von ihrem 2010 erschienenen Sachbuch "Merchants of Doubt", mit dem sie einen wichtigen Beitrag dazu geliefert haben, die Klimawandeldebatte als das zu entlarven, was sie ist: eine Farce. Denn während in der Wissenschaft schon lange allergrößte Einigkeit besteht, dass der Mensch die aktuelle globale Erwärmung verursacht hat, arbeitet eine unermüdliche Lobby an der Schnittstelle von Wirtschaft und Politik gezielt daran, den Eindruck zu erwecken, dieses Faktum stünde noch zur Debatte. Nicht zuletzt, indem sie sich auf einige wenige WissenschafterInnen stützt, die von ihrer Expertise her und erst recht in ihrer Anzahl eine minimale Randnotiz wären, erhielten sie nicht weit überproportionale mediale Aufmerksamkeit.
... mit dem Ergebnis, dass der Klimawandel seit dem Beginn der Diskussion in den frühen 90ern zwar weiter vorangeschritten - die Bereitschaft, etwas dagegen zu unternehmen, aber fatalerweise gesunken ist. Man möchte sich nicht ausmalen, was unsere Urenkel und Ururenkel dereinst über uns sagen werden. Oreskes und Conway haben es allerdings getan und schieben den "Merchants of Doubt" nun dieses schmale Bändchen hinterher, das eine Aktualisierung des Themas darstellt und dieser eine besondere Form verleiht, in der sich die AutorInnen ein bisschen austoben konnten.
Die Gegenwart aus der Sicht der Zukunft
Geschrieben am Ende des 24. Jahrhunderts in der "Zweiten Volksrepublik China", blickt diese fiktive Chronik auf den Untergang der sogenannten Westlichen Zivilisation zurück, die ab Mitte des 16. Jahrhunderts den Globus zu prägen begann und Ende des 21. Jahrhunderts durch die Folgen der Erderwärmung unterging. Die AutorInnen sprechen von unserer Zeit als dem Penumbral Age (also der Ära des Halbschattens). Ein bildhaftes Wortspiel, das im Deutschen so nicht funktioniert. Der Halbschatten folgt auf das Zeitalter der Aufklärung (Englisch: Enlightenment) und mündet in das Second Dark Age, also das Zweite Mittelalter. Festgemacht wird diese Zeitlinie am sich wandelnden Umgang mit der Wissenschaft: Sie war es, die ursprünglich den Aufstieg der Westlichen Kultur ermöglichte. Doch als ihre Aussagen - wie in Sachen Klimawandel - unbequem wurden, begann man sie zu ignorieren oder zu attackieren. Mit erwartbarem Ergebnis.
Man darf sich hier kein elaboriertes SF-Szenario erwarten. Der Great Collapse und die von ihm ausgelösten Massenmigrationen werden nur kurz skizziert: Gewaltiger Temperatursprung, Abschmelzen der polaren Eismassen, Anstieg des Meeresspiegels um acht Meter undsoweiter. Details gibt es - außer einigen Karten, die die neuen Küstenlinien zeigen - nur in lapidarer Kürze wie: The human populations of Australia and Africa, of course, were wiped out.
Satirische Spitzen
Mehrmals entwickelt "The Collapse of Western Civilization" satirische Züge und formt daraus großartige Pointen. Etwa wenn ein - wirklich erlassenes - Gesetz erwähnt wird, mit dem der US-Bundesstaat North Carolina unbequeme Forschungen zum Anstieg des Meeresspiegels zu behindern versucht. Das liest sich dann aus der Warte der Zukunft so: Then legislation was passed (particularly in the United States) that placed limits on what scientists could study and how they could study it, beginning with the notorious House Bill 819, better known as the "Sea Level Rise Denial Bill", passed in 2012 by the government of what was then the U.S. state of North Carolina (now part of the Atlantic Continental Shelf). Heimzahlungsgedanken wie diesen konnten Oreskes und Conway in reine Sachtexte natürlich nicht einbauen - der "Genrewechsel" hat also seine Berechtigung.
Die eigentliche Satire liegt allerdings im großen Szenario: Denn - nicht umsonst ist die Chronik im zukünftigen China verfasst worden - überlebt haben die Klimakatastrophe nur Staaten mit starker Zentralmacht; und die geben nun weltweit den Ton an. Der westliche Neoliberalismus, der in einem entscheidenden Abschnitt der Geschichte an der Macht war, hat somit ironischerweise zum Siegeszug dessen geführt, was er am meisten bekämpft hatte. Ob sich die Jünger Milton Friedmans wohl wenigstens von diesem Gedanken aufschrecken lassen?
Was den Halbschatten wirft
Soweit die fiktiven Elemente. Die skizzierte Zukunft dient aber nur als knalliger Aufhänger, denn zum allergrößten Teil ist "The Collapse of Western Civilization" unmittelbar in der Gegenwart verankert. Wie auch der Anhang zeigt, in dem neben einem Interview mit den AutorInnen zahlreiche Fußnoten und Web-Links angeführt sind, die sich allesamt auf Reales beziehen. Darunter vieles Interessante, das im Strudel der globalen Klimawandeldiskussion vielleicht untergegangen ist. Oder hat hierzulande jemand mitbekommen, dass der US-Kongress Pläne der Army blockiert, auf Biotreibstoffe umzusteigen? Der Kniff, ihr Buch als Zukunftschronik zu schreiben, ermöglicht es den AutorInnen, viele solcher Episoden als Teil eines Trends, der in die falsche Richtung geht, darzustellen.
"Marktfundamentalismus" (schönes Wort) und der carbon-combustion complex sind aber nicht die einzigen Ziele von Oreskes' und Conways Kritik. Immerhin sind die beiden WissenschaftshistorikerInnen - und nehmen daher auch die Rolle unter die Lupe, die die Wissenschaft gespielt hat bzw. aktuell spielt. Insbesondere den traditionellen reduktionistischen Ansatz (also das Zerfallen der Wissenschaft in zahllose Teilgebiete, wobei niemand mehr den Gesamtüberblick hat) und das Überbetonen statistischer Signifikanz halten sie für fatal: Gut, die Erderwärmung mag die Anzahl von Hurrikans erhöhen - aber kann irgendjemand beweisen, dass dieser bestimmte Hurrikan, der gerade so viel Schaden angerichtet hat, eine direkte Folge des Klimawandels ist? Irrelevant, argumentieren die AutorInnen (bzw. lassen so ihre zukünftigen WissenschaftskollegInnen argumentieren). Das Grundproblem ihrer Meinung nach: Western scientists built an intellectual culture based on the premise that it was worse to fool oneself into believing in something that did not exist than not to believe in something that did. Neben den anderen Kräften, die da am Werk sind, trage letztlich also auch die Wissenschaft ihren Teil zur Lähmung im Angesicht der Gefahr bei.
Schmaler Band, keine hundert Seiten - aber jede Menge Stoff zum Nachdenken! Und wie heißt es so schön kurz in einem der Blurbs zum Szenario von "The Collapse of Western Civilization"? Ignore it and it becomes more likely.

Matthias Falke: "Kristall in fernem Himmel" und Nadine Boos: "Der Schwarm der Trilobiten" (D9E 3 + 4)
Broschiert, 304 bzw. 250 Seiten, jeweils € 13,40, Wurdack 2014
Zank und Verwirrung stehen am Anfang von Matthias Falkes erstem Beitrag zum Shared Universe der "Neunten Expansion". Das Prospektorenschiff "Scardanelli" ist auf der Suche nach kostbaren Rohstoffen wegen eines Geheimtipps, den sein Kommandant bekommen haben will, weit über die bekannten Regionen der Milchstraße hinausgeschossen. Und jetzt hängt es mitten im Nirgendwo fest - genauer gesagt an der Grenze zwischen unserem Universum und dem Mengerraum, durch den Raumschiffe mit Überlichtgeschwindigkeit flitzen können.
Zehn Portionen Scardanelli, im eigenen Saft geschmort
Die Ausgangslage lässt schon erahnen, welche Taktik der deutsche Autor - der schon für eine ziemlich lange Reihe anderer Serien geschrieben hat - für "D9E" gewählt hat: möglichst großen Freiraum bewahren. Die "Scardanelli" befindet sich fernab der restlichen Menschheit, die im dräuenden Schatten des expandierenden Hondh-Imperiums lebt. Und damit fernab auch aller Probleme, mit denen man sich dort herumschlagen muss (wie in den beiden ersten Bänden der Reihe, "Eine Reise alter Helden" und "Das Haus der blauen Aschen", beschrieben). Dass ein Besatzungsmitglied der "Scardanelli" der Hondh-Religion anhängt, bleibt lange Zeit die einzige Anknüpfung.
In seiner hohen räumlichen Verdichtung kommt "Kristall in fernem Himmel" als Ensemblestück daher - keines der zehn Besatzungsmitglieder ließe sich als klare Hauptfigur hervorheben. Die Interaktionen zwischen diesen zehn stehen im Mittelpunkt der Handlung. Der Dialoganteil ist hoch - allerdings ohne dass das Tempo darunter leiden würde. Im Gegenteil: Speziell den ersten Abschnitt des Buchs habe ich mit Mach 3 gelesen. Was ähnlich schnell, aber trotzdem etwas ganz anderes ist als querlesen. Es ist einfach das Tempo, in dem das Buch geschrieben ist.
Dickes Ding
Im Grunde hätte mir das schon gereicht - eine Bühne, zehn DarstellerInnen, eine Situation. Ist aber kein experimentelles Theater, sondern ein SF-Roman, also kommt noch was. Was Großes. Nämlich eine ohne jede Eigenbewegung im Raum schwebende Ansammlung schwarzen Kristalls von 22 Kilometern Länge: Balken wie morsche Hochhäuser, Rammsporne wie gefrorene Eruptionen, Kegel, Rhomben, Platten und stadtgroße Scherben, die in einer beängstigenden Stille und Regungslosigkeit im Sein hingen, ein vergessenes Schweben, als habe ein Gott etwas schmieden und mit Überkräften zusammenhämmern wollen, sei der Sache überdrüssig geworden und einfach davon gegangen.
... also ein klassisches Big Dumb Object, dessen Erforschung Herzen von SF-Fans höherschlagen lässt. Was mich betrifft, darf Falke allerdings für sich verbuchen, dass er mir eines der kurioseren BDO-Erlebnisse der jüngeren Zeit beschert hat. Das, worauf man normalerweise von der ersten Seite an lauert, kommt hier nämlich erst nach besagtem Interaktions-Pingpong zwischen den Crewmitgliedern. Das ausführlich beschrieben wird. Und man gewöhnt sich daran. So sehr, dass das verspätete BDO fast schon zum Störfaktor wird. Es ist, als wäre man zu Gast in einer WG und verfolgte stundenlang konzentriert die Streitereien zwischen den BewohnerInnen mit. Dann öffnet sich mitten in der Wohnung plötzlich ein Wurmloch, aus dem ein Außerirdischer mit dem Heilmittel für Krebs tritt ... und alles, was einem als Gruß einfällt, ist: Kannst du mal eben aus dem Bild gehen, ich versuch hier grade zuzuhören.
This is underwater love
Zwei junge Frauen, die parallel zueinander in ihre Raumschiffe klettern und abschwirren: So beginnt Nadine Boos' Roman "Der Schwarm der Trilobiten". Mit der deutschen Autorin, die hier in der Rundschau schon mit der einen oder anderen Kurzgeschichte vertreten war, kehren wir nach Falke wieder zur eigentlichen Prämisse des "D9E"-Universums zurück. Denn so unterschiedlich die beiden Raumfahrerinnen charakterlich und biologisch auch sein mögen: Anlass für ihren Aufbruch ist jeweils die bevorstehende Expansion des Hondh-Imperiums in die Lebensräume der beiden Protagonistinnen.
Im Falle von Trixi Darjeeling (genialer Name) eher indirekt: Sie stammt aus dem Konsortium, einem wirtschaftlich ausgerichteten Splitter des ehemaligen menschlichen Kolonialreichs. Weil hier in Kürze die Hondh einschweben dürften, werden alle verfügbaren Raumschiffe für den Kriegsdienst requiriert. Damit das ihrem fliegenden Schrottkübel "Skolopendra" nicht auch passiert, versucht sich Trixi - eine höhere Tochter, die auf Tank Girl macht - abzusetzen. Und nicht zu vergessen auch, um einer arrangierten Ehe zu entgehen. Zu dumm, dass Trixis ränkeschmiedende Großmutter Bronja schneller geschaltet und den Ehemann in spe Karolus ebenfalls zur "Skolopendra" geschickt hat. So startet man in eher angespannter Atmosphäre - da hilft auch die Anwesenheit eines Anstandsherren und einer Anstandsdame nicht, wie sie Adelssprösslinge stets zu begleiten haben.
Das Große Ich
Raumfahrerin 2 heißt Kalmi und stammt aus einem Volk von Meeresbewohnern, den Asmini. Auch sie fürchten die Hondh und sehen sich nach einer neuen Heimat um. Kalmi wird als Kundschafterin mit ihrem Trilob ausgeschickt - mit an Bord ein faszinierendes Mini-Ökosystem, das zusammen mit der Pilotin als Kollektivintelligenz fungiert, das Große Ich. Die Namen von dessen Komponenten - Kraken, Pfeilschwanzkrebse, Hornschnecken usw. - wirken übrigens recht irdisch: Entweder sind sie im übertragenen Sinne gemeint oder es stehen uns noch Eröffnungen über historische/evolutionäre Zusammenhänge bevor.
Alle vier bisherigen "D9E"-Romane sind Abenteuergeschichten, wenn auch recht unterschiedliche. Während van den Boom mit Military SF und Peinecke & Falke mit ihren BDO-Plots klassische Bubenträume verwirklichten, hat Boos viele Ideen aus einem Genre übernommen, in dem traditionellerweise Frauen den Ton angeben: der Planetary Romance. Was, wie schon öfter gesagt, im Englischen ein weiter gesteckter Begriff ist als im Deutschen und nicht das gleiche wie "Romanze" bedeutet. Mag die Nachtigall auch eher schon aufstampfen als nur trapsen, wenn sich Trixi ihrer Ablehnung gegenüber Karolus so versichert: Seine markanten und dennoch nicht zu scharfen Gesichtszüge, seine strahlenden Augen unter goldblonden, sanft geschwungenen Brauen, seine elegante Haltung und die geschmeidigen Bewegungen seiner schlanken Finger. Je länger Trixi ihn anstarrte, desto sicherer war sie, diesen Mann niemals heiraten zu können. Jaja ...
Konfliktlinien
Neben dem zwischenmenschlichen Aspekt sind für eine Planetary Romance vor allem gesellschaftliche und ökologische Themen relevant. Beides spielt im munter erzählten "Der Schwarm der Trilobiten" eine große Rolle, und mehr als ein Drittel des Romans hat auch Trixis Heimatplaneten Andesit als Schauplatz. Auf dieser dritten Handlungsebene mit der Matriarchin Bronja als zentraler Figur lernen wir all die Konfliktlinien kennen, die sich durch die andesitische Gesellschaft ziehen: Zwischen den Geschlechtern, zwischen den adeligen Handelshäusern, zwischen Adel und Arbeiterschaft (auf die Frage nach Arbeiterrechten antwortet Bronja nur verständnislos mit "Welche Rechte?") und zwischen den menschlichen Kolonialherren bzw. -damen und der Urbevölkerung des Planeten.
Wie Falkes Roman endet übrigens auch "Der Schwarm der Trilobiten" etwas hastig - als müsste noch schnell über die Ziellinie dieser Etappe gehechtet werden, ehe sich das AutorInnenkarussell von "D9E" weiterdreht (Dirk van den Booms zweiter Beitrag zum Shared Universe, "Ein Leben für Leeluu", ist gerade frisch erschienen). Die oben aufgezählten Faktoren und Boos' sympathische Hauptfiguren - inklusive Bronja als the character you love to hate - lassen jedenfalls auf eine Rückkehr in diesen Teil des "D9E"-Universums hoffen.

Norbert Stöbe: "Der Durst der Stadt"
Broschiert, 294 Seiten, € 11,90, p.machinery 2014
Eine Empfehlung für Freunde des Kurzformats: Das Buchcover ist zwar etwas ... bunt. Darunter sind jedoch einige Erzählungen versammelt, die's durchaus in sich haben, durchgehend gut bis sehr gut sind – und streckenweise bemerkenswert düster.
Selbst wer den Namen Norbert Stöbe nicht gleich auf dem Schirm hat, dürfte von ihm mit ziemlicher Sicherheit schon etwas gelesen haben: Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Autor arbeitet nämlich als Übersetzer und hat auch einige hier schon besprochene Bücher ins Deutsche übersetzt (z.B. Alastair Reynolds' "Haus der Sonnen" oder Sean Cregans "Das Areal"). Eigene Erzählungen veröffentlichte er von den 80ern bis Mitte der 90er, legte dann eine längere Pause ein, bis er vor ein paar Jahren die Schriftstellerei wieder aufnahm. Die Sammlung "Der Durst der Stadt" umfasst zehn Erzählungen aus den Jahren 1992 bis 2013, darunter auch eine, die bislang (unverständlicherweise) unveröffentlicht geblieben ist.
Fundstücke aus den 90ern
Die älteste Geschichte, "Zehn Punkte" aus dem Jahr 1992, zeigt, wie schnell die Zeit gerade über Science Fiction hinweggehen kann. Nicht nur, dass man hier gleich zu Beginn mit einem ganzen Schwall an Wörtern geflutet wird, die alles andere als SFische Assoziationen wecken (Sparkasse, Telefonbuch, D-Mark ... von Commodore ganz zu schweigen). Auch der Plot von einem Spieler, der in der virtuellen Welt die tollsten Abenteuer erlebt, während sein vernachlässigter Körper wie eine Made im Sensoranzug hängt, wirkt leicht angejahrt – wenn er auch nicht so endet, wie man es zu ahnen glaubt. Die Erzählung zeigt aber noch etwas anderes: Nämlich dass Stöbe einen guten Lesefluss erzeugen kann – und das ist das wichtigere Resümee. Und die Stories selbst werden interessanter.
Die mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnete Novelle "Der Durst der Stadt" verlegt Killerspiele gewissermaßen in die Realität. Denn während sich der Großteil der Bevölkerung ins Netz eingestöpselt hat, schleichen soziopathische Technikverweigerer wie Wölfe durch die Nacht und gehen ihrem Vergnügen auf der Straße nach – wie die Serienmörderin Sony. Bis sie an den Falschen gerät und entführt wird. Der verschrobene Einzelgänger Bruno, eine Art autodidaktischer Universalgelehrter, hält Sony über Monate hinweg gefangen und macht sie zum Gegenstand seines persönlichen Projekts. Halb Psychoduell zwischen einsamer Seele und personifizierter Bockigkeit, halb Geschichte einer zaghaften Annäherung, bleibt die dunkle Erzählung bis zum Schluss hochspannend.
Ja, und dann ist da noch meine Lieblingsgeschichte in diesem Band – erstaunlich, dass die zuvor nicht veröffentlicht werden konnte/sollte/wollte. "C & R" schildert in einer Abfolge schneller Eindrücke ein Leben im Zeitraffer. Ein Leben, das fast von Geburt an in zwei Welten geführt wird, eben C und R (ich tippe auf Cyberspace und Realität). Die Geschichte wertet nicht, welche der Welten die "bessere" oder die "richtige" ist. Und trotz ihrer experimentellen Form ist sie eine der menschlichsten Erzählungen zum Thema, die ich bislang gelesen habe.
Back to business
Danach folgte wie gesagt eine längere Pause, aus der Stöbe schließlich mit erweiterter thematischer Bandbreite zurückkehrte. Von Anklängen an Golden-Age-SF über Cyberpunk bis zu Horror reicht die Palette. Letzteres ist beispielsweise in "Monster" der Fall, in dem ein Journalist auf einer gigantischen Müllhalde nahe Kairo Fällen verschwundener Kinder nachgeht und dabei auf etwas Unerwartetes stößt.
Handlungskonflikte wie aus dem Goldenen Zeitalter der Science Fiction bieten – in modernisierter Form – "Klondike" und "Rette mich". In "Klondike", das der Welt der TV-Serie "Äkta Människor/Real Humans" entnommen sein könnte, erleidet eine Vater-Sohn-Beziehung einen dauerhaften Riss – genregemäß codiert durch den Umstand, dass der Sohn sich zum ersten Mal bewusst macht, dass sein idealisierter Vater in Wirklichkeit ein Androide ist. Auch "Rette mich" dreht sich um die Frage, ob Maschinen eine Seele haben können. Hier soll ein Mitarbeiter des Sozialamts eine Zwangsräumung in einer Messie-Wohnung durchführen. Und der Messie hortet nicht etwa Tiere, sondern Roboter, die durch ein Virus Ansätze zur Eigenständigkeit entwickelt haben.
Geschichten mit Geheimnis
Sehr viel düsterer kommt "Da im Glück" daher, das sich um eine Kleinfamilie dreht, die in einer offenbar kaputten Stadt wie in einem bewachten Gefängnis lebt ... wenn man es denn leben nennen kann. Stöbe legt einige Fährten, wie das hoffnungslose Szenario entstanden sein könnte (Seuchen? Außerirdische??), liefert aber keine endgültige Antwort. Und auch das zeichnet viele seiner Erzählungen aus: Er lässt ihnen ihr Geheimnis, was ihre Wirkung durchgehend erhöht.
Am rätselhaftesten von allen gibt sich "Schwarze Schwäne". Hier forschen einige WissenschafterInnen seit Jahrzehnten vergeblich an einem Big Dumb Object in der sibirischen Taiga herum – skurrilerweise wird jede/r von ihnen von einem tierischen Familiar (gibt's dafür auf Deutsch wirklich nur das Wort "Hausgeist"?) begleitet. Es wird sich zeigen, dass das Phänomen zeitlich mit dem Anfang und Ende einer Beziehung zusammenfällt – eine explizite Lösung des Rätsels bleibt uns jedoch verwehrt.
Wirklichkeit, die zwischen den Fingern zerrinnt
Auf das Thema Virtuelle Realitäten hat Stöbe freilich nicht vergessen. In zwei Geschichten gibt es ihm sogar Gelegenheit, seine Figuren im Stil von Philip K. Dick ihre Identität hinterfragen zu lassen. So muss in "Die Farbe Blau" ein Mann erleben, wie sich seine Wirklichkeit in Details zu verändern beginnt (wenn man es denn ein Detail nennen kann, dass morgens eine Fremde in seinem Bett liegt und behauptet, seine Frau zu sein, ehe sie sich wieder in Luft auflöst). Der Satz "C ist Spaß und R ist Arbeit" aus der Geschichte "C & R" würde übrigens auch hier sehr gut passen.
Das ebenso verwirrende wie faszinierende "Wie Götter" schließlich, die zweite längere Erzählung in dieser Sammlung, schichtet mehrere Realitätsebenen übereinander. Es beginnt im Stil von Cyberpunk und geht über in ein Ping-Pong von virtuellem Fantasy-Rollenspiel und ernüchterndem Leben im Prekariat. Allerdings erodiert zunehmend jede Gewissheit, was wirklich ist und was nicht – um letztendlich in die existenziellste Ungewissheit zu münden, die man sich vorstellen kann. Der iGod Steve ist nebenbei bemerkt ein herrliches Detail der Geschichte – doch wer weiß, in 20 Jahren klingt das vielleicht schon ähnlich antik wie "Commodore". Soll uns aber nicht kümmern: Hier und jetzt ist das sehr guter Lesestoff.
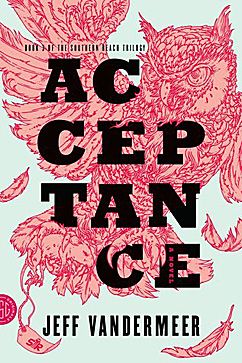
Jeff VanderMeer: "Acceptance"
Broschiert, 341 Seiten, FSG 2014
Und hiermit geht eines der spannendsten Phantastik-Projekte des Jahres zu Ende. Science Fiction? Fantasy? Horror? Mystery? Psychologische Mainstreamliteratur? Das haben wir uns während der Lektüre der Vorgängerbände "Annihilation" und "Authority" mehr als einmal gefragt – und hinter diese Fragezeichen wird der dritte Teil der "Southern Reach"-Trilogie nun einen Punkt setzen. Denn "Acceptance" wird tatsächlich klären, was hinter dem großen Rätsel der Reihe steckt. Und das, ohne ihr den Nimbus des Geheimnisvollen zu nehmen, der sie so einzigartig gemacht hat.
Für diejenigen, die von der Reihe jetzt zum ersten Mal lesen, lässt sich das Grundszenario immer noch recht einfach zusammenfassen: Im Südosten der USA hat sich ein Area X genanntes Phänomen etabliert, das auf eine schwer zu konkretisierende Weise die Natur verändert. Insbesondere alle Menschen, die die Region betreten, vereinnahmt es – psychisch und schließlich auch körperlich. Klingt simpel, trotzdem kann nur davon abgeraten werden, Band 1 und 2 zu überspringen: Zu viele Handlungsfäden hat Jeff VanderMeer bereits gesponnen, um deren nun erfolgende Verknüpfung ohne Vorwissen zu verstehen.
Auf drei Spuren
"Acceptance" ist auf drei Handlungsstränge und ebenso viele Zeitebenen aufgeteilt: Vor bzw. bei dem ersten Auftreten des Phänomens, während der Jahre der fruchtlosen Forschungen an Area X und schließlich nach den Geschehnissen von Band 2, an dessen Ende das lange stabile Areal plötzlich in verheerender Weise zu expandieren begann.
Hauptfigur des ersten Strangs ist der Leuchtturmwärter Saul Evans, der uns – vielleicht – in den Bänden zuvor bereits als vollkommen mutiertes Wesen begegnet ist: Als The Crawler, jenes Wesen, das damit beschäftigt ist, die Wände einer abwechselnd als "Turm" und "Schacht" bezeichneten räumlichen Anomalie mit einem endlosen, wie eine Beschwörung klingenden Satz vollzuschreiben: Where lies the strangling fruit that came from the hand of the sinner I shall bring forth the seeds of the dead ... und immer so weiter, ohne Ende. Worte, die sich gerade so eben dem wirklichen Verstehen entziehen – eine Eigenschaft, die stellvertretend für die magische Atmosphäre der Trilogie insgesamt steht.
In "Acceptance" lernen wir nun den Menschen Saul Evans kennen: Als jemanden, der – wie viele andere Figuren der Reihe – Entwurzelung und Entfremdung von seiner Vergangenheit erlebt, aber auch ein spätes Liebesglück gefunden hat – als wollte der Autor noch einmal die Normalität betonen, die bald verloren gehen wird. Saul muss sich mit zwei MitarbeiterInnen der mysteriösen Organisation Séance & Science Brigadeherumärgern, die rund um seinen Leuchtturm seltsamen Phänomenen nachschnüffeln und ihn zunehmend beunruhigen. Bis Saul eines Tages ähnlich wie die Hauptfigur in Band 1 von etwas Unbekanntem infiziert wird und sich in subtiler Weise zu verändern beginnt.
Spur 2 und 3
Im zweiten Handlungsstrang – der Gegenwart – begleiten wir zwei Figuren aus den Vorgängerbänden bei ihrer Rückkehr in Area X: "Control", den Direktor der Southern-Reach-Behörde, die für die Erforschung des Areals zuständig ist; und die Frau, die sich "Ghost Bird" nennt. Äußerlich scheint sie die Biologin, Hauptfigur aus Band 1, zu sein. In Wahrheit ist sie jedoch eine Kopie, Ergebnis eines weiteren Assimilationsversuchs durch Area X. Und wie sich herausgestellt hat, lässt sich diese Kopie genauso ungerne fremdsteuern wie ihr Original.
Auf der dritten Ebene schließlich, zeitlich zwischen den beiden anderen angesiedelt, erleben wir einige bereits bekannte Geschehnisse noch einmal aus neuer Perspektive mit. Und zwar aus der Sicht von Cynthia respektive Gloria, der früheren Southern-Reach-Direktorin, die sich inkognito in die Expedition der Biologin eingeschmuggelt hatte. Ihr Ende kennen wir bereits – nun lernen wir auch die Motive für ihr streckenweise befremdliches Handeln kennen. Und wir erfahren, dass sie eine sehr persönliche Beziehung zu der Region hat, die nun Area X heißt.
Vielschichtiges Werk
Die Aufgliederung in verschiedene Zeitebenen spiegelt den Grundcharakter der Trilogie wider, in der Eindrücke und Erinnerungen so stark ineinanderfließen, wie es der innere und der äußere Kosmos tun: Die Werke von J. G. Ballard scheinen mir immer noch diejenigen zu sein, die dem Ton der "Southern Reach"-Trilogie am nächsten stehen. Mit Sicherheit haben die Betonung der psychologischen Aspekte – anstelle explizit ausgesprochener Genre-Elemente – und die maximale Offenheit für Interpretationen dazu beigetragen, dass die Trilogie über die Phantastik hinaus rezipiert wurde. Und nicht zu vergessen, dass sie sowohl in der englischen als auch in der deutschen Ausgabe (siehe nächste Seite) bei Verlagen herausgekommen ist, die nicht zum üblichen Genre-Pool gehören.
Ein Interpretationsansatz, den ich zuvor noch nicht genannt habe, sollte auch noch erwähnt werden: Entfremdung ist wie gesagt ein großes Thema der drei Bücher. Und die Entfremdung des Menschen von der Natur ist auf jeder Seite der drei Bücher fast mit Händen zu greifen, so stark wirkt das Unwohlsein der Figuren im Angesicht der als "hyperrealistisch" beschriebenen Natur von Area X. VanderMeer bezieht sich auf Rachel Carson ("Silent Spring") und die Umweltkapitel des aufsehenerregenden französischen Essays "Der kommende Aufstand". Mehrfach werden in den drei Romanen zudem massive Umweltverschmutzungen erwähnt, und schon in Band 1 gab es Andeutungen von Menschen, die assimiliert und in örtliche Fauna umgewandelt wurden. Ökologie ist also ein wichtiges Thema der Trilogie – das soll aber nicht heißen, dass sie auf ein simples Nature-strikes-back-Szenario hinausläuft.
Und?!?
Naja, dann bleibt eigentlich nur noch die eine unvermeidliche Frage: Hat "Southern Reach" ein befriedigendes Ende? Mystery-artige Plots neigen ja nur allzu oft dazu, mit der Auflösung den Zauber des zuvor so sorgsam Aufgebauten zu pulverisieren und einen schalen Nachgeschmack zu hinterlassen. Nicht so hier. Surft man durch die diversen Rezensionen und Feedbackvergaben, dann zeigt sich jedenfalls, dass die Enttäuschten eindeutig in der Minderheit sind, obwohl am Ende einige Fragen erwartungsgemäß offen bleiben. Am schönsten ist es vielleicht im Magazin "Slate" zusammengefasst worden: a frustrating triumph. Auf jeden Fall ist das Ende befriedigender als das von "Lost".

Hinweise, Hinweise, Hinweise
Ich kann nur immer wieder empfehlen, auch englischsprachige Bücher zu lesen. Und das ausdrücklich nicht aus einer "Keine Übersetzung ist so gut wie das Original"-Haltung heraus. Sondern weil die Auswahl und die thematische Bandbreite dann so unglaublich viel größer werden, gerade in der Phantastik. Auf Englisch soll's sogar Fantasy-Romane geben, in denen keine Zwerge vorkommen (ist aber vielleicht auch nur 'n Gerücht).
Bei zwei wirklich großartigen Werken - beide aus dem aktuellen Kalenderjahr! - ist es nun aber nicht mehr notwendig. Vor kurzem ist im Verlag Antje Kunstmann der erste Band von Jeff VanderMeers "Southern Reach"-Trilogie (siehe die vorherige Seite) herausgekommen: "Auslöschung" ("Annihilation"). Band 2, "Autorität" ("Authority"), erscheint Mitte Jänner 2015, der Abschluss mit dem gerade erst besprochenen "Akzeptanz" schon zwei Monate später. Guter Griff!
Ebenfalls schnell geschaltet hat der Heyne-Verlag und Everybody's Darling von 2014 übersetzt: Andy Weirs formidablen MacGyver-auf-dem-Mars-Roman "The Martian". Den muss man einfach mögen. Die deutsche Fassung "Der Marsianer" erscheint am 13. Oktober.
Expansion in die Bilderwelt
Des Weiteren: Wer es noch nicht bemerkt hat - unser lange geforderter Comic-Blog ist mittlerweile angelaufen und nennt sich Pictotop. Eben hat Kollegin Karin noch den staatlichen Förderpreis für Wissenschaftspublizistik entgegengenommen, schon antwortet sie mit dem ersten Blog-Eintrag in Sachen Bildliteratur - that's the spirit!
Auf den Namen des Blogs blicke ich indes mit ein wenig Neid. Da sieht man nämlich, was ein bisschen konzeptionelle Planung ausmacht. Hätte ich seinerzeit geahnt, dass aus dem "Stellen wir doch mal ein paar SF-Rezensionen online und schauen, ob's wen interessiert"-Experiment etwas Längerfristiges wird, hätte ich mir nämlich auch einen besseren Namen überlegen können als ... Rundschau *seufz*. Aber jetzt heißt das Ding halt so - ein weiteres Beispiel dafür, dass Provisorien am längsten halten.
Fortsetzung folgt
Womit auch schon die Überleitung zu den traditionellen Schlussworten "In der nächsten Rundschau ..." hergestellt wäre. Unter anderem werden wir uns nächstes Mal anschauen, ob Larry Niven und Gregory Benford im zweiten Teil ihrer Geschirrwelt (das Rennen zwischen "Schüssel" und "Tasse" ist noch nicht entschieden) vielleicht doch noch ein bisschen alten Ringwelt-Zauber zusammenkratzen können. Wir besuchen das Universum, das George R. R. Martin vor dem "Lied von Eis und Feuer" geschaffen hat. Und wir warten gespannt auf den Briefträger, der hoffentlich rechtzeitig die Antwort auf die Frage bringt, wie sich Special Agent Dana Scully alias Gillian Anderson als Romanautorin macht. (Josefson, derStandard.at, 27. 9. 2014)