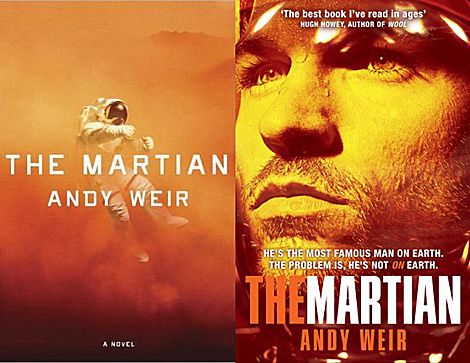
Andy Weir: "The Martian"
Gebundene Ausgabe, 369 Seiten, Crown/Del Rey 2014
Die Kommentare zu Andy Weirs großartigem Roman "The Martian" gliedern sich im Wesentlichen in zwei Lager: "Robinson Crusoe auf dem Mars" und "MacGyver auf dem Mars" - mit einer beträchtlichen Schnittmenge aus beidem. Die Grundidee ist ja auch bestechend: Als eine Mars-Expedition der nahen Zukunft zu einer hastigen Abreise vom Roten Planeten gezwungen wird, bleibt eines der Mitglieder durch eine Verkettung unglücklicher Umstände allein zurück und wird für tot gehalten. Doch Mark Watney lebt. Und ist wild entschlossen, das Unmögliche zu schaffen und die Jahre bis zum Eintreffen der nächsten Expedition zu überleben.
Und da sitzt Mark nun auf Acidalia Planitia nördlich des Marsäquators in seinem Mini-Habitat ohne Kommunikationsverbindung zur Erde. Und rechnet durch, wie lange seine Vorräte reichen - "I'm pretty much fucked", lautet folgerichtig der erste Satz des in Tagebuchform geschriebenen Romans. Energie und dank Recycling auch Atemluft sind noch das geringste Problem, die Nahrungsvorräte hingegen werden lange vor jeder Rettungsmöglichkeit aufgebraucht sein. Bis Mark - er war sowohl der Mechaniker als auch der Botaniker der Expedition - eine erste rettende Idee hat. Warum nicht die paar Kartoffeln nützen, die die NASA für ein marsianisches Thanksgivingmahl mitgeschickt hat, und das Habitat samt sämtlichen Außenstellen - es geht um jeden halben Quadratmeter! - in eine Mini-Plantage umwandeln? Düngen kann er selbst: My asshole is doing as much to keep me alive as my brain.
Die große marsianische Knoff-Hoff-Show
"The Martian" ist die Erfindung eines neuen Subgenres, der Heimwerker-Hard-SF. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, so etwas schon einmal in solch atemberaubender Detailausgestaltung gelesen zu haben. Mark ist über alle Maßen erfindungsreich, wenn es darum geht, die wenigen ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen zu nutzen und umzufunktionieren. Da wird in lebensgefährlicher, aber leider alternativloser Weise Wasser aus Sauerstoff- und Wasserstoffvorräten erzeugt. Da dient das Plutonium einer Radionuklidbatterie durch seine Wärmeabstrahlung kurzerhand als Heizkörper. Und mit Klebeband lassen sich sowieso wahre Wunderwerke vollbringen.
Der US-amerikanische Autor Andy Weir hat sich für seinen Debütroman ohne jede Frage mächtig in die Themen Astronomie, Physik, Chemie und Raumfahrttechnologie reingekniet, damit Marks Patentlösungen zumindest theoretisch möglich sind. Ob das alles in der Praxis und im Detail tatsächlich so funktionieren würde, da maße ich mir mangels mechanischen Talents keine Meinung an. Ich akzeptiere das jetzt genauso, wie ich es damals hingenommen habe, wenn MacGyver aus einem Kondom und einer Hustinette ein Amphibienfahrzeug gebaut hat. Als positives Zeichen darf man jedoch werten, dass nicht nur Hard-SF-Autoren wie Stephen Baxter und Larry Niven Weirs Recherchearbeit Lob aussprechen, sondern auch NASA-Astronaut Chris Hadfield.
Marks Meisterstück dürfte eine lange Überlandfahrt zur Bergung der alten "Pathfinder"-Sonde sein, über die er es tatsächlich schafft, wieder Kontakt zur Erde aufzunehmen ("Now that NASA can talk to me, they won't shut the hell up ... I mostly ignore them. I don't want to come off as arrogant here, but I'm the best botanist on the planet"). Auf der Erde verfolgt inzwischen längst die ganze Weltbevölkerung via Satellit Marks Überlebenskampf, während die NASA unter Hochdruck an Rettungsplänen feilt. Diese zweite Handlungsebene gibt übrigens eine recht gute Auflockerung - um nicht zu sagen: Atempause - ab. Denn "The Martian" ist mit 370 Seiten zwar kein megalanger Roman, aber lange genug, dass ein Gefühl von Enge aufkommen könnte, wenn wir nur bei Marks Perspektive blieben. Für ihn ist Enge natürlich der Alltag.
Heimwerken auf der Meta-Ebene
"The Martian" ist die nächste dieser neuen Selfpublishing-Erfolgsgeschichten à la Hugh Howeys "Silo" (Howey hat passenderweise auch einen Blurb auf dem Buchcover beigesteuert). Ursprünglich 2011 als E-Book veröffentlicht, entwickelte sich der Roman zu einem derartigen Erfolg, dass er von der Verlagsgruppe Random House gekauft und heuer als Hardcover wiederveröffentlicht wurde. (Links oben das Cover der US-Version von Crown, rechts die britische von Del Rey.) Und damit nicht genug: Die Twentieth Century Fox hat sich bereits für die Filmrechte interessiert. Die möchten offenbar nach Universals "Apollo 13" und "Gravity" von Warner Bros ihr eigenes Stück Weltraumunfall-wird-zur-Heldengeschichte haben. Mit US-typischer "Du schaffst alles, wenn du nur willst"-Philosophie, Pioniergeist und zu Tränen rührendem "Rettungsaktion, bei der die ganze Welt mitmacht"-Plot. Wenn das kein Leinwanderfolg wird, weiß ich auch nicht.
Ursprünglich dachte ich, die bestechend einfache Prämisse der Geschichte wäre der Grund für ihre Popularität. Beim Lesen hat sich allerdings rasch herausgestellt, dass es in Wirklichkeit der Ton ist, in dem sie erzählt wird. Allein auf dem Mars: Das schreit ja förmlich nach Verzweiflung oder bestenfalls nach Melancholie. Doch nix da. Mark verzagt abgesehen von einem einzigen kurzen Wutanfall niemals. Er geht ein Problem nach dem anderen an, analysiert es und findet eine Lösung. Und gönnt sich zwischendurch mal ein Päuschen mit Aufzeichnungen alter TV-Serien.
"He's stuck out there. He thinks he's totally alone and that we all gave up on him. What kind of effect does that have on a man's psychology? ... I wonder what he's thinking right now", rätseln sie bei der NASA. Hätten sie zu der Zeit schon Kontakt gehabt, hätte die Antwort sie eher verblüfft: "How come Aquaman can control whales?", denkt Mark da nämlich gerade. Geekige Verweise in grade dem richtigen Ausmaß tragen das ihrige zur Auflockerung des Romans bei, der zu ganz wesentlichen Teilen von seinem Humor lebt. Da hat Mark (bzw. Weir) ein echtes Händchen für, das muss man ihm lassen. Sogar der alte Busenwitz (.Y.) kann zünden, wenn er mit dem richtigen Timing serviert wird.
Empfehlung!
Wenn man streng ist, muss man natürlich kritisieren, dass Mark als Hauptfigur zu idealisiert dargestellt wird. Wär er kein scharfsichtiger Analytiker, der jedem Problem penibel und unglaublich diszipliniert auf den Grund geht, hätte er schon nach wenigen Seiten in den Marssand gebissen. Trotzdem wird er - ist schließlich viel liebenswerter - als Witzbold dargestellt, der am laufenden Meter zitierfähige Pointen liefert. Ein unerschütterlicher Optimist ist Mark sowieso. Und wenn er endlich Kontakt zur Erde bekommt, dann ist sein erster Gedanke vollkommen selbstlos: Sagt meiner Crew, dass sie keine Schuld trifft. Andere könnten vielleicht einen gewissen Groll hegen, wenn man sie allein auf einem Planeten hocken lässt, aber so tickt unser Mark eben nicht.
... andererseits kann einem beim Lesen auch Schlimmeres begegnen als die sympathischste Hauptfigur seit langem. Ich war abwechselnd gespannt, verblüfft und gerührt, habe oft gegrinst und ein paar Mal laut aufgelacht. Kurz: "The Martian" ist ein echter Pageturner.
P.S.: Danke an User "shutterbug" für den Tipp! Da hätte ich echt was verpasst.
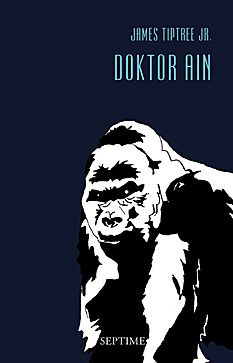
James Tiptree Jr.: "Doktor Ain"
Gebundene Ausgabe, 440 Seiten, € 23,90, Septime 2014
Der stämmige Bürger rauschte an der Vorzimmermieze vorbei und platzte durch die Innentür. Mit diesem ersten Satz der ersten veröffentlichten Kurzgeschichte von James Tiptree Jr. begann 1968 eine Karriere wie keine andere. Und es ist ein überaus passender Satz, denn er bringt auf den Punkt, was Tiptrees früheste Erzählungen vor allem anderen auszeichnet: Tempo. Es schwindelt einen beim Lesen geradezu, wenn in dieser Debüt-Erzählung ("Geburt eines Handlungsreisenden"/"Birth of a Salesman") ein Logistik-Unternehmen damit beschäftigt ist, absurde Produkte via Transmitternetz zu Planeten mit absurden Namen zu schicken, wo sie bei diversen Alienvölkern absurde Reaktionen auslösen. Mit dem Ergebnis eines bürokratischen Regel-Overkills, der hier in einen Telefonwirbel sondergleichen mündet. Am Ende ist man platt.
"Geburt eines Handlungsreisenden" ist das, was ich gerne Wirtschaftswunder-SF nenne: Ein überzeichnetes, aber tendenziell positives Bild der modernen Zeit. Im Grunde hätte es auch schon zehn oder vielleicht sogar zwanzig Jahre früher geschrieben werden können. Zu Beginn ihrer SF-Karriere war Alice B. Sheldon, die sich hinter dem Pseudonym James Tiptree Jr. verbarg, zwar schon eine deutlich überdurchschnittliche Stilistin - aber eben doch noch eher konventionell unterwegs.
Anfangs war es noch Humor ...
Die Vor- und Zurück-Politik, mit der der Septime-Verlag Tiptrees Gesamtwerk veröffentlicht, erweist sich allmählich als überaus raffiniert. Den Anfang machten die späten "Quintana Roo"-Geschichten, die mit ihrem Magischen Realismus einen sanften Übergang vom Mainstream-Programm des Verlags zum SF-Werk Tiptrees bildeten. Es folgten mit "Zu einem Preis" und "Houston, Houston!" Erzählungen aus Tiptrees goldener Schaffensperiode. Und nun geht es zurück zu den Anfängen, die vielleicht noch nicht Tiptrees spätere Brillanz zeigen - aber zumindest schon mal sehr unterhaltsam sind.
Zu dieser Frühphase gehören auch "Treu dir, Terra, auf unsere Art ("Faithful to Thee, Terra, in Our Fashion"), das im Grunde die Formel des "Handlungsreisenden" wiederholt und sie auf einen Planeten anwendet, auf dem Wettrennen mit allen möglichen und unmöglichen Tieren veranstaltet werden. Dito zwei in fidelem Ton erzählte Geschichten, in denen es die Menschheit mit Außerirdischen zu tun bekommt: Riesige Superfrauen von der Capella auf der Jagd nach männlichen Sexsklaven in "Mama kommt nach Hause" ("Mama Come Home"), fundamentalistische Missionare von Cygnus in "Hilfe" ("Help"). In beiden Geschichten gilt es, die Eindringlinge auszutricksen, zudem ließ Sheldon hier ihre eigene Geheimdienst-Vergangenheit einfließen, was entscheidend zum späteren Tiptree-Mythos beitragen sollte.
... doch dann folgt das Grauen
Der Titel des aktuellen Bands ist ebenfalls gut gewählt, denn die dazugehörige Erzählung "Doktor Ains letzter Flug" ("The Last Flight of Dr. Ain") gilt als erster Wendepunkt in Tiptrees Schaffen. Hier klingt bereits vieles an, was später als typisch Tiptree gelten sollte: Eine zum Scheitern verurteilte Liebesbeziehung - in diesem Fall zwischen einem Biologen und niemand Geringerem als Gaia selbst -, die Gleichsetzung von Liebe und Tod und so ganz nebenbei die Auslöschung der ganzen Menschheit. Zudem wählte Tiptree hier erstmals einen Aufbau, der die LeserInnen bis zum finalen Schlag in den Magen im Ungewissen belässt. Wie es Tiptree-Biografin Julie Phillips im Nachwort ausdrückt: Die Geschichte scheint am Ende anzufangen, aber beim Lesen entdecken wir, dass wir uns mitten in einer Kriminalgeschichte befinden und wir das Opfer sind.
Die übrigen Geschichten lassen sich am ehesten auf den gemeinsamen Nenner "Begegnungen mit dem Fremden" bringen. In "Ich bin zu groß, aber ich spiele gern" ("I'm Too Big, but I Love to Play") manifestiert sich ein gigantisches interstellares Vakuumwesen in Menschengestalt, scheitert mehrfach auf buchstäblich explosive Weise daran, sich dem menschlichen Denken anzupassen, macht aber unverdrossen weiter. Thematisch verwandt "Dein haploides Herz" ("Your Haploid Heart"), in dem ein Biologe ein Alienvolk daraufhin untersucht, ob es sich als menschlich klassifizieren lässt. Im Eifer zu gefallen hat die betreffende Spezies ihre biologische Vergangenheit vergessen - und ist deshalb drauf und dran, sich selbst auszulöschen.
Im Vergleich dazu nimmt sich das humorvolle "Glück ist ein wärmend Raumschiff" ("Happiness Is a Warm Spaceship") eher seicht aus: Die Geschichte handelt vom korrekten Admiralssohn Quent, der im Rahmen eines galaktischen Integrationsprogramms mit einer Schiffscrew voller exzentrischer Außerirdischer konfrontiert wird. Immerhin zeigt die Erzählung, dass in Tiptrees früher Phase ein Happy End nicht unbedingt ausgeschlossen war: Siehe auch "Beam uns nach Hause" ("Beam Us Home"), in dem ein begabter Junge der festen Überzeugung ist, dass er einst von einem Raumschiff heimgeholt werden wird - selbst dann noch, als er als Soldat in einem dreckigen Dschungelkrieg steckt.
Erzählerische Fundgrube
Weniger Glück hat der Jungforscher Evan in "Und auf verlorenen Wegen fand ich diesen Ort" ("And I Have Come upon This Place by Lost Ways"), der sich dem schematisierten Denken seiner älteren Kollegen widersetzt und sich im Alleingang aufmacht, das Geheimnis eines fremden Planeten zu ergründen. Denn belohnt wird sein Mut nicht: Heldentum, das paradoxerweise zum Tod führt, beschreibt Phillips ein weiteres Tiptree-typisches Motiv. "Der Schnee ist geschmolzen, der Schnee ist fort" ("The Snows Are Melted, the Snows Are Gone") schließlich liefert uns ein archaisches Bild: ein Mädchen, das von einem Mann durch die Wildnis verfolgt wird. Doch ist in dieser neoeiszeitlichen Welt der Mann die eigentliche Beute ...
Mir würden spontan an die 20 Kurzgeschichten einfallen, mit denen ich illustrieren könnte, warum James Tiptree Jr. eine derart herausragende Erscheinung war. An "Schuld" ("Fault") konnte ich mich nicht mehr erinnern - zu Unrecht offenbar. Als früher thematischer Vorläufer zum bekannten "The Man Who Walked Home" erzählt die Geschichte von einem Mann, der aus der Zeit fällt. Ein außerirdisches Volk hat ihn für ein Vergehen damit bestraft, dass er seine Umgebung immer stärker verzögert wahrnimmt - eine vermeintlich sanfte Strafe mit schrecklichen persönlichen Folgen. Anfangs Unverständliches fügt sich am Ende dieses Frühwerks nahtlos zusammen - eine echte Wiederentdeckung! Was zugleich für die gesamte Tiptree-Neuausgabe gilt, die zum Glück noch mit einer ganzen Reihe weiterer Bände aufwarten wird.
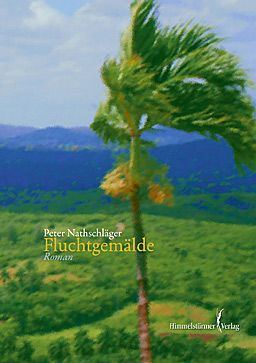
Peter Nathschläger: "Fluchtgemälde"
Klappenbroschur, 383 Seiten, € 17,40, Himmelstürmer 2014
Direkt im Anschluss an James Tiptree Jr. scheint mir eine ganz gute Stelle zu sein, den neuen Roman von Peter Nathschläger vorzustellen. Zugegeben, es ist eher Zufall, dass der Wiener Autor in der Rundschau bislang nur mit Kurzgeschichten - also dem Tiptree-Format - vertreten war ("Wo die verlorenen Worte sind"); hauptsächlich schreibt er Romane. Dafür gibt es ein paar andere interessante Parallelen. Bei beiden AutorInnen liegen Liebe und Tod oft nah beieinander, beide haben zudem herkömmliche - oder herkömmlich gewesene - Genderrollen erodiert.
Fluchten und deren Folgen
Am verblüffendsten finde ich aber, dass beide ihren persönlichen Fluchtpunkt in Lateinamerika fanden, und gar nicht allzuweit voneinander entfernt: Tiptree im mexikanischen Quintana Roo, Nathschläger auf Kuba. Und sei es die literarische Tradition Lateinamerikas oder seien es die positiven Assoziationen zu diesem Zufluchtsort - die entspannte Teilzeit-Heimat hat sowohl Tiptree als auch Nathschläger (die beide ihre menschheitsausrottend-drastischen Seiten haben) dazu inspiriert, im Stil des Magischen Realismus zu schreiben.
... "dem softesten aller Phantastik-Subgenres", hätte ich fast noch ergänzt. Soft ist im beeindruckenden Roman "Fluchtgemälde" allerdings trotz seines poetischen Grundmotivs von Bildern, in die man sich aus der Welt flüchten kann, das wenigste. Und das nicht nur, weil Nathschläger bei den Schilderungen von sowohl Gewalt als auch Sex - übrigens sind sämtliche Protagonisten des Romans schwul - explizit bleibt. Sondern vor allem, weil sich hier auf leisen Sohlen eine waschechte Apokalypse zusammenbraut.
Virtuelle oder sonstige Weltfluchten sind ein gängiges Motiv in der Phantastik. "Fluchtgemälde" widmet sich allerdings verstärkt der Frage, was aus einer Welt wird, die von so vielen verlassen wird. Denn es sind nicht unbedingt die schlechtesten, die da aus durchaus nachvollziehbaren Gründen flüchten - damit aber auch der Welt all ihr Potenzial, ihre künftigen Leistungen und Interaktionen mit anderen Menschen entziehen (klingt ein bisschen wie eine humanere Variante des katholischen Standpunkts zum Selbstmord ...). Die Antwort, die der Roman gibt: Wenn die Träumer gehen, gerät die Welt aus dem Gleichgewicht, die destruktiven Kräfte gewinnen die Oberhand. Das bekommt eine der Hauptfiguren im ersten Teil des Romans in sehr persönlicher und sehr gewalttätiger Weise am eigenen Leib zu spüren. Im dritten Teil, wenn sich die ganze Realität verändert, spüren es dann alle.
Drei Teile eines Drittels
Konstruktion spielt hier eine wesentliche Rolle. "Fluchtgemälde" ist der Abschlussteil einer losen Kuba-Trilogie Nathschlägers, deren vorangegangene Bände "Im Palast des schönsten Schmetterlings" und "Der Falke im Sturm" zum Verständnis aber nicht notwendig sind. Zugleich gliedert sich der Roman seinerseits in drei Teile von Novellenlänge, die untereinander in vielfältiger Weise verbunden sind - ähnlich wie die Korridore, die zwischen den verschiedenen von Gemälden erzeugten Fluchtwelten verlaufen. Und sowohl Teil 1 als auch Teil 2 beginnen damit, dass ein Bild als "Fenster" wahrgenommen wird: Im ersten Fall handelt es sich um den Prototypen einer Fluchtmalerei, im zweiten ist es ein Weg zu neuen Möglichkeiten im übertragenen Sinne - hier findet ein Teenager ein verlorenes Passfoto eines Mitschülers und verliebt sich auf der Stelle.
Vom Phantastik-Quotienten her sind die drei Teile des Romans recht unterschiedlich: Im ersten dreht sich alles um den Teenager Alejo, der in der Zeit nach der kubanischen Revolution aufwächst und bei einem Babalawo - einer Art Priester-Magier der Santería-Religion - die Kunst der Fluchtmalerei erlernt. Die beschert ihm nicht nur einen Zeitsprung in die 90er Jahre, Alejos Aufzeichnungen sind es auch, die letztlich die apokalyptischen Ereignisse des dritten Teils auslösen. Als verbindendes Element tritt der aus dem Iran stammende Kunsthändler Kouroush auf, der Alejos Notizbuch vervielfältigt, somit seinen Teil zum Verschwinden der Träumer aus der Welt beiträgt und sich deshalb im Abschlussteil auf der Flucht aus einem in Gewalt versinkenden Europa wiederfindet. Inklusive Entführung eines geparkten Passagierflugzeugs. Dass dieser Teil als Hommage an Gabriel García Márquez den Titel "Liebe in Zeiten des Untergangs" trägt, erhält eine ungeplant traurige Note, nachdem der Meister des Magischen Realismus kurz nach dem Erscheinen von Nathschlägers Roman verstorben ist.
Der Mittelteil indes bleibt weitgehend an der Realität dran, er ist sogar ausdrücklich an Geschehnisse, die sich wirklich ereignet haben, angelehnt: 2005 wurden im Iran die beiden Teenager Mahmoud Asgari und Ayaz Marhoni öffentlich hingerichtet. Offiziell, weil sie einen Minderjährigen vergewaltigt haben sollen - laut der britischen Aktivistengruppe OutRage! hingegen nur deshalb, weil sie ein schwules Liebespaar waren. Zwischen beiden Standpunkten entbrannte eine wilde mediale Kontroverse. Nur darin, dass die Hinrichtung von Jugendlichen an sich verurteilenswert ist, waren sich alle einig. Nathschläger schildert die Geschichte der beiden - einer davon der Neffe Kouroushs - aus seiner Perspektive. Er macht aus seinen Sympathien keinen Hehl, trägt der unklaren Faktenlage aber dennoch weitgehend Rechnung.
Klare Sprache
Ähnlich wie bei James Tiptree Jr. oder auch Ray Bradbury geht es Nathschläger selbst bei seinen Ausflügen in die Phantastik nicht nur darum, was erzählt, sondern auch wie es erzählt wird. Die Erzählung verknüpft sprachlich den jugendlichen Überschwang von Figuren wie Alejo, Mahmoud und Ayaz (ständig sexuell unter Strom, das beschreibt ihr Erleben der Welt überaus treffend) mit sinnlichen Schilderungen Kubas - aber auch mit sehr direkter Sprache, wenn es um Sex oder Gewalt geht. Nebenbei bemerkt: Um den Faktor Sprache ausreichend zu würdigen, hätte das Verlagskorrektorat gerne noch ein wenig sorgfältiger sein und diverse Vertippser beseitigen können.
Schon erstaunlich jedenfalls: Da hat man eine gewollt Testosteron-geschwängerte Metallica-Hommage ("Enter Sandman") und findet darin das Wort "Gesäß" wieder. Oder eine brutale Dystopie ("Asylon"), in der sage und schreibe "vier Buchstaben" zu lesen ist (das werd ich nie vergessen!). Und dann kommt hier etwas daher, das im Kern ein Bündel von Liebesgeschichten ist, in dem aber trotzdem ganz ohne gschamige Umschreibungen Wörter wie "Arsch", "ficken" oder "scheißen" fallen. Who's your daddy! Selbst ein halbes Jahrhundert nach Tabubrecher Philip José Farmer ist die Phantastik tendenziell immer noch um einiges verklemmter als die Mainstreamliteratur.
Und wenn ich schon ständig den Vergleich strapaziere, dann muss ich abschließend auf den einen gewaltigen Unterschied zwischen Nathschläger und Tiptree auch hinweisen: Nathschläger glaubt an die Liebe und an die Hoffnung, wie "Fluchtgemälde" zeigt. Das war Alice B. Sheldon alias James Tiptree Jr. nie vergönnt. Bis zu ihrem traurigen Ende nicht.
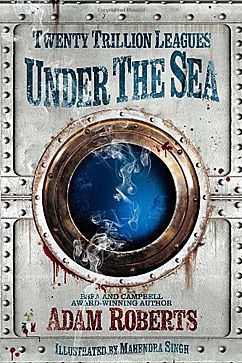
Adam Roberts: "Twenty Trillion Leagues Under the Sea"
Gebundene Ausgabe, 306 Seiten, Gollancz 2014
Ich bin gerührt. Offenbar verbindet mich mit Adam Roberts dieselbe Kindheitsenttäuschung über Jules Vernes "20.000 Meilen unter dem Meer": Die sind ja horizontal gemeint, so ein Beschiss. Wie Roberts in einem Interview bekundete, fühlte auch er sich einst vom Titel des SF-Klassikers betrogen - und fand darin die Motivation für seinen Roman "Twenty Trillion Leagues Under the Sea". Und darauf darf man sich beim Meister der High-Concept-Literatur verlassen: Hier geht es über die volle genannte Länge nach unten.
Die Prämisse ist also schon mal großartig. Erinnert mich an Rhys Hughes' Kurzgeschichte "The Old House Under the Snow", in der ein Haus im Schnee versinkt, auf dem Dach eines anderen, größeren liegenbleibt, dann zusammen mit diesem tiefer sinkt und immer so weiter - bis die Dimensionen der Häuser irgendwann die der Erde übertreffen. Oder auch an Greg Bears Roman "Äon" mit einem Asteroiden, in dessen Innerem sich ein Korridor befindet, der weit über die Ausmaße des Asteroiden selbst hinausreicht.
Zur Handlung
1958 startet das französische Atom-U-Boot "Plongeur" mit seiner neunköpfigen Crew und drei Gästen an Bord in den Atlantik; schon dem Prolog können wir entnehmen, dass danach nie wieder von ihm gehört ward. So ganz ist übrigens nicht sicher, ob es sich dabei um unser 1958 handelt, denn in ein paar Details scheint die Romanwelt doch von unserer abzuweichen. So wird z. B. einmal eine gewisse "Joan Keats" erwähnt, und das ist kein Vertippser, denn es ist explizit von einer poetess die Rede. Wirklich eine Rolle spielt das aber nicht, vielleicht wollte sich Roberts bloß einen Spaß erlauben (Denn nicht vergessen: Neben seinen ernsteren Genrewerken ist der Brite auch der Autor von Parodien wie "Der kleine Hobbnix").
Angeführt wird die rein französische und rein männliche Redshirt-Crew vom rauschebärtigen Kapitän Adam Cloche, der - ganz der Patriarch klassischen Zuschnitts - auf Einhaltung der Regeln und seine Autorität pocht. Den Bart erwähne ich übrigens deshalb, weil er noch für einen tollen Spezialeffekt sorgen wird. Und später dennoch von einem noch viel spektakuläreren Bart in den Schatten gestellt werden wird ... Cloche jedenfalls schmeckt es gar nicht, dass einer seiner drei Passagiere - neben zwei indischen Wissenschaftern - seinen Rang als Nummer 1 der Expedition nur bedingt akzeptiert: Der undurchsichtige Alain Lebret ist als Beobachter und Verbindungsmann zur Regierung mit an Bord. Dass er einst im Vichy-Regime eine leitende Position innehatte, macht ihn in den Augen der anderen natürlich noch dubioser.
Von Anfang an gibt es Spannungen an Bord - politische, rassistische und auch rein persönliche. Die verschärfen sich, wenn gleich drei Bordsysteme synchron ausfallen und die "Plongeur" von ihrem experimentellen Atomantrieb in Tiefen gejagt wird, für die sie nicht gemacht ist. Tragikomisch legen die Männer an Bord kurz vor dem vermeintlichen Ende ihre Lebensbeichten ab ... und stehen dann beklommen herum, denn das Ende bleibt aus. Weder rammt die "Plongeur" den Grund noch wird sie vom Wasserdruck zerquetscht. Stattdessen geht es weiter nach unten. Und weiter. Und weiter.
Lost under the sea
Dass der Außendruck schließlich wieder sinkt, ist die erste von vielen physikalischen Unmöglichkeiten (für die es später übrigens noch eine Erklärung geben wird, keine Sorge!). Dazu kommen bald seltsame Luftströmungen an Bord, das erratische Verhalten von Flüssigkeiten und natürlich die "simple" Tatsache, dass der Tiefenmesser unmögliche Werte anzeigt: Tiefer als jeder Ozean, tiefer schließlich als der Durchmesser der Erde.
Und so rätseln sie auf der "Plongeur": Sind sie alle längst tot und hängen in einer letzten Halluzination fest? Wurden sie in ein unendliches Universum aus Wasser (Süßwasser übrigens) versetzt? Oder etwa in den Kopf von Jules Verne? Immerhin scheinen sie die "20.000 Meilen unter dem Meer" und "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" zugleich zu erleben ... Natürlich knüpft Roberts in diesem Verne-Pastiche ans Werk des großen Franzosen an - wie genau, sei hier aber nicht verraten.
Der Adams-Effekt
Nur eines: Es kommt wieder anders, als man denkt. Was erst ein tödliches Psycho-Kammerspiel war, verbunden mit einer immer noch recht straighten Mystery-Handlung, schlägt schließlich ins Metafiktionale und ziemlich Abgehobene um. Gegen Ende erinnert "Twenty Trillion Leagues Under the Sea" an ein Mœbius-Comic - wie übrigens auch die über 30 wundervollen Schwarz-Weiß-Illustrationen von Mahendra Singh, die den Text schmücken. Das ist kunstvoll und intelligent, genau genommen aber auch ein Genrewechsel. Und den Umstieg muss man auch erst mal packen.
Erst ist man von der Prämisse und deren stilistischer Umsetzung restlos begeistert. (Herrlich etwa die altertümelnd-distinguierte Sprache der Protagonisten, very British trotz französischer Umgebung: There was something unpleasantly insectile about the fellow's motion - quite apart from his hideous appearance.) Zum Schluss bleibt aber wie schon in früheren Werken ("Swiftly", "By Light Alone", "Yellow Blue Tibia") ein diffuses unbefriedigendes Restgefühl zurück. Weil das alles unbestreitbar meisterhaft gemacht, aber wieder mal nicht komplett rund ist. Als würde man den großartigsten Popsong von überhaupt hören, der dann aber nach der Bridge nicht den erlösenden Schlussrefrain bringt, sondern irgendwie anders weitergeht. Mittlerweile nenne ich das den Adam-Roberts-Effekt - und er ist sowas von gewollt!
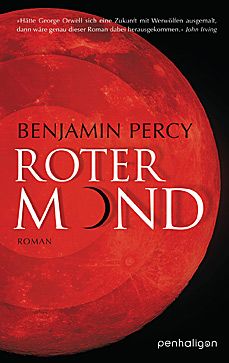
Benjamin Percy: "Roter Mond"
Gebundene Ausgabe, 640 Seiten, € 20,60, Penhaligon 2014 (Original: "Red Moon", 2013)
Unerwartet gefesselt war ich von diesem Roman - unerwartet deshalb, weil er von Werwölfen handelt, was vermutlich einen Hund, aber normalerweise nicht mich hinterm Ofen hervorlockt. Doch sind die Werwölfe - im Roman auch nicht ganz neu Lykaner genannt - nur Mittel zum Zweck, um das Bild einer zerfallenden US-Gesellschaft zu zeichnen. Und das ist schreckenerregender als jede Verwandlung bei Vollmond.
Benjamin Percy ist ein noch junger Autor, der in seinen bisherigen Werken - diversen Kurzgeschichten sowie dem Roman "Wölfe der Nacht" ("The Wilding") - die Natur seines Heimatstaats Oregon nicht nur beschrieb, sondern ansatzweise mythisch überhöhte. "Roter Mond", in dem Oregon ebenfalls einen wichtigen Schauplatz bildet, ist nun Percys erster waschechter Genreroman, Untergattung Alternate History. Wird aber wegen Percys Mainstreamvergangenheit ebenso allgemein rezipiert wie seinerzeit Philip Roths "Verschwörung gegen Amerika". Auch das war eine Alternativweltgeschichte, und trotzdem fiel keinem Feuilletonisten beim Rezensieren eine Perle aus der Krone. Genregrenzen sind eben durchlässig, vorausgesetzt man kommt aus der "richtigen" Richtung.
... siehe auch den Cover-Blurb "Hätte George Orwell sich eine Zukunft mit Werwölfen ausgemalt, dann wäre genau dieser Roman dabei herausgekommen", der von niemand Geringerem als von John Irving stammt. Auch wenn ich in "Roter Mond" keine großen Parallelen zu Orwell sehen kann - dann schon eher zum Spätwerk von Stephen King.
Die Prämisse
Sei es, wie es sei: Rein in einen ersten Infodump. Schon vor Jahrhunderten ist eine Lobos genannte Prionenkrankheit in die Menschheit eingesickert, die die Infizierten in etwas verwandelt, das nicht "Werwolf" genannt werden will. Nicht unbedingt bei Vollmond übrigens, sondern eher dann, wenn die Betroffenen in einen besonderen Erregungszustand verfallen. Später auch willentlich. Gegenwärtig sind etwa 5,2 Prozent der Bevölkerung infiziert. Die Zeiten offener Verfolgung sind vorbei, die Angst vor den Lykanern hat sich aber nur unter die Oberfläche zurückgezogen. Mit speziellen Medikamenten wird sichergestellt, dass sich registrierte Lykaner nicht verwandeln können. Allerdings haben diese Medikamente psychische Nebenwirkungen, die nicht alle Lykaner hinnehmen wollen - eine erste Konfliktlinie ist gezogen.
Eine zweite befindet sich einige tausend Kilometer weiter östlich in einem subarktischen Gebiet zwischen Finnland und Russland. Dort wurde 1948 - also im selben Jahr wie Israel - der Staat Lupos gegründet, in dem Lykaner aus aller Welt eine neue - wenn auch eisige - Heimat gefunden haben. Das US-Militär sorgt in dem von Unruhen geplagten Staat für Ordnung. Natürlich aus humanitären Gründen und nicht etwa, weil dort wertvolle Uranvorkommen entdeckt wurden ...
Star-crossed lovers
"Roter Mond" erstreckt sich mit Zeit- und Ortssprüngen über einige Jahre hinweg. Der Romanbeginn fällt in die Phase, in der der Status quo die ersten größeren Risse erleidet. Der Teenager Patrick bekommt dies sehr direkt zu spüren: Er ist an Bord eines Flugzeugs, als ein Lykaner im Rahmen eines an 9/11 erinnernden Terroranschlags systematisch sämtliche Passagiere abschlachtet. Patrick überlebt als einziger - indem er sich unter einer Frauenleiche versteckt: Kein Heldenmaterial offenbar, aus dem der leicht überspannte junge Mann da geschnitzt ist. Allerdings wird er sich im Verlauf des Romans stark weiterentwickeln - zu sehr sogar, denn im Zuge des Erwachsenwerdens wird er einen Teil seiner Seele verlieren.
Patricks Gegenstück ist die etwa gleichaltrige Claire, eine Lykanerin. Sie will nichts lieber als weg aus der Enge ihrer Familie - ein Wunsch, der sich schneller und tragischer erfüllt, als Claire ahnen konnte. Ihre Eltern werden bei einer ersten staatlichen "Säuberungsaktion" getötet. Claire selbst kann flüchten und versucht zu ihrer Tante Miriam zu gelangen, die sich als eine Art Sarah Connor ("Terminator", nicht falsch gesungene deutsche Hymne) auf dem Land versteckt und für den Überlebenskampf trainiert. Unterwegs wird es zu einer ersten Begegnung mit Patrick kommen - eine der Gelegenheiten übrigens, bei denen Percy den Zufall gar zu sehr strapaziert. Was zum Glück die einzige erzählerische Schwäche des Romans bleibt.
Patrick und Claire scheinen das typische Paar von star-crossed lovers zu bilden, das einen Roman wie diesen trägt. Doch steht die (ohnehin nur sehr vage) Liebesgeschichte zwischen den beiden in keinster Weise im Vordergrund. Tatsächlich werden sie bald schon wieder getrennt und schlagen sehr unterschiedliche Lebenswege ein, während die Welt rings um sie den Bach runter geht - Erstbegegnung und mögliches Wiedersehen am Ende bilden nur einen lockeren Rahmen.
Stufen der Eskalation
Als dritte Hauptperson ist noch Chase Williams zu nennen, der Playboy-Gouverneur von Oregon mit Ambitionen auf ein höheres Amt. Hetze gegen Lykaner scheint ihm das Mittel der Stunde, um seine Ziele zu erreichen. Obwohl Chase überaus berechnend vorgeht und entscheidend zum immer weiter eskalierenden Konflikt zwischen Lykanern und nichtinfizierten Menschen beiträgt, macht Percy ihn übrigens nicht zum Hauptschurken des Romans. Überhaupt ändert sich für Chase alles, als er bei einem Racheanschlag selbst infiziert wird - leider sind die wenigsten Veränderungen in "Roter Mond" solche zum Besseren.
Derweil dreht sich die Spirale von Terroranschlägen und staatlichen Gegenmaßnahmen immer weiter. "Dies sind besondere Zeiten. Amerika wird angegriffen." Das kennt man ja. Bis eines Tages schließlich eine Atombombe hochgeht ...
Der Untergang der USA
"Roter Mond" ist eine Parabel - aber worauf? Vieles klingt hier an: Zunächst natürlich der 11. September mit all seinen Folgeerscheinungen - nicht zuletzt der neuen Maxime, Freiheit für Sicherheit zu opfern. Genauso aber auch ethnische Konflikte und die Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre (die es in der Romanwelt übrigens unabhängig vom Lykanerthema auch gegeben hat). Oder der zwischen Hysterie und Ignoranz pendelnde öffentliche Umgang mit Aids in den 80ern. Die Bush-Kriege in rohstoffreichen "Schurkenstaaten". Die Gegenkultur der 60er und 70er Jahre, die entweder im Rückzug aufs Private oder in Terrorismus à la "Symbionese Liberation Army" mündete. Der Aufbau paramilitärischer Gruppen in der Provinz, die den Staat als ihren Feind ansehen. Und der immer stärker schwindende Wille, mit Anhängern der politischen Gegenseite einen Kompromiss zu finden.
In manchen Rezensionen wurde bemängelt, das Percy gleichsetze, was nicht gleichzusetzen sei. Jaja, der Islam ist keine Krankheit, HIV-Infizierte fressen keine Menschen und Israel wird nicht von Werwölfen bewohnt. Aber solche Direktvergleiche greifen zu kurz und kommen ohnehin nicht von Percy selbst. Der hat sein metaphorisches Szenario bewusst vieldeutig angelegt. Und falls es jemand doch gerne auf einen Nenner gebracht hätte: Da gibt es diese kurze Schlüsselpassage im ersten Teil, in der eine Highschool-Lehrerin anhand von "Othello" beiläufig erwähnt, worum es wirklich geht - um den Umgang mit dem Anderen an sich.
Ist Benjamin Percy nun ein Realist oder ein Pessimist? Hoffnung auf ein Happy End scheint es angesichts der unglaublich düsteren Richtung, die "Roter Mond" einschlägt, allenfalls noch auf der persönlichen Ebene zu geben, nicht jedoch auf der gesamtgesellschaftlichen. Aber zum Glück wissen wir ja, dass Science Fiction stets die Gegenwart widerspiegelt und nicht die Zukunft vorhersagt. Beeindruckender Roman jedenfalls. Und das mit Werwölfen!
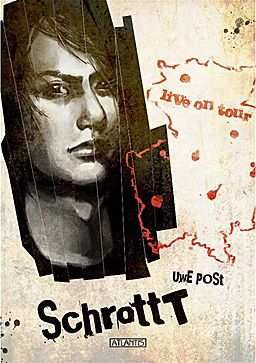
Uwe Post: "SchrottT"
Broschiert, 229 Seiten, € 13,30, Atlantis 2013
In der voraussichtlich letzten Rundschau-Ausgabe vor Bekanntgabe des heurigen Kurd-Laßwitz-Preises nutze ich schnell noch die Möglichkeit, das zweite Buch neben Karsten Kruschels "Vilm. Das Dickicht" vorzustellen, das von mir Punkte in der Kategorie "Bester Roman" bekommt. Sollte Uwe Post gewinnen, wäre es nicht das erste Mal: 2011 hatte er mit "Walpar Tonnraffir und der Zeigefinger Gottes" neben dem KLP auch den Deutschen Science Fiction Preis abgeräumt. Zuvor war er mit dem irrwitzigen "Symbiose" für beide nominiert gewesen.
Neue Mächte braucht das Land
Wer Posts frühere Werke kennt, wird nicht überrascht sein, dass auch "SchrottT" auf eine Satire hinausläuft. Thema ist diesmal einer der prägenden Trends unserer Gegenwart: der Ausverkauf öffentlich-rechtlicher Verantwortung. Der erreicht in Deutschland im Jahr 2022 unter großem medialen Gedöns einen neuen Höhepunkt. Die Bundesländer versteigern die Sicherheitsrechte inklusive Polizeigewalt an den jeweils Höchstbietenden. Zu den Organisationen, die sich das leisten können und sich in der Folge jeweils ein Bundesland krallen, gehören unter anderem die Cosa Nostra, Scientology und der Vatikan. Überwachung ("Kryptografie ist Terrorismus!") und Privatisierung samt dem daraus resultierenden Niedergang der Infrastruktur haben sich endgültig durchgesetzt.
Dass die neuen Exekutivkräfte nicht das alte Grundgesetz vertreten, sondern die gesellschaftlichen Regeln verändern, bekommt die Hauptfigur des Romans, der Teenager Colin Weinland, am eigenen Leib zu spüren - auch buchstäblich, zunächst aber noch indirekt. Da in seinem heimatlichen Baden-Württemberg - jetzt einer Mafia-Domäne - eine strikte "Frauen-an-den-Herd"-Ideologie herrscht, muss seine alleinerziehende Mutter aus rein wirtschaftlichen Erwägungen eine Ehe eingehen.
Colins neuer Stiefvater Länglich ist der Chef einer Sicherheitsfirma und wird gegen Ende noch zum großen Antagonisten des Romans und gleichsam zur Personifizierung des Systems aufgebaut. Diese Zuspitzung im Showdown ist für mich übrigens die einzige Schwäche des Romans, also handle ich sie gleich jetzt ab. Wirkt für mich einfach zu simplifizierend - aber zugegebenermaßen muss es für Post auch schwer gewesen sein, aus seinem gesamtgesellschaftlichen Schreckensszenario irgendwie wieder rauszukommen.
Hey Hey, My My, Rock 'n' Roll Can Never Die
Colin jedenfalls findet einen Ausweg, indem er in eine "Crap Metal"-Band einsteigt, die dank einer spontanen Eingabe Colins einen Internet-Hit landet und sofort auf Tour geschickt wird: Zusammen mit seinen Bandkollegen James Bond und Tier (der Originalsänger wurde zuvor verhaftet und verschwindet auf Nimmerwiedersehen), ihrem Manager, einem undurchsichtigen Musikjournalisten und dem Groupie Blondy, das übrigens mehr Köpfchen hat als alle anderen zusammen.
Mit ihrem Denglish ("Früher we were free") scheinen SchrottT nebenbei bemerkt ein paar Anleihen bei Ja, Panik genommen zu haben. Und auch wenn die SchrottT-Tour letztlich nur dazu dient, uns LeserInnen eine Rundreise durch das bizarre Deutschland der 2020er Jahre zu ermöglichen, ist die Musik nicht ganz bedeutungslos. Ähnlich wie einst in Norman Spinrads "Little Heroes" werden wir in eine Welt des extremen ökonomischen Zynismus geschmissen, in der ein letzter Funke Glaube an die Authentizität des Rock und dessen Potenzial zur Rebellion trotzdem noch nicht erloschen ist. Und wenn's nur der Autor ist, der daran glaubt.
Colin hinter den Spiegeln
Eine Tournee nennt man's, de facto ist es eine Dauerflucht, auf der sich die sechs befinden. Vor dem Zugriff von Schweizergardisten oder eines Porno-Konzerns, vor der chinesischen Arbeitsbürokratie, der "Nigeria-Connection", esoterischen Nazis, peinlichen Provinzbonzen mit real existierenden Machtbefugnissen und der Angst, in den nie fertig werdenden Stuttgarter Hauptbahnhof einbetoniert zu werden. Kurz: Vor allem, was Posts gnadenlos überzeichnetes Szenario so für unsere unfreiwilligen HeldInnen bereithält. Fassen wir diese wilde Achterbahnfahrt am besten in Posts eigenen Worten zusammen:
"Vor ein paar Tagen sind wir um ein Haar vor eine Art Hexengericht geschleift worden, in Chemnitz hatte ich den teuersten Orgasmus meines Lebens - ich glaube, fünf Lebensjahre hat er mich mindestens gekostet -, und das bloß, weil mir irgendjemand vermutlich eine von diesen Euro-XKom-Patronen unter die Vorhaut geschoben hat, ohne dass ich es bemerkt habe. Und jetzt lässt mich mein Stiefvater von Nigerianern in gepanzerten Mercedes-Limousinen zur Hohensyburg geleiten, um mir die dortige Kirche zu zeigen." Colin holte Luft. "Soll ich nicht lieber glauben, dass ich eine Romanfigur bin, die sich ein Wahnsinniger ausgedacht hat, der mal herausfinden wollte, was mit einem harmlosen Musiker passiert, wenn man ihn in eine Art neumittelalterliches Albtraumland versetzt?"
Schön böse
Das ist soweit aber nur die halbe Wahrheit zu "SchrottT". Denn all diese Stationen sind nur Rückblicke, zwischen denen der nicht-chronologisch erzählte Roman zu einer Gegenwartsebene zurückwechselt, auf der Colin unter kafkaesken Umständen gefoltert und verhört wird (von wem, werden wir erst am Schluss als extra-zynische Pointe erfahren). Und hier wird es besonders perfide. Denn trotz aller Brutalität verliert Colin seinen Galgenhumor nicht, zudem verleiht seine von Drogen und Schmerzen verzerrte Wahrnehmung dem blutigen Geschehen eine extra-surreale Note. Das Ergebnis: An der Oberfläche haben wir jede Menge Situationskomik, Gags und Wortspiele, ganz wie man es von Uwe Post kennt. Darunter aber lauert das Grauen. Mit einer Form, die zum Lachen reizt, und einem Inhalt, der für Beklemmungen sorgt, fährt Post eine fiese kommunikative Doppelstrategie.
"SchrottT" ist eine bitterböse Satire, überdrehter als Almodóvar und trotzdem immer wieder ins Schwarze treffend. Colin denkt, was auch der Leser denkt: Das ist alles zu absurd, um wahr zu sein ... bis die nächste Faust in seinem Gesicht landet. Und wenn zwischendurch mal etwas glimpflich zu verlaufen scheint, kann man sich darauf verlassen, dass prompt eine Leiche auftauchen wird. Ich stimme für ein Sequel!

Karen Lord: "Die beste Welt"
Broschiert, 400 Seiten, € 10,30, Heyne 2014 (Original: "The Best of All Possible Worlds", 2013)
Man soll's nicht glauben, aber ein Buch kann auch mit einem planetaren Holocaust beginnen und trotzdem extrem unaufgeregt daherkommen. Und das ist vielleicht das Wichtigste, das man zu Karen Lords "Die beste Welt" vorab wissen sollte: Auf eine bloße Inhaltsangabe reduziert, enthält der Roman all das, was man sich von einem planetaren Abenteuer erwarten kann - da wird im Klappentext nicht geschummelt. Doch liegt Lords Schwerpunkt nicht auf der Action (oder gar irgendeiner ausgefeilten Technologie, ha!), sondern auf der Psychologie und dem Zusammenspiel ihrer Hauptfiguren. Das mag diejenigen SF-Fans enttäuschen, die den Roman vielleicht gerne näher an der Standard-Formel sähen. Für einen Vielleser wie mich ist Lords Ansatz eine angenehme Abwechslung.
Nebuloses Setting
Karen Lords vielgelobter Debütroman "Redemption in Indigo" war irgendwo zwischen Fantasy und Magic Realism angesiedelt. Dass Science Fiction etwas andere Gepflogenheiten hat, wird dann deutlich, wenn Lord auf ebendiese pfeift: Stichwort Setting, da lässt sie so einiges im Nebel. Man kann im Lauf der Seiten herausdestillieren, dass "Menschen" unabhängig voneinander auf verschiedenen Planeten entstanden sind (erinnert mich an eine Folge von "Star Trek: Next Generation"). Dabei dürften die geheimnisvollen Kuratoren - vermutlich ein uraltes Intelligenzvolk - die Finger im Spiel gehabt haben. Die werden immer wieder mal hinter den Kulissen tätig, unter anderem haben sie die Erde unter ein "Embargo" gestellt. Nichtsdestotrotz hat in der Vergangenheit die eine oder andere Menschengruppe die Erde verlassen. Über Portale? Mit Kuratoren-Hilfe? Wie gesagt, da hält sich Lord weitgehend bedeckt.
Die verschiedenen Menschenlinien haben übrigens jeweils verschiedene Grundcharaktere, da ist die Autorin relativ biologistisch unterwegs. Hervorstechendster Charakterzug der Sadiri ist die Disziplin. Und die brauchen sie auch, nachdem ihre Heimatwelt von ihren Nachbarn sterilisiert wurde. Der Großteil der weiblichen Bevölkerung wurde dabei ausgelöscht, also versuchen die übrig gebliebenen Männer einen neuen Genpool aufzubauen. Eines ihrer Ziele ist der Planet Cygnus Beta, eine Art galaktischer Schmelztiegel, auf dem die Nachfahren aller Menschenlinien leben (allerdings fast nur das kulturelle Erbe der Erde zu kennen scheinen - eine der kleineren Unstimmigkeiten des Romans).
Im Nachwort erklärt die Autorin, die aus Barbados stammt, was sie inspiriert hat: Ihre karibische Heimat war das Vorbild für Cygnus Beta, sie nennt sie die neue Wiege der Menschheit. Und der Tsunami von 2004 lieferte die Vorlage für das Dilemma der Sadiri, hatte doch die damalige Flutkatastrophe in einigen Dörfern die Männer, die zum Fischen draußen auf dem Meer waren, verschont, die daheimgebliebenen Frauen aber voll getroffen.
Romance ist nicht gleich Romanze ... aber irgendwie dann doch
Mit ihrer Betonung auf dem Clash der Kulturen ist "Die beste Welt" an der Schnittstelle von Social Science Fiction und Planeten-Abenteuer angelegt; Englisch: Planetary Romance. Lord beackert damit ein Feld, auf dem traditionell Frauen dominieren, denken wir etwa an Ursula K. Le Guin, Joan Slonczewski oder auch Sheri S. Tepper. Mit diesen Riesinnen würde ich Lord nicht auf eine Stufe stellen - zumindest noch nicht mit "Die beste Welt" -, aber Adriana Lorusso ("Das Gesetz von Ta-Shima") wäre vielleicht ein guter Vergleichswert, um mal ein Beispiel aus jüngerer Zeit zu nennen.
Im Englischen hat "Romance" eine allgemeinere - nicht unbedingt amouröse - Bedeutung als im Deutschen, allerdings trifft für diesen Roman auch die engere Definition zu. Denn die unterschiedlichen Lebensweisen von Sadiri und Cygniern werden auf eine Zweierkonstellation heruntergebrochen, nämlich auf die Chemie zwischen dem Sadiri-Gelehrten Dllenahkh und der Erzählerin des Romans: Grace Delarua ist eine Mitarbeiterin im cygnischen Gesundheits- und Landwirtschaftsministerium, wird Dllenahkh als Beraterin zur Seite gestellt und bildet mit ihrer lebhaften, oft plappermäuligen Art einen großen Kontrast zu seinem zurückhaltenden Wesen. Obwohl für mich ehrlich gesagt die größere Diskrepanz in den Sadiri selbst liegt: Extrem diszipliniert einerseits, verzweifelt auf Brautschau andererseits. Speziell Dllenahkhs Assistent verhält sich oft wie jemand, dessen einziger Aufreißerspruch ein Heiratsantrag ist (mit entsprechendem Erfolg).
Langsame Annäherung
Cygnus Beta hat zwar eine irgendwie schwedisch wirkende planetare Verwaltung, bietet aber auch Platz genug für jede Menge kleine Enklaven, in denen sich die ImmigrantInnen der verschiedenen Menschenlinien angesiedelt und voneinander stark abweichende Mini-Kulturen geschaffen haben. Genau dort hoffen die Sadiri genetisch kompatible Frauen zu finden. Und so reist das gemischt cygnisch-sadirische Grüppchen um den Planeten und klappert diverse Enklaven ab.
Ob Krieg zwischen Dschungeldörfern oder eine isolierte Sklavenhalter-Gesellschaft, ob ein Mord an der Provinzoper oder eine Rettungsaktion bei einer Naturkatastrophe - und nicht zuletzt ein unangenehmes familiäres Zwischenspiel, in dem es Grace mit ihrem manipulativen Schwager zu tun bekommt (Technik spielt in "Die beste Welt" keine Rolle, dafür geht es oft und viel um Psi-Kräfte): All das sind weitgehend voneinander getrennte Episoden im Rahmen der eigentlichen Haupthandlung. Und die dreht sich anders als zuvor bei "Roter Mond" eindeutig um die aufkeimende Liebesbeziehung zwischen Grace und Dllenahkh, um das Überwinden von Gegensätzen, was Wesensart und Wertvorstellungen betrifft. Und wie man es von der Liebe zwischen Beamten erwarten kann, geht dies langsam und mit barocken Schleifen voran: "So tanzen sie, herrlich langsam, eine elegante Sarabande." Trotzdem muss ich sagen, dass ich mich beim Lesen wirklich nie gelangweilt habe.
Wie immer, wenn ein Roman bei mir einen unklaren Eindruck hinterlässt, lese ich umso interessierter, welche Bilanz andere RezensentInnen ziehen. Von literaturwissenschaftlichen Vergleichen (etwa mit Voltaires "Candide") bis zu einer unglaublich langen Analyse aus feministischer Sicht war da so einiges dabei. Am besten hat es für mich aber ein stinknormaler Leserkommentar auf der Seite eines Internethändlers auf den Punkt gebracht: I found this to be a fairly uninteresting, yet oddly readable book. Das "uninteressant" würde ich zwar auf "unspektakulär" abschwächen, aber oddly readable war "Die beste Welt" allemal.
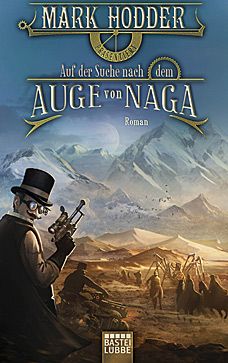
Mark Hodder: "Auf der Suche nach dem Auge von Naga"
Broschiert, 589 Seiten, € 15,50, Bastei Lübbe 2014 (Original: "Expedition to the Mountains of the Moon", 2012)
Taschentücher bereithalten, Teil 3 der "Burton & Swinburne"-Saga bringt das große Figurensterben! Es ist der Abschluss des ersten Dreier-Zyklus der Reihe, und Mark Hodder schafft es nicht nur, hier vieles unter einen Hut zu kriegen, das in Band 1 ("Der kuriose Fall des Spring Heeled Jack") und 2 ("Der wundersame Fall des Uhrwerkmannes") angerissen wurde. Er biegt es auch so hin, dass sich alles seit Band 1 Geschehene nun als Teil eines großen geheimen Weltverschwörungsplans entpuppt.
Wer die ersten beiden Bände der Steampunk-plus-Zeitreise-Serie nicht gelesen hat und sich hier als Quereinsteiger versuchen will: Har har har. Viel Glück! "Auf der Suche nach dem Auge von Naga" legt gleich mal einen Kaltstart hin und beschert uns einen Richard Francis Burton, der 1840 mit einem Gewehr aus dem Jahr 1918 auf der Lauer liegt, um den Attentäter von Queen Victoria zu erledigen. Kurz danach erklärt er im Jahr 1863 einem Partygast (bzw. ruft es uns im Schnelldurchlauf in Erinnerung), auf welch vielfältige Weise der Geschichtsverlauf seit Band 1 verändert worden ist. Das ist schwindelerregend genug, dass es wie eine Erleichterung daherkommt, wenn ein Mordanschlag auf Burton verübt wird ...
Auf nach Afrika
Weitere Attentate und Sabotageakte werden folgen, aber nichts davon kann den großen Abenteurer Burton davon abhalten, als Expeditionsleiter in sein geliebtes Afrika zurückzukehren. Offiziell, um die Quelle des Nils zu finden - in Wirklichkeit aber, um das letzte Auge der Naga zu bergen. Der, nicht von, wie es der schlampige deutsche Buchtitel suggeriert. Denn die Naga sind weder ein Ort noch eine Einzelperson, sondern waren ein prähistorisches nichtmenschliches Intelligenzvolk mit psychischen Superkräften. Und ihre Hinterlassenschaften bergen ganz erhebliche Macht in sich.
Also startet Burton mit seinem Kompagnon Algernon Swinburne und einem Best-of-Nebenfiguren der vorherigen Bände an Bord eines fliegenden "Rotorschiffs" ins Herz der Finsternis. Und hat sich dort erwartungsgemäß mit wilden Tieren, aufgebrachten Eingeborenen, unwegsamem Gelände, jeder Menge Krankheiten und bewaffneten Auseinandersetzungen mit den preußischen Bütteln einer konkurrierenden Expedition herumzuschlagen.
Schieß es durch die Blume
Auf einer zweiten Handlungsebene finden wir uns zusammen mit einem offenbar nicht gealterten Burton ein halbes Jahrhundert später im Jahr 1918 wieder. Da sollte er eigentlich schon längst tot sein - stattdessen zeigt er einem Kriegsberichterstatter namens H .G. Wells, was ein Zeitreisender wirklich ist: hoffnungslos verwirrt. Die 1918er Ebene präsentiert sich indes als einziger Albtraum. Das britische Empire ist im Weltkrieg fast zur Gänze vernichtet worden. Nur in Afrika hält es noch ein paar Gebiete und liefert sich mit dem deutschen Großreich einen erbitterten Stellungskrieg.
Natürlich sieht der nicht so aus wie auf der uns bekannten Zeitlinie: So krachen statt Panzern die ausgeschabten und mit Waffentechnik vollgestopften Exoskelette riesiger Weberknechte durchs Gelände, explodieren statt Granaten kopfgroße Knallerbsen und wabern keine Giftgas-, sondern Sporenschwaden über den Schützengräben. Denn während sich das Empire nach wie vor in dampfbetriebener Tierkörperverwertung ergeht, setzt Preußen auf Flowerpower: "Die verfluchten Schöpfungen der Eugeniker! Sie alle sind blutsaugende, mit Säure spuckende, Stacheln verschießende, Giftdämpfe absondernde Abscheulichkeiten!"
Wildwuchs! Wildwuchs!
Die beiden Handlungsstränge auf verschiedenen Zeitebenen laufen parallel und zeigen dabei nicht nur denselben geografischen Vektor. Sie überlappen sich auch, zumindest in Burtons Verstand: Immer wieder tauchen nebulose Fetzen aus der jeweils anderen Zeit im Kopf des Abenteurers auf. Kein Grund für Mitleid allerdings - warum sollen nur wir LeserInnen verwirrt sein.
Wie es Plots um Zeitreisen und Zeitparadoxa so an sich haben, ist die "Burton & Swinburne"-Reihe über die Bände hinweg nicht gerade übersichtlicher geworden. Genauer gesagt hat sich hier ein gewaltiger Wildwuchs ausgebreitet, der sich neben den preußischen Killerpflanzen nicht verstecken braucht. Und der im Roman auch - fast wie ein Hilfeschrei des Autors - thematisiert wird: Zurück! ... Der Ursprung ... Muss zurückgeschnitten werden, bis knapp an die Zweige ... Wie kann ich den Schaden umkehren? ...
Alles auf neu bitte!
"Auf der Suche nach dem Auge von Naga" wird damit nicht zuletzt auch zu einem Lehrstück in Sachen Genremechanismen. Typisch Zeitreisegeschichte, dass alles immer komplizierter wird. Typisch Sequel, dass mittels retroaktiver Kontinuität - also der nachträglichen Modifizierung von Fakten - das bisherige Geschehen in ein größeres Ganzes eingebaut werden soll. Und genauso typisch - wenn auch hauptsächlich aus dem Comics-Bereich bekannt - die Lösung, mit der man sich aus dem kaum noch überschaubaren Geflecht zu lösen hofft: Harter Schnitt und Reboot!
Einen solchen hat die "Burton & Swinburne"-Reihe, die im Original bald ihren fünften Teil erleben wird, nach diesem Band hier vollzogen. Der übrigens nicht nur der bislang düsterste, sondern meiner Meinung nach auch der schwächste Band der Reihe ist: Nicht nur wegen des Zeitlinien-Knäuels, sondern auch, weil ein wenig gar ausführlich in Afrika herumgekroicht wird. Etwas Straffung hätte da nicht geschadet. Aber das ist Jammern auf hohem Unterhaltungsniveau, denn ansonsten glänzt der Roman wie schon seine Vorgänger mit Action, geschliffenen Dialogen und historischer Recherche, die Mark Hodder immer wieder originelle Querverbindungen zwischen unserem Geschichtsverlauf und dem seiner Romanwelt herstellen lässt.
Teil 4 der Reihe ("The Secret of Abdu El Yezdi") ist vergangenes Jahr erschienen, Teil 5 ("The Return of the Discontinued Man") soll diesen Sommer folgen. Da in der Lübbe-Programmvorschau vorerst noch keine Übersetzungen dieser Romane aufscheinen, können sich die ganz Neugierigen ja im Original schlau machen, wie sich der Reboot der Serie ausgewirkt hat. Und wer weiß, das eine oder andere Trauertaschentuch wurde ja vielleicht doch zu früh vollgerotzt ...
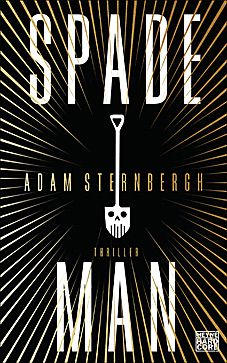
Adam Sternbergh: "Spademan"
Klappenbroschur, 304 Seiten, € 15,50, Heyne 2014 (Original: "Shovel Ready", 2014)
So schnell kann's gehen: Erst heuer im Original erschienen, schon übersetzt - und eine Verfilmung mit Denzel Washington in der Hauptrolle steht auch bereits an. Falls bei diesem Tempo jemand zur Vermutung kommt, dass "Spademan" nicht ganz so komplex wie Neal Stephensons Barock-Zyklus sein dürfte, dann hat er damit durchaus recht.
Fauliger Big Apple
In seinem ersten Roman zeichnet US-Autor Adam Sternbergh ein New York, das den bisherigen Tiefpunkt seiner Geschichte in den 70er Jahren noch einmal unterbietet. Nachdem auf dem Times Square eine schmutzige Bombe explodiert ist und einige kleinere Attentate gefolgt sind, hat man die Innenstadt de facto aufgegeben. Während sich die weniger Betuchten inmitten von Verfall und Gesetzlosigkeit durchgfretten, sind die Reichen geflüchtet. Entweder in die Vorstädte oder - hier der große Unterschied zu den Seventies - in virtuelle Realitäten.
Warum sich die High Society entschieden hat, wie eingestöpselte Maden in ihren Wohntürmen mitten im Notstandsgebiet herumzuliegen und sich darauf zu verlassen, dass regelmäßig eine Krankenschwester vorbeischaut, hat sich mir den ganzen Roman über nicht wirklich erschlossen - Reiche sind in der Regel nicht dafür bekannt, dass sie sich freiwillig in ihren Handlungsmöglichkeiten einschränken lassen. Andererseits bringt das dem Roman eine Prise Cyberpunk, und hey: Spätestens in der Verfilmung spielen Logiklöcher eh keinerlei Rolle mehr. Ich sag nur "Surrogates".
Halb so zynisch
Hauptfigur und Ich-Erzähler des Romans ist der "Spademan" des Titels, ein ehemaliger Müllmann, der seine Frau beim Anschlag auf den Times Square verloren hat. In die Killer-Branche ist er eher zufällig gerutscht, hat dort aber inzwischen einen Ruf wie Donnerhall. Sein jüngster Auftrag kommt vom Fernsehprediger T. K. Harrow und gilt dessen 18-jähriger Tochter Grace Chastity (Eigenbezeichnung: "Persephone"). Es wird niemanden groß überraschen, dass dieses Szenario auf den bekannten Plot "männlicher Killer verschont weibliches Zielobjekt" hinausläuft. Aber damit ist ja auch erst der Anfang gemacht. Für Spannung sorgen in der Folge die Fragen: Wurde Persephone wirklich von ihrem Vater geschwängert? Und was hat es mit dem virtuellen Himmel auf sich, den der Prediger unter dem Schlagwort Gepflastert mit Gold propagiert?
Präsens, Ich-Form, kurze Sätze: "Spademan" der Roman und Spademan der Mann geben sich lakonisch. Beziehungsweise hardboiled. Aber ähnlich wie bei Warren Ellis ist es typischer Zeitgeist-Hardcore, was der Autor - im Hauptberuf ein Kulturjournalist - hier abliefert. "Ich töte Männer. Und ich töte Frauen, denn ich will nicht diskriminierend erscheinen", prangt als Zitat auf der Buchrückseite. Minderjährige hingegen werden verschont, da ist der Killer, der stets betont, sich nicht für die Motive seiner KundInnen zu interessieren, penibler als jeder Disco-Türsteher. Er weist sogar mehrmals darauf hin, dass man neben Schwangeren nicht raucht und formuliert schon mal unerwartet verschämt: Die junge Grace Chastity probiert Sexspielzeuge aus. Lässt sie an bestimmten Orten verschwinden. Huch, was mögen das wohl für Orte sein ...
Aufs Publikum geschielt
Streckenweise habe ich mir beim Lesen gedacht: Woher kenne ich nur diese Art zu sprechen? Und dann ist's mir eingefallen: von Dieter Nuhr. Immer wenn der Spademan über die eigentliche Handlung hinausschaut und Kommentare zum Hintergrund abgibt, schlägt er diesen geistreich sein wollenden Auskenner-Tonfall an, wie er für Stand-up-Comedians typisch ist. Sie wirken weniger wie Flüchtlingslager, eher wie eine Art großes Pfadfindertreffen. Tamburine, Jonglierbälle, Footbags. Diesen Dingern kann selbst ein nuklearer Winter nichts anhaben: Ein kleiner, sandgefüllter Ball, mit dem vor einem verbrannten Horizont gespielt wird - dann wissen wir, dass die Zivilisation und die Hippiemusik überlebt haben.
Vor allem im ersten Teil des Romans bricht in Adam Sternbergh immer wieder der Feuilletonist durch, danach klingt das zum Glück ab: Sei es, dass ihm die Bonmots ausgegangen sind oder dass er sich dann stärker aufs Geschehen konzentriert. Klarerer Fokus, ernsterer Ton und ein paar bittere Background-Stories von Nebenfiguren: Das ist es, was "Spademan" letztlich rettet. Von wirklich "hard" ist der bei "Heyne Hardcore" erschienene Roman trotzdem Lichtjahre entfernt.
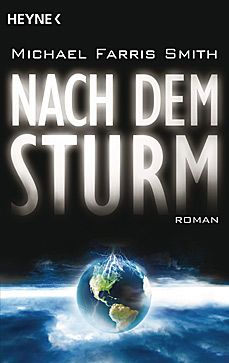
Michael Farris Smith: "Nach dem Sturm"
Broschiert, 448 Seiten, € 10,30, Heyne 2014 (Original: "Rivers", 2013)
Alles war kalt und feucht. Oder kalt und nass. Oder kalt und vollgesogen. Oder kalt und unter Wasser. Keine Frage, Michael Farris Smiths "Nach dem Sturm" ist der nasseste Roman seit Brian Keenes "Die Wurmgötter". Überschwemmungen, Dauerregen, Sturm und Gewitter bilden den trüben Hintergrund des Geschehens, das sich im Mississippi einer klimagewandelten nahen Zukunft abspielt. Die nicht enden wollende Abfolge von Hurrikans hat die US-Regierung schließlich dazu gebracht, die Golfküste aufzugeben. Neunzig Meilen im Norden wurde die Linie gezogen, das Gebiet darunter evakuiert. Wer nicht gehen wollte, lebt nun in einer Zone ohne Infrastruktur und ohne all die Rechtsansprüche, die einem US-Bürger normalerweise zustehen.
Einer, der geblieben ist, heißt Cohen und ist die Hauptfigur des Romans. Frau und Kind hat er verloren, und dennoch wollte er sein Haus mit dem niemals fertiggestellten Zubau - tragisches Symbol von Cohens geplatzten Zukunftsträumen - nicht aufgeben. Auch wenn die Fahrten zur Beschaffung neuer Ausrüstung und Lebensmittel immer beschwerlicher werden. Und gefährlicher: Cohen wird von zwei Jugendlichen überfallen, überlebt mit knapper Not und muss bei seiner Rückkehr nach Hause feststellen, dass sie inzwischen auch sein Eigenheim ausgeplündert haben. Weil sie dabei auch die Schachtel mit den Erinnerungsstücken an seine Frau mitgenommen haben, setzt sich Cohen auf ihre Spur.
Übersichtlicher Aufbau
"Nach dem Sturm" gliedert sich in vier Teile. Im ersten ist Cohen noch ganz auf sich gestellt und mit sich selbst beschäftigt. Im zweiten wird er mit einem typisch postapokalyptischen Gegenspieler konfrontiert: Aggie, der es vom Herumtreiber zum Schlangenprediger und nach der Katastrophe zum selbsternannten "Noah" gebracht hat. Was de facto so aussieht, dass er in seinem Trailer-Park Frauen, deren Männer er getötet hat, gefangenhält, vergewaltigt und schwängert. Und zwischendurch mal seine Untergebenen auf Raubzug losschickt - wie die beiden Jugendlichen Mariposa und Evan, an die Cohen geraten ist.
Im dritten Teil erleben wir den ehemaligen Einzelgänger Cohen als Teil einer Gruppe von Überlebenden, die sich Richtung Norden durchschlägt, im vierten dürfen wir dann endlich einen Blick hinter die Linie werfen. Für mich eher überraschend kam, dass dann auch ein Plot-Element nochmals aufgegriffen wird, das für mich zunächst eher nebensächlich gewirkt hatte: Nämlich Millionen Dollar an Casino-Geldern, die vor der Evakuierung irgendwo vergraben worden sein sollen und auch zwei Jahre später immer noch Glücksritter in den Süden locken.
Verlorene Vergangenheit
Der eigentliche Handlungsmotor ist aber trotzdem etwas ganz anderes - nämlich Erinnerungen. Es ist kein Zufall, dass just eine verlorene Souvenir-Schachtel Cohen aus seiner selbstgewählten Isolation reißt und damit alle weiteren Geschehnisse in Gang setzt. Erinnerungen an die Welt davor ziehen sich durch den ganzen Roman. Es gibt ausgedehnte Flashback-Kapitel über eine Reise Cohens und seiner Frau nach Venedig (vielleicht ein wenig gar symbolisch angesichts des ganzen Wassers ...), immer wieder aber auch kurze Passagen, in denen die Romanfiguren die menschenleere Gegenwart betrachten und sie mit der lebendigen Szenerie von früher vergleichen. Als säßen sie vor einer leeren Bühne und füllten sie im Geist mit Darstellern.
"Nach dem Sturm" enthält eine Reihe berührender Bilder, die die melancholische Stimmung des Romans besonders gut auf den Punkt bringen. Etwa wenn Cohen an den Schutthaufen der Häuser vorbeifährt, die sein Vater und er einst gebaut haben. Wenn er vom Pferd aus auf den Golf schießt - hilfloser Zorn gegen das Meer, das ihm alles genommen hat. Oder wenn er den Hund begräbt, der ihn auf seine Wiederbeschaffungsmission begleitet hat ("Tut mir leid, dass ich dich da mit reingezogen habe."). In solchen Momenten kann der bisherige Kurzgeschichtenautor Michael Farris Smith seine Stärken auch in seinem Romandebüt ausspielen.
Und nie mehr wieder geht die Sonne auf
Was die große Rahmenhandlung anbelangt - nun, das kennt man eigentlich alles schon. Selbst diejenigen LeserInnen, die postapokalyptische Szenarien nur von "The Walking Dead" kennen, werden hier nichts wirklich grundlegend Neues finden. Es ist das bewährte Muster von Menschen wie du und ich, die von den Umständen in ungeahnte Rollen gedrängt wurden. Von Überlebenskampf und (leider berechtigtem) Misstrauen gegenüber allen Fremden. Und vom Konflikt derer, die sich ihre Menschlichkeit bewahren wollen, mit denen, die den Untergang der alten Welt zu ihrem persönlichen Vorteil genutzt haben.
Für "Nach dem Sturm" gilt also letztlich das gleiche wie für einen Schweden-Krimi oder eine High-Fantasy-Queste: Die Formel steht fest, jetzt geht es nur noch darum, wie sie ausgefüllt wird. Smith tut es, indem er primär auf Atmosphäre und das Innenleben seiner Hauptfigur setzt - auch das ist freilich keine Entscheidung, die vor ihm noch niemand anderer getroffen hat. Solide, wenn auch nicht spektakulär.

Dirk C. Fleck: "GO! Die Ökodiktatur"
Broschiert, 211 Seiten, € 21,90, p.machinery 2013
Und einmal noch Ökologie, sogar mit einem deutschsprachigen Klassiker des Genres. Mit "GO! Die Ökodiktatur" gewann der deutsche Umweltjournalist und schreibende Aktivist Dirk C. Fleck 1994 den Deutschen Science Fiction Preis. Zum 20-jährigen Jubiläum der Erstveröffentlichung hat der Roman beim Verlag p.machinery zu seiner meines Wissens dritten Ausgabe gefunden. Diesmal im extravaganten Hochformat - fast so hoch wie Flecks dauererhobener Zeigefinger. Man sollte "GO!" unbedingt gelesen haben; auch wenn es einem auf mehr als eine Art Bauchweh bereiten wird.
Rein in die 2040er Jahre, in denen die Erde einen Grad an Verseuchung, Verstrahlung und Verwüstung erreicht hat, der ca. auf halbem Weg zwischen "The Sheep Look Up" und "Soylent Green" liegt. Doch die Zivilisation hat reagiert - mit der Etablierung einer totalitären Diktatur, die alles dem Slogan "Erst die Erde, dann der Mensch" unterordnet. Reisen, Grundbesitz und Fleischkonsum sind verboten, auf Wilderei oder Fischfang steht die Todesstrafe, für jeden gilt der Zwang zur Mitarbeit im großen Renaturierungsprojekt, mit dem man die Erde wieder bewohnbar zu machen hofft.
Außen pfui, innen ebenso
Eine besondere Ironie ist, dass just die Staaten, die die Erde einst versaut haben, nun erneut am Drücker sind. In den Industriestaaten der gemäßigten Klimazone hat vor zwei Jahrzehnten ein Putsch ökologisch gesinnter WissenschafterInnen stattgefunden: Der Beginn von GO!, was offiziell für "Global Observer" steht, nicht umsonst aber wie der Startbefehl für einen Kampfeinsatz klingt. Aus anderen Weltregionen halten sich die GO!-Staaten offiziell raus, tatsächlich aber greifen sie ganz gewaltig ein und sterilisieren die Bevölkerungen ganzer Kontinente. Zudem haben sie sich gegenüber klimatisch benachteiligten Regionen abgeschottet: Die Festung Europa rettet keine Bootsflüchtlinge mehr, sie mäht sie mit dem Maschinengewehr nieder.
... nicht dass es den heimischen Bevölkerungen soviel besser ginge, wie der Roman anhand des Beispiels Deutschland schildert. Zu obigen Regeln kommen nämlich noch vielfältige Maßnahmen der Gehirnwäsche dazu: Geschichtsfälschung und das Verbot von Medien, Schauprozesse und Erziehungsrazzien, bei denen BürgerInnen wahllos eingesammelt werden, um ihnen drastisch vor Augen zu führen, wie Schlachthöfe und andere Perversionen der Vergangenheit funktioniert haben. Eine der Figuren aus Flecks großem Ensemble, der junge Percy, hat eine verbotene Spritztour mit einem Auto unternommen - zur Strafe lässt man ihn in einem Simulator erst Abgase einatmen und dann einen Unfall bauen. Einem anderen Protagonisten, dem "Grünhelm"-Soldaten Paul Boon, wird ein Chip eingepflanzt, der seine Aggressionshemmung außer Kraft setzt. Und dann gibt es da noch die für jedermann verpflichtenden Holo-Lessons mit Xenia, einer virtuellen Öko-Domina, die die Bevölkerung mit ihren virtuellen Predigten auf Linie bringt (und dabei Phrasen drischt bis zum Erbrechen).
Andere Figuren führen uns in die neuen Organisationsformen ein, die sich in den GO!-Staaten etabliert haben. Stadtlager sind die aufgegebenen Großstädte von einst: Jetzt abgeschottete, rechtsfreie Räume, in die nicht nur Systemgegner, sondern auch Strahlenkranke und HIV-Infizierte abgeschoben werden - dafür landen die nicht mehr arbeitstauglichen Angehörigen unserer Generation in Altensiedlungen. Als besondere Blüte seien noch die Meditationskommunen genannt, in denen die Zukunft - das harmonische Miteinander von Mensch und Natur - geboren werden soll. Tatsächlich ergeht man sich dort in haarsträubendem Eso-Quatsch (Kristalle gegen Radioaktivität? Yeah, schickt eine Ladung Turmaline nach Fukushima, schon wird es wieder bewohnbar!). Extra beklemmend, wenn eine Hopi-Frau in einer deutschen Kommune die Weisheit der UreinwohnerInnen verkündet und dabei den Tonfall eines faschistoiden Motivationsgurus anschlägt.
Der Kontext
Fleck sendete nach dem Erscheinen seines Romans recht ambivalente Botschaften aus, wie er zu seinem Szenario steht. Im Anhang ist ein Vortragstext enthalten, in dem er zur Ökodiktatur "Man möchte sie sich fast wünschen" sagt. Betonung auf fast. Die GO!-Gesellschaft ist im Roman klar als Dystopie gezeichnet, das darf man nicht übersehen. (Die Position zur Esoterik ist etwas weniger eindeutig - ein Regentanz funktioniert hier zum Beispiel -, das desavouiert sich allerdings eh von selbst.) Andererseits nennt Fleck den Entwurf auch idealistisch nach vorne gedacht ... das ist schon schwerer zu schlucken.
Flecks Wut über unsere Untätigkeit angesichts der globalen Umweltzerstörung ist mehr als verständlich. Siehe etwa den Stillstand im Klimaschutz, wodurch wir heute in einer schlechteren Position sind als beim Erscheinen dieses Buchs vor 20 Jahren. Eine "Ökodiktatur" sieht Fleck vielleicht nicht als wünschenswert, aber sehr wohl als Menetekel an der Wand: Wenn es mit unserem Weiterwurschteln vorbei ist und wirklich ans Eingemachte geht, dann könnten neue Regeln aufgestellt werden. Und die werden nicht human sein, so Fleck.
Sprachlicher Overkill
Über Flecks ökologische Thesen kann man trefflich streiten - allerdings sollte man nicht vergessen, dass er hier einen Roman vorgelegt hat, der auch und vor allem als literarisches Werk zu betrachten ist. Sowohl "GO!" als auch das 2008 erschienene "Tahiti-Projekt" haben den Deutschen Science Fiction Preis gewonnen. Den Preis für die unnatürlichsten Dialoge könnte es aber obendrauf geben, denn nicht immer, doch leider sehr oft sprechen die Romanfiguren nicht, sondern geben - in deklamierendem Tonfall - Informationsmengen wieder. Das wird besonders deutlich im Anhang, wo sich Flecks Vortragstext als über viele Passagen wortgleiches Destillat dessen präsentiert, was zuvor, ökonomisch verteilt, diversen "Figuren" in den Mund gelegt wurde.
"GO!" ist stilistisch deutlich näher an einem Roman dran als das verkappte Sachbuch "Das Tahiti-Projekt" und enthält auch einige wirklich berührende Passagen: Etwa wenn Jugendliche eine Altensiedlung attackieren und deren BewohnerInnen - als "Autofahrer" beschimpft - demütigen. Oder wenn die zur Systemkritikerin gewordene Iris Blume am Schluss den Konsequenzen ihrer Tat entgegensieht. Trotzdem ächzt auch "GO!" unter einer erdrückenden Last an journalistischem Schlagwortvokabular ("Die Mediengesellschaft ist in das schwarze Loch der Erkenntnis gefallen"). Und wenn es kein Pamphlet, sondern wirklich ein Roman sein will, dann beißt sich das. In seinem Vortrag meinte Fleck zu besagter Medien- und Informationsgesellschaft: Dieses Trommelfeuer macht unsere Köpfe und Herzen taub. Die Informationsflut führt also nicht zu mehr Aufklärung, sondern zu mehr Zynismus und Gleichgültigkeit. Leider gilt das auch für seinen Roman.

Brian K. Vaughan & Fiona Staples: "Saga", Teil 3
Graphic Novel, broschiert, 144 Seiten, Image Comics 2014
Yeah, Teil 3 meiner liebsten SF-Liebesgeschichte der letzten Jahre ist heraußen! Und macht gleich mit dem ironischen Backcover klar, dass sich das dynamische Duo Brian K. Vaughan & Fiona Staples der Mechanismen des Romance-Genres genauso bewusst ist wie derer von SF und Fantasy. In Anlehnung an das Titelbildmotiv von Schnulzen schlechthin zeigt es unser Liebespaar Marko und Alana in klassischer Halb-Umarmung-Halb-Pietà-Haltung: Ihr Kleid so weit hochgerutscht, dass der Schenkel freiliegt; sein Hemd weit genug offen, um einen Nippel zu zeigen. Fehlt nur noch der Sturm der Leidenschaft, der das Haar bauscht, aber vielleicht ist es auf dem Planeten ja eher windstill.
Quietus heißt bezeichnenderweise der Planet, auf den sich Weltraum-Romeo-und-Julia vor den Nachstellungen ihrer miteinander verfeindeten Heimatwelten geflüchtet haben (siehe Band 1 und 2). Angelockt wurden sie - das muss man in dem Kontext nochmal extra betonen -, weil hier der Autor D. Oswald Heist residiert, dessen pazifistische Liebesschnulzen Alana und Marko zum Desertieren gebracht haben. Inzwischen schreibt Heist übrigens bereits an seinem nächsten Werk, das sich um "das Gegenteil von Krieg" drehen soll. Womit übrigens nicht Frieden gemeint ist. Und auch nicht Liebe - so schmalzig ist "Saga" denn auch wieder nicht.
Drei Handlungsebenen
Es ist eine Atempause für Marko und Alana - die in diesem Band nicht mehr ganz so im Vordergrund stehen wie in den vorangegangenen - , für ihr gemeinsames Baby Hazel und die unterwegs aufgegabelte, herrlich harsche Schwiegermutter Klara. Es kehrt so etwas wie Häuslichkeit ein, dementsprechend sorgt weniger die Action als die Chemie zwischen den Figuren für Unterhaltung.
... zumindest auf dieser Handlungsebene. Auf einer zweiten treffen wir wieder den Kopfgeldjäger The Will und Markos nachtragende Ex Gwendolyn, die dem Paar aus höchst unterschiedlichen Motiven nachjagen. Dazu kommen auf einer dritten Ebene mit dem schwulen Reporterpaar Upsher und Doff zwei neue Hauptfiguren dazu. Sie recherchieren aus der Ferne die Skandalgeschichte von Marko und Alana und geraten dadurch selbst in Gefahr. Immerhin sind gleich zwei Imperien sehr darauf bedacht, jede Idee zu unterdrücken, dass BürgerInnen von Wreath und Landfall harmonisch miteinander auskommen könnten.
Der Auftritt von Upsher und Doff unterstreicht die Tendenz zur Paarbildung im dritten "Saga"-Band, siehe auch die holprige Annäherung von The Will und Gwendolyn oder die Funken, die zwischen den beiden Senioren Heist und Klara sprühen. Für jeden Topf gibt es einen Deckel - auch wenn gegebenenfalls erst Ohren abgerissen oder Zähne eingeschlagen werden müssen, damit sie aufeinanderpassen ...
Lurve, oh lurve
Wem das alles jetzt vielleicht nach zuviel luuuurve klingt: Keine Angst, es kommen auch fliegende Haie, bissige Skelette, Alien-Parasiten, Explosionen und überraschende Mordversuche vor. So einige Leben hängen am seidenen Faden, und in einem Fall wird der Faden leider reißen.
Einmal mehr hat Illustratorin Fiona Staples Bilder beigesteuert, die einfach Gold sind. Etwa das Hochzeitsfoto von Alanas Vater und dessen zweiter Frau mit einer schäumenden Tochter im Hintergrund. Oder die erste Begegnung mit dem zyklopischen Heist, der sich - in Unterhosen und mit Schnapsflasche in der Hand - nicht ganz seinen romantischen Büchern entsprechend präsentiert ("You stupid cunts here to take back my advance?"). "Saga" hatte in der Vergangenheit ein paar kleinere Probleme mit expliziten Darstellungen. Umso witziger daher die Bildsequenz, in der Alana vor Marko auf die Knie geht. "Is Alana ...praying?", rätselt ihre Schwiegermutter aus der Ferne. Ein Schnitt und ein Panoramablick auf den phallischen Leuchtturm, in dem sich die Beobachterin aufhält, reichen als Antwort. "No, she most certainly is not."
Zum Veröffentlichungsmodus
"Saga 3" umfasst wie schon seine beiden Vorgänger sechs Episoden, die ursprünglich in Heftform veröffentlicht wurden. Und wie schon Band 1 und 2 bringt es einen Handlungsbogen zum Abschluss. Wie es danach weitergeht, ist bis auf ein paar ominöse Andeutungen von Autor Brian K. Vaughan noch offen: Die Heftserie hat nach Abschluss des dritten Zyklus ihrerseits eine kurze Verschnaufpause eingelegt und läuft erst Ende Mai mit Heft 19 weiter.
Mehr "Saga" als diesen vorerst nur auf Englisch erhältlichen Band gibt's im Moment also nicht! Ich hab daher echt versucht, ihn mir zu portionieren, bin aber leider gescheitert. War dann doch wieder in einem Rutsch durch - jetzt muss ich zwar wieder über ein halbes Jahr auf Fortsetzung warten, aber wenigstens weiß ich endlich, was das Gegenteil von Krieg ist.
Bis zum nächsten Mal!
Zu meinem großen Gram konnte ich diesmal aus Zeitmangel Lauren Beukes' "Shining Girls" nicht mehr unterbringen - das kann der Lesezirkel ja inzwischen bis zur nächsten Ausgabe vorbereiten. Außerdem werden ein paar genrehistorische Werke mit dabei sein und eine vielversprechende neue Space Opera mit englischem Libretto. (Josefson, derStandard.at, 26. 4. 2014)