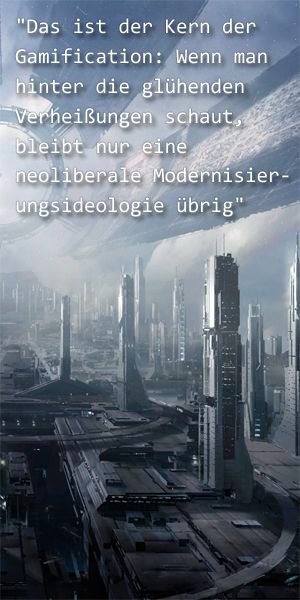"Gamification" bezeichnet den Prozess, Dinge, die keine Spiele sind, durch die Anwendung von Gamedesign-Konzepten zu welchen zu machen. In der Darstellung vieler AutorInnen wird Gamification als innovative Idee präsentiert, mit der wir die Probleme unserer Zeit lösen können.
Die Gamedesignerin Jane McGonigal ist mit ihrem Buch "Reality is Broken" die euphorischste Fürsprecherin dieser Art von Weltverbesserung. Ihr Werk trägt den Untertitel "Why Games Make Us Better and How They Can Change the World". Die deutsche Ausgabe übersetzt diesen Titel ungenau mit "Besser als die Wirklichkeit! Warum wir von Computerspielen profitieren und wie sie die Welt verändern", so dass unter anderem der Anspruch, dass Spiele uns besser machen sollen, relativiert wird.
"nicht herausfordernd genug"
Mit persönlichen Anekdoten erklärt McGonigal, was sie an der Welt für falsch hält und liefert die spielerischen Bugfixes dazu. Am Ende kommt sie auf 14 Punkte: Die Realität sei nicht herausfordernd genug, aber gleichzeitig zu schwierig und hoffnungslos. Sie mache keinen Spaß und sei weder abenteuerlich noch motivierend. Es fehle an befriedigender Arbeit, Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung. Die Leute seien zu einsam, ihre sozialen Bindungen seien zu schwach und überhaupt mangele es an Zusammenhalt. Außerdem gebe es keine guten Belohnungen und keine "Epic Wins". Gute Spiele hätten diese Mängel nicht, also müssten deren Konzepte einfach für die Realität nutzbar gemacht werden. Und endlich wird alles gut.
Abgesehen davon, dass diese Annahmen für sich schon diskutabel sind, verwundert es, dass McGonigal, obwohl sie die gamifizierte Gesellschaft als Komplettlösung für unsere verkorkste Realität präsentiert, keinen Begriff von dieser Gesellschaft hat. So kann sie nur oberflächliche Phänomene kritisieren, etwa dass Arbeit keinen Spaß macht. Die AGB unserer Gesellschaft – den Kapitalismus – hat sie nicht im Blick. In "Reality is Broken" wird er nur einmal in einem Zitat genannt. Joe Edelman beschreibt dort sein Projekt "Groundcrew" als Dritten Weg neben Kapitalismus und Sozialismus. In dem Spiel sollen die per Handy vernetzten SpielerInnen mit der virtuellen Währung "PosX", die "positive Erfahrungen" quantifiziert, motiviert werden, einander kleine Wünsche zu erfüllen. Wenn ich gerade gelangweilt am Bahnhof sitze und gerne ein nettes Gespräch führen würde, tippe ich einfach diesen Wunsch in mein Handy. Andere SpielerInnen von "Groundcrew" sehen das und kommen vorbei, um sich mit mir zu unterhalten und bekommen dafür "PosX".
Worin der Unterschied dieser Ökonomie zum Kapitalismus bestehen soll, wird nicht erklärt. Das liegt daran, dass es keinen gibt. Die Währung ist ausdrücklich dafür gedacht, angehäuft zu werden, was dem Grundprinzip des Kapitalismus, aus Geld mehr Geld machen zu müssen, nicht widerspricht. Das Spiel erschließt ihm damit neue Märkte. Als großes Novum bezeichnet McGonigal, dass bei diesem Spiel ja nicht nur die Leute, denen ein Gefallen getan wird, "PosX" bezahlen müssten – nein, auch diejenigen, die es genießen, solche Missionen zu erfüllen, könnten ihr Gegenüber dafür mit "PosX" belohnen. Das sei eine kluge und radikale Idee, die direkt dem Geschäftsmodell der Gamesindustrie entsprungen sei, bei dem die SpielerInnen dafür bezahlen, hart arbeiten zu dürfen.
Pause! So ein Blödsinn.
Das Geschäftsmodell der Gamesindustrie besteht darin, aus dem Bedürfnis der Menschen nach Realitätsflucht Profit zu ziehen. Sie wendet sich Free2Play-Modellen zu und verhält sich dabei wie ein Dealer, der das Verlangen nach dem Produkt, das er verkauft, durch ein paar Kostproben überhaupt erst erschafft. Die Idee, für erfüllende Arbeit die sogenannten Arbeitgeber bezahlen zu dürfen, würde vielleicht auf einem FDP-Parteitag Beifall finden. Radikal ist sie nur in ihrer Naivität, zu glauben, etwas Neues zu schaffen und nicht nur alte Ausbeutungsmechanismen umzulabeln. Doch das ist der Kern der Gamification: Wenn man hinter die glühenden Verheißungen schaut, bleibt nur eine neoliberale Modernisierungsideologie übrig. Auch das letzte Bisschen unproduktiver Freizeit möchten die VerfechterInnen der Gamification dem Verwertungszwang unterwerfen, denn schließlich strengen wir uns beim Spielen an und vergeuden so die wertvolle Ressource Arbeitskraft.
Damit ist die Gamification voll im Trend des gesellschaftlichen Wandels. Vom 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts lebten die Menschen nach dem Philosophen Michel Foucault in Disziplinargesellschaften. Diese zeichnete aus, dass die Menschen in ihr feste Funktionen in einer Hierarchie ausfüllten. Es war also immer klar, wer welche Aufgabe hatte, wer Chef und wer Arbeiter war. Familie, Schule, Fabrik, Armee oder Gefängnis: Sie alle waren voneinander getrennt und hatten jeweils andere Verhaltensregeln. Im Gegensatz dazu beschreibt sein Kollege Gilles Deleuze die Kontrollgesellschaft, die sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt. In ihr wird die Kontrolle über uns nicht mehr durch die nächste Instanz in der Hierarchie ausgeübt, sondern wir verinnerlichen die Herrschaft. Wir sind also selbst die Aufpasser, die darauf achten, dass wir die Regeln einhalten. Statt in Schulen zum Lernen gezwungen zu werden, möchten wir freiwillig ein Leben lang lernen und die Fabrik, in der gemeinsam an einer Sache gearbeitet wurde, wird durch das Unternehmen, in dem auch intern ständig Wettkampf herrscht, ersetzt. Auch die Trennung von Freizeit und Arbeit wird aufgeweicht und eine der Strategien dafür ist heute die Gamification. Die Freizeit gehörte zwar nie ganz uns, weil ihr Zweck schon immer war, dass wir uns in ihr für die Arbeit erholen. Aber sie war auch nie identisch mit der Arbeit. In einer gamifizierten Kontrollgesellschaft sind die beiden Bereiche im Idealfall nicht mehr zu unterscheiden.
Nicht spielen könnte zum Luxus werden
Das beginnt harmlos damit, dass wir uns beim Spielen von "Chore Wars" in Fantasy-RPG-Charaktere verwandeln und dann beim Hausarbeiterledigen hochleveln. Doch anderswo wird es gefährlich. Der österreichische Medienkünstler Johannes Grenzfurthner berichtet vom gamifizierten Einkauf. Ein Supermarkt habe ein Spiel entwickelt, bei dem die Kundschaft für das Finden abgelaufener Lebensmittel das gefundene Produkt und zusätzlich ein gleiches, haltbares geschenkt bekommt. Zwar würden dieses Beispiel sicher viele nicht als Gamification beschreiben. Hier passiert aber genau das, was Gamification ausmacht: Ein Spielmechanismus (Suchspiel) und eine aus Spielen bekannte Motivation (Gewinn) werden auf eine alltägliche Situation angewandt, um ein Problem (abgelaufene Lebensmittel in den Regalen) zu lösen. So trivial das Beispiel klingt, hat es aber doch weitreichende Folgen. Der Supermarkt spart sich die Hilfskräfte, die vorher das Problem lösen sollten. Und es wird Menschen geben, die dieses Spiel spielen müssen, weil sie auf den Gewinn angewiesen sind, da sie sich die Lebensmittel sonst nicht leisten können – schließlich hat der Supermarkt ihre Stelle soeben gestrichen. Man stelle sich vor, dass die Gamification sich großflächig durchsetzt. Wo es heute ein Privileg ist, Freizeit zu haben und in ihr spielen zu dürfen, wird es in einer gamifizierten Welt ein Luxus sein, nicht spielen zu müssen.
Doch wir müssen diese Entwicklung nicht akzeptieren. Auch unsere Spiele verändern sich. Zum Teil wenden sie sich ab von den alten Mechanismen und der öden Fleißbildchensammlerei, hin zum Entdecken oder Erschaffen als Selbstzweck, ohne Zielvorgabe oder Wettbewerb, wie in "Dear Esther" oder "Minecraft". Als GamerInnen, die die schlechten Spiele schon kennen, sollten wir aufpassen, wo versucht wird, den gleichen Mist in unseren Alltag zu implementieren. Denn die besten Dinge unserer Spiele, wie dass meine Entscheidungen im Spiel außerhalb konsequenzlos sind oder dass ich verlieren und neu anfangen kann, wird man in den Realitätsspielen nicht finden. Wir brauchen SpielverderberInnen, die sich in der Materie auskennen und die Gamification als das entlarven was sie ist: Exploitationware. (Benedikt Frank, Text aus WASD4 für derStandard.at, 15.12.2013)