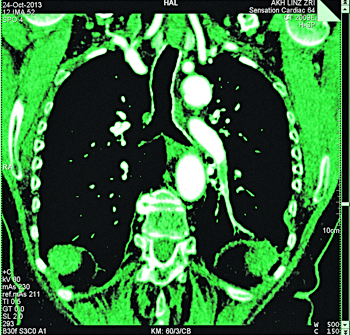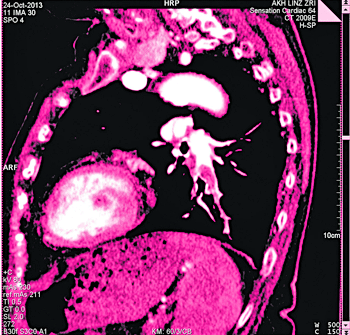Das Verfahren ist längst medizinischer Alltag. Dank CT, der Computertomografie, können Ärzte tiefen Einblick in das Körperinnere ihrer Patienten bekommen. Die Methode basiert auf der klassischen Röntgentechnologie. Röntgenstrahlung wird beim Durchdringen von Materie in unterschiedlichem Maße verringert. So gelangen bereits vor mehr als 100 Jahren Bilder vom Skelett lebendiger Menschen.
Moderne CT-Anlagen scannen den Körper in hauchdünnen Schichten und errechnen daraus hochauflösende Bilder. So werden nicht nur Knochen, sondern auch Weichteilstrukturen und Flüssigkeitsansammlungen sichtbar. Sogar gefährliche Ablagerungen in den Herzgefäßen lassen sich mittlerweile per CT aufspüren.
Den Kontrast erhöhen
In der Fachsprache wird die Absorptionsfähigkeit von Substanzen für Röntgenstrahlung als Dichte bezeichnet. Ihre Maßeinheit ist die Hounsfield-Unit, kurz HU. Wasser dient als Standard und hat dementsprechend eine Dichte von 0 HU. Luft, welche die Strahlung praktisch gar nicht aufnimmt, hat -1000 HU, Blut dagegen circa +30 HU.
In zahlreichen Fällen jedoch ist die Eigenabsorption von Geweben für eine detaillierte Darstellung nicht wirklich ausreichend. Organe wie Leber oder Pankreas, Blutgefäße, Lymphdrüsen und dergleichen zeigen ihre Strukturen nicht in der gewünschten Auflösung. Um diesbezüglich Abhilfe zu schaffen, werden den Patienten spezielle Hilfsstoffe verabreicht, meist als intravenöse Injektion. "Wir verwenden routinemäßig sogenannte nierengängige, jodhaltige Kontrastmittel", erklärt der Radiologietechnologe Johannes Krieger vom AKH Linz im Gespräch mit dem Standard.
Der Clou dahinter: Das gelöste Jod absorbiert Röntgenstrahlung sehr intensiv. Da es sich mit dem Blut, dessen Dichtewert nach Injektion auf bis zu 400 HU steigt, unterschiedlich schnell und unterschiedlich stark in den Geweben verbreitet, werden diese auf den CT-Aufnahmen in viel deutlicherem Kontrast dargestellt. So kann der Arzt die Bilder besser interpretieren. Je stärker ein Organ oder ein Gewebe durchblutet ist, desto heller erscheint es.
Die Verwendung von Kontrastmitteln hat allerdings auch seine Schattenseiten. Die großen Jodmengen können prinzipiell dem Organismus schaden, unter anderem über eine Beeinträchtigung der Schilddrüse. Die Substanz muss zudem wieder ausgeschieden werden, was eine zusätzliche Belastung für die Nieren bedeutet. "Man sollte pro Kilogramm Körpergewicht maximal zwei Milliliter Kontrastmittel einsetzen", sagt Krieger. Das entspricht zwei Milligramm an gelöstem Jod.
Richtige Zeit, richtiger Ort
Welche genaue Dosierung verabreicht wird, hängt also vom Gewicht des Patienten ab und davon wiederum die Einleitungs- beziehungsweise Transportgeschwindigkeit der injizierten Flüssigkeit, wie Krieger betont. "Das Kontrastmittel muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein." Das erfordert exakte Berechnungen im Voraus.
Der technologische Fortschritt macht die Kalkulationen nicht einfacher, denn die CT-Geräte arbeiten immer schneller. Brauchte es früher noch 30, 40 Sekunden für eine Untersuchung des Bauchraums, so dauert dies heute manchmal weniger als eine Sekunde. Für die Qualität der Aufnahmen ist das grundsätzlich von Vorteil. Störungen durch die Atmung oder andere Bewegungen wirken sich kaum noch aus, Kinder müssen deshalb oft nicht mehr sediert werden. Andererseits verengt sich das Zeitfenster für die genaue Erfassung der unterschiedlich absorbierten Strahlung. Es ist ähnlich wie in der Fotografie: Eine kurze Aufnahmedauer braucht große Mengen Licht.
In der CT-Praxis sollte dieses Problem weder durch höhere Kontrastmitteldosen noch durch stärkere Bestrahlung gelöst werden - die Risiken für die Patienten sind sehr hoch. Neben den technischen Weiterentwicklungen bleibt nur die Verbesserung der Dosierungsprotokolle, das Zusammenspiel von Strahlungsintensität, Jodkonzentration und Gewebeeigenschaften in Kombination mit den zeitlichen Abläufen. Und im Bereich dieser Feinjustierungen gibt es noch erhebliche Optimierungspotenziale, wie eine Studie am Zentralen Radiologie-Institut des AKH Linz gezeigt hat.
Gezielte Anpassung
Michael Hinkle, ein junger Kollege von Krieger, hat die Daten von bereits im Jahr 2009 erfolgten CT-Untersuchungen bei insgesamt 3280 Patienten unterschiedlicher Gewichtsklassen vergleichend analysiert und hieraus die Richtwerte für verbesserte Protokolle errechnet. Anschließend wurden diese durch Messungen bei 655 Personen erprobt. Die Versuche waren die Grundlage für Hinkles Masterarbeit.
Die Testergebnisse zeigen: Durch gezielte Anpassungen der Kontrastmittelverabreichung und der Strahlungsintensität an das Körpergewicht des Patienten lassen sich dieselben oder sogar bessere Dichtewerte im Gewebe erzielen als bei Anwendung herkömmlicher Protokolle.
Besonders gut funktioniert dies bei Gefäßuntersuchungen. Aufnahmen von Lungenarterien zum Beispiel lassen sich dank des neuen Verfahrens bei Personen unter 71 Kilogramm Gewicht mit 25 Prozent weniger Kontrastmittel durchführen. Bei Messungen in Organgeweben fallen die Reduzierungen nicht ganz so spektakulär aus, aber im Durchschnitt dürfte eine Verringerung des Kontrastmittelverbrauchs von fünf bis zehn Prozent erzielbar sein, heißt es im Resümee der Studie von Hinkle. Das spart auch Geld.
Strahlenbelastung sinkt
Die Anwendung der neuen Protokolle ist im AKH Linz bereits seit etwa zwei Jahren Standard, berichtet Krieger: "Wir sehen, dass es wirkt." Hinkle wurde beim diesjährigen Ideenwettbewerb des Gesundheitsclusters Oberösterreich mit dem ersten Preis in der Kategorie Gesundheitseinrichtungen ausgezeichnet.
Die Individualisierung der CT-Diagnostik ermöglicht auch eine Senkung der Strahlungsbelastung - ebenfalls eine Frage des Körpervolumens. "Ein schlanker Patient muss mit weniger Strahlung untersucht werden als eine normalgewichtige oder übergewichtige Person", sagt Krieger. "Da hat man als Anwender einen großen Spielraum und auch eine große Verantwortung." Die Verringerung könnte bis zu 50 Prozent betragen. Weitere Optimierungsstudien sind bereits in Planung. (Kurt de Swaaf, DER STANDARD, 30.10.2013)