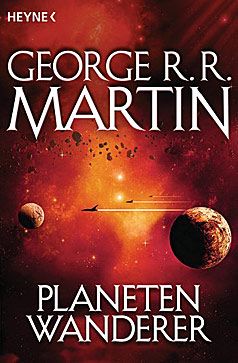
George R. R. Martin: "Planetenwanderer"
Broschiert, 512 Seiten, € 15,50, Heyne 2013 (Original: "Tuf Voyaging", 1986)
Und wieder schließt sich ein Kreis. Die Originalversion von "Planetenwanderer" war seinerzeit das erste englischsprachige Buch, das ich für die Rundschau rezensiert habe (hier die Nachlese). Damals noch ein Experiment - manche Medien rezensieren prinzipiell keine fremdsprachigen Werke -, das aber rasch Anklang gefunden hat. War aber auch ein Einstieg, der's einem leicht gemacht hat: Großartiges Buch!
Wenn sich seit damals etwas verändert hat, dann der Umstand, dass George R. R. Martin heute noch mehr mit dem "Lied von Eis und Feuer" bzw. "Game of Thrones" identifiziert wird. Und letztlich ist der Erfolg der Serie ja auch dafür verantwortlich, dass Martins Name zugkräftig genug geworden ist, um auch mal ganz was Anderes aus seinem Schaffen für den deutschsprachigen Markt aufzubereiten. Wie diese lose zu einem Roman gekoppelte Ansammlung von SF-Kurzgeschichten, die in ihren Einzelteilen bis Mitte der 70er Jahre zurückreicht.
Zur Ausgangslage
Hauptfigur Haviland Tuf wird uns als interstellarer Frachterkapitän ohne Kundschaft vorgestellt. Rasch zeichnet sich ab, dass seine geschäftliche Erfolglosigkeit an seiner einzigartigen Persönlichkeit liegen dürfte. Also jener Unbestechlichkeit - oder vielleicht sollte man sagen: Unbeeinflussbarkeit -, mit der er alle Menschen, die mit ihm zu tun haben, in den Wahnsinn treibt. Bis auf die LeserInnen natürlich, die dürfen sich darüber königlich amüsieren.
Tufs wirtschaftliche Verhältnisse wenden sich exorbitant zum Besseren, als ihn einige Glücksritter für die Suche nach einem ganz besonderen Schatz anheuern: Dem letzten erhalten gebliebenen Saatschiff des vor 1.000 Jahren untergegangenen Ökologischen Ingenieurskorps. Die Eröffnungsepisode "Der Seuchenstern" schildert mit viel schwarzem Humor, wie die raffgierigen Schatzsucher einer nach dem anderen zu Tode kommen und Tuf schließlich als Alleinerbe der "Arche" dasteht: Eines 30 Kilometer langen Klotzes voller Zellbibliotheken und Klonkammern, in dem so ziemlich jede bekannte Spezies vom Tier bis zum Virus nachgezüchtet werden kann. Ursprünglich eigentlich als Mittel der biologischen Kriegsführung gedacht, lässt sich dieses Arsenal auch für gute Zwecke einsetzen. Und Tuf legt los.
Und immer wieder S'uthlam
Tuf wird unter anderem einen falschen biblischen Propheten enttarnen, indem er Plagen gegen Plagen ins Feld führt, einen Bio-Krieg auf einer Welt entfesseln, die in Wahrheit etwas mehr ökologische Einsicht bräuchte, sowie die widerwärtigen Tierkämpfe beenden, die von BewohnerInnen eines dritten Planeten veranstaltet werden. Das ist ganz im Stil von Old-School-SF Mitte des 20. Jahrhunderts geschrieben: Schelmenstücke à la Jack Vances Magnus-Ridolph-Stories mit Humor, überraschenden Twists und einem Ansatz von erhobenem moralischen Zeigefinger. Da liegt auch ein kleines bisschen Terry Pratchett in der Luft.
Eine besondere Rolle nimmt der horrend überbevölkerte Planet S'uthlam ein, den Tuf insgesamt dreimal in ebensovielen Episoden besucht. Dabei trifft er auf die einzige Person, die ihm Paroli bieten kann: Tolly Mune alias "Ma Spider", die Leiterin des Orbitalhafens und spätere Herrscherin von S'uthlam; jähzornig, gemein, mit rauem Humor, erschreckend kompetent, allgegenwärtig, unverwüstlich, so groß wie eine Naturgewalt und doppelt so bösartig. Die Dialoge zwischen den beiden ... Kontrahenten? Verbündeten? Freunden? ... sprühen derart vor Esprit, dass es eine wahre Freude zu lesen ist.
Martin'sche Moral
Interessanterweise habe ich die Konstellation Tuf-Mune diesmal genau umgekehrt zum letzten Mal gelesen. Ma Spider, die mindestens so hart wie ihre weltraumstrahlungsgegerbte Haut ist, machte diesmal für mich von Anfang an den Eindruck einer rundum positiven Figur. Wenn auch einer, die sich aus den kulturellen Vorstellungen, die ihre Heimatwelt zu Grunde richten, nicht lösen kann.
Den ursprünglichen Sympathieträger Tuf hingegen habe ich diesmal - wohl auch in Erinnerung an seine spätere Entwicklung - schon früh eher skeptisch gesehen. Er hat zwar de facto immer recht - doch rein menschlich bleibt er so kalt wie das Vakuum. Tausende sterben auf dem Wasserplaneten Namor, während Tuf behutsam ökologischen Recherchen nachgeht. Diese erweisen sich zwar als notwendig, aber rechtfertigt dies, dass Tuf keinerlei Betroffenheit erkennen lässt?
Im Lauf der Episoden wirkt Tuf immer unheimlicher. Er hält einen Menschen, der ihn aus nachvollziehbaren Gründen attackiert hat, als Sklaven, zerstört Kulturen "zu ihrem Besten" und sieht sich selbst immer mehr in der Rolle eines Gottes; zuletzt wird er dies sogar offen aussprechen. Die Ambivalenz der beiden Hauptfiguren - einer, die Probleme auf eine unmenschliche Weise löst, und einer, die menschlich bleibt, aber an den Problemen scheitert - macht "Planetenwanderer" zu mehr als nur einer Aneinanderreihung humorvoller Abenteuer. Und ist zugleich so typisch für George R. R. Martin, wie es nur geht: Niemand ist vollkommen gut, niemand vollkommen schlecht.
Ausgabe mit ein paar Problemen
Faszinierend, dass es eine deutsche Ausgabe wieder mal schafft, doppelt so dick zu sein wie eine englischsprachige - und das, obwohl weder die ausführliche Martin-Bibliografie noch die vielen wunderbaren Innenillustrationen enthalten sind, mit denen die Meisha-Merlin-Ausgabe von 2003 glänzte. Dein Buchregal wird es dir nicht danken.
Im übertragenen Sinne ebenso schwer ins Gewicht fällt ein sprachliches Manko. Verblüfft habe ich festgestellt, dass ich über einige extra-pointierte Passagen, an denen ich mich im Original ergötzt und sie zum Zitieren notiert hatte, diesmal einfach drübergelesen habe. Das Nachblättern ergab im ersten dieser Fälle eine schlampige Übersetzung. Bald darauf bin ich über einen inhaltlichen Widerspruch gestolpert, und siehe da: Der gepanzerte goldene Riese war in Wahrheit ein armored giant of old (ohne "g").
Das ist ärgerlich, und da das Buch ohnehin so sehr von seinen geschliffenen Dialogen lebt, würde ich eher den Kauf der Originalausgabe empfehlen. Die von Meisha Merlin wird nur noch mit viel Glück in irgendwelchen Online-Antiquariaten aufzutreiben sein, aber im Jänner ist eine neue Ausgabe bei Bantam Books erschienen. Freut euch und kauft!
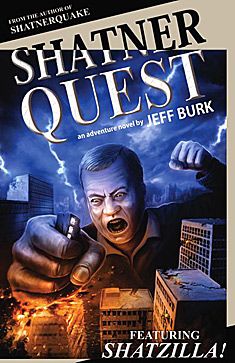
Jeff Burk: "Shatnerquest"
Broschiert, 170 Seiten, Eraserhead Press 2013
Vier Jahre ist es nun schon her, dass Bizarro-Autor Jeff Burk mit "Shatnerquake" entzückt hat: Einem irrwitzigen popkulturellen Wirbelsturm, worin dem Ein-Mann-Konzern William Shatner sein Lebenswerk buchstäblich ins Gesicht springt, nachdem eine "Fiktionsbombe" seine diversen Rollen zum Leben erweckt hat. Offenbar ist Burk danach nicht nur die befürchtete Klage Shatners erspart geblieben. Das Buch hat sich auch zum Überraschungserfolg gemausert und sich so gut verkauft, dass Burk die - ursprünglich nur scherzhafte - Ankündigung eines Sequels nun wahr gemacht hat.
Die Frage, die sich damit naturgemäß stellt, lautet: Wird "Shatnerquest" den Weg der meisten Sequels gehen: Also größer, aufwändiger, bombastischer ... und nicht so gut wie das Original sein? Die Antwort lautet kurz gesagt: ja. Aber zum Glück sind wir von hohem Niveau gestartet.
Die Kanon-Apokalypse
Erneut befinden wir uns auf einer SF-Convention, als die Apokalypse losbricht - stilgerecht angekündigt durch eine Lautsprecherdurchsage Majel Barretts, Gott hab sie selig. Die drei Geeks Benny, Gary und Janice können sich gerade noch so aus den Trümmern des Convention-Centers retten und stehen angesichts des Weltuntergangs vor der Frage: Was jetzt? Gary gibt die einzig logische Antwort: "Let's fucking save William Shatner. If we don't save him who will?"
Also brechen sie in Begleitung von Bennys übergewichtiger Katze Squishy zu einem transkontinentalen Road-Trip auf. Alle vier in Star-Trek-Uniformen, auch die Katze (Squishy sollte man übrigens nicht als bloßes Accessoire betrachten, da wird's noch einen großen Heldenauftritt geben). Unterwegs treffen sie unter anderem auf Klingonen-Biker, Borg-Zombies, diverse Kaijū, Tribbles und einen Star-Trek-Kult mit dem falschesten Captain Kirk, den man sich nur denken kann.
Am Ziel widerfährt ihnen dann das, was beim Szenario "Fan trifft Star" so oft vorprogrammiert ist: Eine riesengroße Enttäuschung. Wortwörtlich in diesem Fall. "So William Shatner's turned into a giant and is rampaging across the city," said Janice. "This is unexpected." Ein wunderschönes Understatement und kein Spoiler, denn Cover und Klappentext ("There actually is something even bigger than William Shatner's ego. And it is ... William Shatner") kündigen ja schon vorab an, was uns erwarten wird: Nichts Geringeres als Shatzilla!
Die Rettung liegt im Fantum
Jeff Burk greift all die Plot-Elemente auf, aus denen sich eine Apokalypse-Geschichte so zusammensetzt. Die Rettungsmission mit Hindernissen. Die Bedrohung durch Gangs und Warlords, die nach dem Weltuntergang aus ihren Löchern gekrochen kommen. Und der Versuch, letzte Bastionen der Zivilisation zu bewahren. In diesem Fall eine Kolonie von Steampunks - gar nicht so abwegig gedacht, immerhin gibt es innerhalb der Tinker-Subkultur einen starken Zug von "Wir bereiten uns auf den großen Zusammenbruch vor". Allerdings konnte niemand damit rechnen, mit brennenden Tribbles attackiert zu werden ...
Flashbacks bringen uns die Hauptfiguren näher: Benny, der als Game-Entwickler nicht an seinen Debüterfolg anknüpfen kann und die soziale Leiter nach unten klettert. Der drogensüchtige Gary, der Slash-Fiction schreibt und glaubt, dass Kirk zu ihm aus dem Fernseher spreche. Und Janice, die für eine Beziehung mit einem Banker ihre sorgsam aufgebaute Nerd-Sammlung geopfert hat. Sie alle fanden im Comic-Laden Brave Nerd World einen sicheren Hafen - selbst Streunerin Squishy, die ohne die Fastfood-Abfälle der Comic-Fans verhungert wäre.
Burk schreibt, er habe aufgrund persönlicher Erfahrungen die seelenheilende Wirkung der Vernetzung mit anderen Geeks darstellen wollen. Und das drückt sich in "Shatnerquest" nicht nur in den Lebensgeschichten der Hauptfiguren aus. Der Roman ist im Grunde eine einzige Rundreise durch Fankulturen. Und selbst wenn manche davon ins Aberwitzige verzerrt sind, kommt man doch nicht umhin zu bemerken, dass offenbar niemand die Apokalypse überlebt hat, der nicht irgendwie "fannish" wäre. Wer ist jetzt der Mainstream? Ha!
Resümee
"Shatnerquest" hat schon so seine Momente. Gegen Ende, wenn sich endlich die Titelfigur wieder mit brachialer Gewalt in den Mittelpunkt rückt, knüpft es sogar an die Qualitäten von "Shatnerquake" an, das Burk im Vorwort zu Unrecht als silly little book abgetan hat. Geplant oder nicht geplant - geschaffen hatte er damit ein Stück Metafiktion, dessen Tempo und Unterhaltungswert fast überschatteten, wie klug es eigentlich war.
Im letzten Abschnitt samt großartigem Showdown kommt die Fortsetzung dem nahe. Davor wirkt sie bei allem Witz über weite Strecken doch eher beliebig in dem, was so passiert. Zumindest ist "Shatnerquest" aber eine gute Alternative zum Phantastik-Humoristen A. Lee Martinez. Und zum Genreparodien-Output à la "Der kleine Hobbnix" oder gar "George R.R. Marzahn: Das Lied von Eis und Schlagsahne" erst recht.

Frank Hebben: "Das Lied der Grammophonbäume" und Frank Hebben & André Skora (Hrsg.): "Fieberglasträume: Kybernetische Kurzgeschichten"
Gebundene Ausgabe, 122 Seiten, € 12,30, bzw. broschiert, 336 Seiten, € 15,40, Begedia 2013
Nach fünf Jahren Rundschau bin ich nicht mehr so leicht zu beeindrucken wie anfangs, aber manche Dinge halten. Dazu gehört auch das Schaffen des deutschen Autors Frank Hebben, der in seiner 2008 erschienenen Storysammlung "Prothesengötter" die biomechanische Verschmelzung von Mensch und Maschine in schaurige Höhen getrieben hatte. Daran knüpft er in der von ihm mitherausgegebenen Anthologie "Fieberglasträume" sowie in der heuer bei Shayol erschienenen neuen Sammlung "Maschinenkinder" an. Dazwischen aber überraschte Hebben mit etwas ganz Anderem, das zunächst nur als E-Book erschien und nun im Begedia-Verlag auch gedruckt veröffentlicht wurde.
Zurück in die Vergangenheit
"Das Lied der Grammophonbäume", gebunden im schnuckligen Postkartenformat von 17,5 x 12 Zentimetern, ist eine Sammlung von neun Kurzgeschichten, die insgesamt Novellenlänge erreichen. Das Generalthema lautet Erinnerungen, und so weisen die Erzählungen auch von ihrem Setting her eher in die Vergangenheit als in die Zukunft. Die Poe-artige Schauergeschichte "Das Uhrwerk" etwa und das ähnlich konstruierte "Das schweigende Haus" sind beide im 19. Jahrhundert angesiedelt. Selbst "Imperium Germanicum", das bereits in "Prothesengötter" enthalten war und deutliche SF-Züge trägt, gehört eigentlich in die Vergangenheit - wenn auch eine, die so nie stattgefunden hat. Es ist die albtraumhafte Vision eines nie zu Ende gegangenen Ersten Weltkriegs: Der Tod ist Maschinist, die Pest ist Chemiker geworden, und wir Soldaten sind die Ratten, graben Schützengräben quer durchs verstrahlte Vaterland ...
"Imperium Germanicum" bildet den krassestmöglichen Kontrast zu "Das Wunder von Flandern", einem Moment der Hoffnung, als 1914 an der Westfront für kurze Zeit der Weihnachtsfriede einkehrte. Beruhend auf einer wahren Begebenheit, so unglaublich sie auch anmutet. Das "Wunder" ist eines von mehreren Stücken Flash Fiction bzw. "Kürzestgeschichten" in der Sammlung: Wenige Seiten umfassende Momentaufnahmen, in denen wir kurz in das Denken des jeweiligen Erzählers switchen. Etwa eines vom Krieg in Mitleidenschaft gezogenen Hauses oder eines alten Mannes, der sich an sein wechselvolles Leben erinnert. (Letzteres - "Der Seeraum" - spiegelt sich dann noch einmal in der längeren Titelgeschichte wider.) Diese Momentaufnahmen sind mal poetisch, mal so grausam und hoffnungslos, wie man es aus Hebbens Zukunftsgeschichten kennt.
Dazu kommen dann noch das erstmals in dieser Sammlung veröffentlichte "Das Brandmal", in dem sich allerhand Fantasy-Volk in einer dreckigen Cyberpunk-Handlung herumtreibt, und "Stormrider", in dem der Tod höchstselbst ein Motel in der Wüste besucht. Insgesamt ist "Das Lied der Grammophonbäume" also eher der Fantasy respektive ihren Geschwistern Horror und Slipstream zugeneigt als der Science Fiction. Das hätte man nach "Prothesengötter" nicht unbedingt erwartet, den Lesegenuss schmälert es aber keineswegs.
Kybernetische Kurzgeschichten
Die zeitgleich herausgegebene Anthologie "Fieberglasträume" trägt den Titelzusatz "Kybernetische Kurzgeschichten". Insofern ist es nicht ganz selbstverständlich, wenn im Vorwort dazu das Hohelied auf den Cyberpunk gesungen wird - Hebben zeigte ja, dass sich das Wechselspiel von Mensch und Maschine in noch ganz anderen und viel ausgefalleneren Formen weiterdenken lässt. Und tatsächlich sind unter den 15 hier versammelten Geschichten diejenigen, die auf klassischen Cyberpunk setzen, auch die am wenigsten interessanten, weil sie dem mittlerweile über 30 Jahre alten Genre nichts Neues hinzufügen.
Gut die Hälfte der Autoren - viele davon aus der Rollenspieler-Community kommend - setzen auf die klassischen Topoi: Fehlender sozialer Zusammenhalt, eine Wirtschaft, die endgültig nicht mehr von organisiertem Verbrechen zu unterscheiden ist, ProtagonistInnen vom unteren Rand der Gesellschaft, die für Datenklau-Missionen angeheuert werden, Computertechnologie mit Körperschnittstellen und dazu jede Menge Gewalt, Drogen und ungesundes Essen. Am besten wird diese Formel von Peer Bieber in "Die drei Tage des Hiob" umgesetzt, weil hier die Entmenschlichung bis zur Total-Eskalation getrieben wird (dagegen nehmen sich die Kampfszenen anderer Autoren wie harmlose Geplänkel aus). Nicht von ungefähr wird in dieser Geschichte aber auch das Ende der bisherigen Welt eingeläutet - und damit auch das des altbekannten Cyberpunk-Settings, in dem sich allzuviele der übrigen Beiträge gemütlich eingerichtet haben.
Die Highlights
Vollkommen anders gestrickt ist beispielsweise "Der Sturz" von Michael K. Iwoleit. Vor dem Hintergrund eines Anschlags und einer folgenschweren diplomatischen Mission versucht sich hier der orientierungslose Erzähler in seinem Avatar zurechtzufinden. Allerdings handelt es sich in diesem Fall um eine KI, die ihren neuen Körper durch das Reallife zu steuern versucht - eine reizvolle Umkehrung. (Und wird der Mann jemals einen Schluss schreiben, bei dem's einen nicht schaudert?)
Herrlich bösartig ist die Biopunk-Geschichte "Demeters Garten" von Thorsten Küper: Ein Häuflein skrupelloser WissenschafterInnen eines Umbrella-artigen Gentechnik-Unternehmens wurde offenbar von der Regierung in einem unterirdischen Laborkomplex einbetoniert. Die an Uwe Post erinnernde Erzählung ist in den Rahmen einer Teambesprechung eingebettet, und die Komik des Ganzen liegt gerade darin, dass die ProtagonistInnen eine Art von Routine aufrechtzuerhalten versuchen, während rings um sie längst der selbstverschuldete Wahnsinn tobt. Einen Twist gibt es noch obendrauf.
Positives und Negatives
Generell gilt für diese Sammlung: Die besseren Geschichten kommen von den bekannteren Namen. Allerdings gibt es - zumindest für mich - auch Neuentdeckungen. Allen voran Sven Klöpping: In "Kabelgott" lässt er seinen Protagonisten hemmungslos in die Weiten des Cyberspace eintauchen. Er ist gekommen, um zu konsumieren, und wird am Ende konsumiert. Und Niklas Peinecke ist mir bislang mit ein paar Kurzgeschichten mit originellen Ideen aufgefallen, die exakt für die Länge der jeweiligen Erzählung ausreichten. In "Animatoo" erweckt Peinecke erstmals den Eindruck, dass er etwas zurückhält. Die Geschichte um einen Handlungsreisenden bzw. Vollstrecker in Sachen Technologie-Patente deutet einen größeren Weltentwurf an, der jederzeit zu einem Roman ausgebaut werden könnte.
Die Quote an wirklich guten Geschichten ist in "Fieberglasträume" nicht geringer als in der durchschnittlichen SF-Anthologie. Das Bild wird nur leider ein wenig dadurch verzerrt, dass es bei einer ganzen Reihe Autoren sprachlich holpert. Typische Fehler sind das Einbauen beschreibender Elemente - etwa zum Aussehen einer Figur - zur Unzeit, z.B. mitten in einer Action-Sequenz, was das Tempo rausnimmt; oder Sätze, in die so viele Gedankengänge hineingepackt wurden, dass sie die Richtung verlieren; Wörter, die nicht zum - gewollt dreckigen - Ton der Erzählung passen; und das Bemühen um allzu originelle Formulierungen, die dann krampfhaft wirken.
Ein strengeres Lektorat könnte da einiges noch rausbügeln. Und bei der Gelegenheit auch Beistrichsetzung und Rechtschreibung etwas auf Vordermann bringen - nur den Wischmob würde ich lassen, das hat was.
Einmal mehr: Hebben
Höhepunkt der Anthologie sind zwei miteinander verbundene Geschichten von Mitherausgeber Frank Hebben selbst ("Zeit der Asche #Rheingold") und "Rost"-Autor Christian Günther ("Zeit der Asche #Hanse"). Ohne Vorwarnung oder Gnade werfen uns die beiden in eine entsetzliche Zukunft nach dem großen Zusammenbruch. In einer Welt aus Asche, Gift, allesinfizierenden Mikromaschinen und mutierter Natur existieren die letzten Überlebenden nur noch in abgeschotteten Kolonien, angeführt von nietzscheanischen Übermenschen. Bis zwei davon der Ruf ereilt, sich auf eine letzte Wanderung zu begeben.
Hebben schildert in expressionistischer Weise, wie sich die biomechanische Königin einer unterirdischen Kolonie mit ihrem ganzen Volk auf den Weg macht. Günther lässt - mit nicht ganz ebenbürtiger Sprachgewalt, aber immer noch beeindruckend - die Flotte der Hanse folgen. Das Ausmaß von Grauen und Faszination, das diese Erzählungen ausüben, ist in seiner Bildhaftigkeit enorm - ich könnte mir das gut als Graphic Novel von Caza oder Philippe Druillet vorstellen. Großes Kino!

Jay Lake: "Die Räder der Zeit"
Broschiert, 542 Seiten, € 15,50, Bastei Lübbe 2013 (Original: "Pinion", 2010)
Das Echo war enorm, nachdem der kürzlich leider verstorbene Iain Banks im April seine Krebserkrankung bekanntgegeben hatte. Daneben ging praktisch unter, dass auch der amerikanische Autor Jay Lake öffentlich gemacht hatte, an Krebs in fortgeschrittenem Stadium zu leiden. Derzeit wird ein Dokumentarfilm gedreht, der sich Lakes Kampf gegen die Krankheit widmet.
Vorwissen dringend empfohlen
In Kürze wird bei Bastei der Beginn von Lakes Fantasy-Reihe "The Green Universe" herauskommen, bislang gibt es aus seinem vielseitigen Schaffen nur die Clockpunk-Trilogie "Mainspring Universe", die nun mit "Die Räder der Zeit" ihren Abschluss gefunden hat. Meiner Meinung nach ist die Reihe übrigens eher ein weitgehend abgetrennter Einzelroman ("Mainspring"/"Die Räder der Welt"), der von einer Duologie gefolgt wurde. Teil 2, "Die Räder des Lebens", sollte man allerdings unbedingt gelesen haben, ehe man sich diesem Buch hier widmet, sonst checkt man nichts mehr.
Ein Beispiel zur Illustration: Mit Emily Childress hätten wir da etwa eine Bibliothekarin aus den niemals unabhängig gewordenen amerikanischen Kolonien, die nun de facto ein chinesisches U-Boot kommandiert und damit über den Indischen Ozean schippert. Mit an Bord Angus Threadgill al-Wazir, Agent der britischen Krone und damit eigentlich Todfeind Chinas ... aber sie alle bilden zusammen ein Team. Wie es zu derart bizarren Personenkonstellationen kommen konnte, wäre ohne die Lektüre von Band 2 nicht mehr nachvollziehbar.
Der Clockpunk-Weltkrieg in den Kolonien
In Band 1 wurde man beim Lesen noch voll und ganz vom einzigartigen Worldbuilding in Atem gehalten, welches das Universum buchstäblich zu einem einzigen gewaltigen Uhrwerk aus Messing macht. Band 2 setzte dann stärker auf die politischen Konflikte. Zum einen zwischen den beiden rivalisierenden Supermächten der Nordhalbkugel, England und China; zum anderen zwischen zwei weltweit agierenden Geheimbünden, dem Avebianco und dem Schweigsamen Orden. Die Ziele dieser beiden konkurrierenden Bünde sind mir übrigens auch nach dem Lesen von Band 3 immer noch nicht wirklich klar.
Und während nun der Konflikt zwischen England und China, die beide auf die unerschlossene Südhalbkugel vordringen wollen, zum offenen Krieg eskaliert, sind unsere bisherigen Hauptpersonen vor allem eines: unterwegs. Ein paar neue kommen sogar noch dazu. Darunter Gashansunu, eine Magierin aus einer ziemlich abgehoben beschriebenen Hochkultur der Südhalbkugel. Und mit Hethor Jacques begegnen wir sogar der Hauptfigur des ersten Bandes wieder. Sein Auftritt dauert allerdings nur wenige Kapitel - leider, denn mit seiner dramaturgischen Nachfolgerin Paolina Barthes bin ich ehrlich gesagt nie richtig warm geworden.
There and back again
Ob mit dem U-Boot, Schiff, Luftschiff oder per magischer Kraft, ob einzeln oder in schließlich immer größer werdenden Gruppen, die ProtagonistInnen kroichen und floichen über den ganzen Globus. Zwischendurch lockert immer wieder mal ein - in der Regel bedeutungslos bleibendes - Gefecht den Reisemodus auf, der nun mal nicht der spannendste aller Modi ist. Und weil man wie schon in Band 2 bisweilen unverrichteter Dinge kurz vor einem lange angesteuerten Ziel wieder umkehrt, stellt sich beim Lesen allmählich doch ein leichtes Gefühl der Sinnlosigkeit ein.
Aber Achtung, es gibt einen Dreh: Man darf die äußeren Reisen nicht überbewerten, sondern muss sich auf die inneren konzentrieren. Denn die Persönlichkeitsentwicklung der Figuren hat eine deutlich klarere Linie. Boas etwa, der mechanische Messing, den einst ein Siegel König Salomos zum "Leben" erweckt hat, wurde durch seine Begegnung mit Paolina für immer verändert und nimmt im weiteren Verlauf immer menschlichere Züge an. Den Widerstreit seiner neuentdeckten Gefühle symbolisieren die Stimmen, die Boas in seinem Inneren hört. Die von menschlichen Freunden, die an seinen freien Willen appellieren, und die des Siegels, das Gehorsam verlangt. Was bei Letzterem übrigens in einen mühsamen Sermon, stets knapp am gerade relevanten Thema vorbei, mündet. Das liest sich auf Dauer wie ein Forentroll oder Iris Hanika.
Und Paolina ... tja, das kleine Mädchen mit dem großen technomagischen Talent will nur endlich seine Ruhe vor einer Welt voller machtgieriger Männer haben und flieht dafür sogar auf die Südhalbkugel. Paolina kommt aber nicht umhin, langsam die Rolle zu akzeptieren, die ihr ihre Gabe auferlegt, und sich ihrer Verantwortung zu stellen. Die einstmals graue Maus Childress hat dies - auf einer geringeren Ebene - bereits getan und wächst langsam, aber sicher in die Rolle einer Autoritätsperson hinein.
Die Hemisphären der Welt und die des Gehirns
"Die Räder der Zeit" arbeitet mit jeder Menge Dualitäten; Parallelen ebenso wie Gegensätzen. Etwa England vs. China oder Rationalismus (Norden) vs. Magie (Süden; ein bisschen klischeehaft, diese Zuweisung). Die wichtigsten Gegensätze - und das, worauf Jay Lake in seiner Trilogie letztlich hinauswill - sind die von Verstand vs. Glaube, Logik vs. Imagination und Determinismus vs. freier Wille. Sie alle werden am Schluss vereint, wenn erkannt wird, was die Goldene Brücke zwischen den Hemisphären wirklich bedeutet. Da muss man auch gar nicht erst massig hineininterpretieren, Paolinas Gedanken liefern den Schlüssel: "Alles ist eine Metapher".
Aus ebendiesem Grunde spielt das sorgfältig aufgebaute Worldbuilding letztlich auch keine Rolle mehr. Mehrfach fallen Andeutungen, die auf eine Erklärung der Konstruktionsweise hoffen lassen. Etwa wenn sich Paolina wundert, dass die Landmassen von Norden und Süden genau zueinander passen, als gäbe es die trennende Mauer dazwischen nicht. Wurde die also erst nachträglich draufgesetzt - und bedeutet das wiederum nicht, dass die Welt nach dem Schöpfungsakt nachjustiert wurde? Und warum hat der Schöpfergott seine Welt verlassen? Oder ist sie etwa aus sich selbst entstanden und einen Gott hat es nie gegeben? Aber Lake lässt weder Gott hinter dem Vorhang hervortreten noch stellt er klar, dass es keinen gibt.
Offene Fragen
Eine - natürlich religiös geprägte - Sonderauslegung des anthropischen Prinzips behauptet, dass unser Universum genau so geworden ist, wie es ist, damit wir entstehen können. Wenn sich dafür in unserer Welt der für den Laien oft schwer nachvollziehbaren physikalischen Kräfte schon solche Meinungen entwickeln können ... dann doch wohl erst recht in Lakes Welt, wo das kosmische Uhrwerk aus Planetenschienen und Zahnrädern als unübersehbarer Beweis für einen göttlichen Konstrukteur am Himmel steht. Und trotzdem ringen Lakes Figuren mit exakt denselben Zweifeln wie wir und versuchen die Rolle des Menschen im großen kosmischen Gefüge zu verstehen.
Da bietet sich als Resümee MRRs liebstes Brecht-Zitat an: "So sehen wir betroffen / Den Vorhang zu und alle Fragen offen." Das ist mir jetzt aber zu hehr und darum schließe ich lieber einen Tick prosaischer: Das Buch hätte mindestens um ein Drittel gekürzt werden sollen.
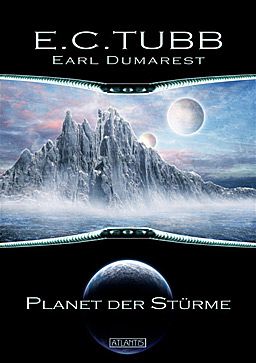
E. C. Tubb: "Earl Dumarest: Planet der Stürme"
Broschiert, 158 Seiten, € 10,30, Atlantis 2013 (Original: "The Winds of Gath", 1967)
Die dankenswerte Funktion von Kleinverlagen als Hüter der Genre-Historie hab ich ja schon mehrfach angesprochen. Eine Unterkategorie von Wiederveröffentlichungen - die noch dazu hoffentlich Geld in die Kassen spült - sind populäre Dauerläuferserien von anno dunnemals. Golkonda hat seinen Pulp-Helden "Captain Future" aus den 40ern, Wurdack die "Weltraumpartisanen" von Mark Brandis aus den 70ern (wer erinnert sich noch an Kindheitsabenteuer wie "Unternehmen Delphin" oder "Salomon 76"?). Und Atlantis, das zuvor schon Einzelromane des 2010 verstorbenen Edwin Charles Tubb veröffentlicht hatte (z.B. "Die Sterngeborenen"), hat mit der "Earl Dumarest"-Reihe den vielleicht dicksten Fisch an der Angel.
Ein Romanheld und seine Lebensaufgabe
Also Vorhang auf für den Titelhelden und seine - beinahe - ewige Suche nach der Erde, die sich in Realzeit von 1967 bis ins Jahr 2008 erstreckte und über 30 Romane umfasst. Earl Dumarest ist unverkennbar dem Zeitgeist der 60er Jahre entsprungen: Er ist ein sogenannter Reisender, ein galaktischer Globetrotter, der wie alle seiner Gleichgesinnten weitgehend mittellos und gezwungen zum Improvisieren einem Lebensstil anhängt, der von ortsgebundenen Menschen verachtet wird. Umgekehrt betrachtet Dumarest die Angehörigen planetarer Bevölkerungen mit Bedauern. Er sieht sie als in ihrer Welt eingesperrt an - egal, ob es sich nun um kleine Rädchen im Getriebe oder um mit Macht und Luxus ausgestattete Adelige handelt.
Ein brisanter Umstand ist, dass Dumarest behauptet, von der Erde zu stammen: Er will sie einst als blinder Passagier an Bord eines Raumschiffs verlassen haben, könne sie nun aber nicht mehr wiederfinden. Doch niemand glaubt ihm, denn die Erde wird in der gesamten von Menschen kolonisierten Galaxis für einen Mythos gehalten. Und es sieht ganz danach aus, als hätte jemand Interesse daran, dass es bei dieser Ansicht auch bleibt. Einem Vertreter der Organisation, die Dumarest über die Romanreihe hinweg immer wieder in die Quere kommen wird, begegnen wir bereits im ersten Band in Form des Cyber Dyne (warum kommt mir der Name nur so bekannt vor ...?).
Auf Abenteuer
Im Verlauf der Reihe wird Dumarest von Planet zu Planet trampen, Stück für Stück das Puzzle um seine "verschwundene" Heimatwelt lösen und dabei vor allem ein Abenteuer nach dem anderen erleben. Und zwar solche von der handfesten Art, denn als friedlichen Hippie sollte man sich Dumarest nicht vorstellen. Eher schon als die britische Entsprechung all der tatkräftigen Mannsbilder, mit denen Tubbs Zeitgenosse Philip José Farmer immer wieder seine Romane bevölkerte.
"Planet der Stürme" wartet unter anderem mit einem Arenakampf auf Leben und Tod, einer Floßfahrt mit Meeresbestien, einem Mordanschlag mittels Killerinsekt und einer Verfolgungsjagd unter dem Einfluss einer zeitbeschleunigenden Droge auf. Wichtigster Erlebnisfaktor ist aber die Hauptattraktion des Sturm-Planeten Gath: Ein ausgehöhltes Gebirge, das halluzinatorische "Musik" erzeugt, wenn die saisonalen Stürme durch die Ritzen und Löcher fegen. Die Psycho-Trips, auf die das von weither angereiste Publikum dadurch versetzt wird, werden die Handlung maßgeblich beeinflussen.
Natürlich braucht es auch einen Handlungsmotor. Dafür lässt Tubb Dumarest in den Machtkampf zweier Edel-Touristen von anderen Planeten geraten, eines gewalttätigen Fürsten und einer vernünftigeren, aber ebenfalls autokratischen Matriarchin. (Die Gesellschaftsstrukturen der "Dumarest"-Reihe erinnern übrigens fast ein wenig an "Dune": In dieser Zukunft lebt keine galaktische Informationsgesellschaft, hier prägen feudale Strukturen, Geheimbünde und eine missionierende Kirche das Bild.) Dumarest gerät da recht zufällig rein, und das ist es auch, was den Roman angenehm unvorhersagbar macht. Semi-Pulp zwar, aber ohne einen Handlungsverlauf, dessen Auflösung man schon von der ersten Seite an riechen kann. "Planet der Stürme" ist ein kleines, aber feines Leseabenteuer in menschlicher Länge.
The quest continues
Auf Deutsch ist die "Dumarest"-Reihe ab den späten 60ern erschienen und in den frühen 80ern wieder abgerissen. Und auch im Original begann das Leser-Interesse nach dem zigsten Band, in dem Dumarest die Erde nicht fand, allmählich etwas zu erlahmen. Als er sein Ziel schließlich doch noch erreichte, war dies nur mehr für Hardcore-Fans von Belang, die übrige SF-Welt kümmerte sich längst um andere Dinge.
Jetzt lässt sich das Ganze aber in beschleunigtem Takt nachholen. Unmittelbar nach "Planet der Stürme" will der Atlantis-Verlag als Zwischendurch-Zuckerl "Nectar of Heaven" aus dem Jahr 1981 herausbringen, 24. Band der Reihe und der erste, von dem es bislang noch keine deutsche Übersetzung gibt. Ende Sommer soll dann bereits der chronologisch zweite Band ("Derai") folgen. Wäre schön, wenn es sich trägt - es ist ein Stück SF-Geschichte.

James Corey: "Calibans Krieg"
Broschiert, 654 Seiten, € 15,50, Heyne 2013 (Original: "Caliban's War", 2012)
"Das ist wie ein schlechter Horrorfilm", dachte sie. "Die Heldin sieht das Monster, aber niemand glaubt ihr." Sie malte sich den zweiten Akt aus: Sie kam vor das Kriegsgericht, wurde bestraft und konnte sich erst im dritten Akt rehabilitieren, wenn das Monster wieder auftauchte und alle tötete, die nicht daran glaubten ...
Nehmen wir diese Prognose, die dem weiteren Handlungsverlauf recht nahe kommt, als Teaser für den zweiten Teil der "Expanse"-Reihe der US-Autoren Daniel Abraham und Ty Franck, die hier unter dem gemeinsamen Pseudonym "James Corey" auftreten. Alle, die sich davon angefixt fühlen, aber Teil 1 der Space Opera ("Leviathan erwacht") noch nicht gelesen haben, sollten das erst mal nachholen, bevor sie hier weiterlesen. Denn Teil 2 baut unmittelbar auf seinem Vorgänger auf: Last exit before spoilerland!
Und zum Ausgleich auch eine Warnung an alle diejenigen, die Teil 1 bereits kennen: Ja nicht zwischendurch auf die letzte Seite blättern und erst recht nicht vorab den letzten Satz lesen! "Calibans Krieg" endet mit einem Doppelschlag: Nämlich einem räumlich gewaltigen, aber inhaltlich kleinen Cliffhanger - aber dazu noch einem Knalleffekt, bei dem die Verhältnisse genau umgekehrt sind ...
Die Hauptfiguren
Die eingangs zitierte Prognose stammt von Sergeant Roberta "Bobbie" Draper aus dem Marsianischen Marinecorps; einer sympathischen Riesin, die das Pech hat, den Debütauftritt jenes Monsters mitzuerleben, das später das halbe Sonnensystem in Atem halten wird. Wegen undiplomatischen Auftretens auf einem diplomatischen Meeting wird sie von ihren Vorgesetzten de facto auf der Erde ausgesetzt. Findet dort aber rasch eine neue Mentorin in Form von Chrisjen Avasarala, einer Untergeneralsekretärin der UNO. Avasarala ist ein Drachen mit dem Herz am rechten Fleck - stellen wir uns die Dowager aus "Downton Abbey" mit jeder Menge Machtbefugnissen vor (und im Sari). Avasarala versucht mit allen Mitteln den bevorstehenden Krieg zwischen Erde und Mars, der von einer unbekannten Schattenmacht geschürt wird, zu verhindern. Marsianerin Bobbie muss sich entscheiden, wem ihre Loyalität gilt: Ihrer Heimat oder der Frau, die formal ihr Feind ist.
Bereits aus dem Vorgängerband kennen wir Raumschiffkapitän Jim Holden, der mittlerweile im Auftrag der Allianz der Äußeren Planeten (der dritten Macht im Sonnensystem) Jagd auf Piraten macht. Die Ereignisse in "Leviathan erwacht" haben ihn traumatisiert, auch wenn er selbst das noch nicht begriffen hat. Kühl und gewaltbereit ist der einstige Idealist geworden - seine Multikulti-Crew erkennt ihn manchmal kaum noch wieder.
Und dann wäre da noch Praxidike "Prax" Meng, ein braver Botaniker vom Jupitermond Ganymed, der sich niemals hätte vorstellen können, Mitglied einer "Mission Impossible" zu werden. Tatsächlich wird er über den ganzen Roman hinweg seine erfrischend schrullige Perspektive auf die geballte Action beibehalten. Er mag weltfremd und viel zu schwach für die anstehenden Herausforderungen wirken - aber einmal aus seinem akademischen Schrebergarten gerissen, wird er über sich selbst hinauswachsen. Holden zollt ihm im Stillen tiefen Respekt: Und wenn das Universum ihn noch so oft umwarf, solange er noch nicht tot war, würde er sich wieder aufrappeln und weiter seinem Ziel entgegenschlurfen. Alle vier Hauptpersonen kann man unter einem einfachen Motto subsumieren: Die guten Kräfte sammeln sich.
Das Szenario
Wie schon in Band 1 setzt auch hier ein Kriminalfall die Handlung in Gang, der sich bald als unmittelbar mit dem großen Kriegsszenario verbunden erweist. Diesmal geht es um die Entführung von Prax' kleiner Tochter Mei, unmittelbar bevor auf Ganymed die Hölle losbricht. Erneut scheint sich das sogenannte Protomolekül, die Hinterlassenschaft einer außerirdischen Zivilisation, auszubreiten. In "Leviathan erwacht" wandelte es die gesamte menschliche Bevölkerung eines Asteroiden in eine amorphe Masse um - nun stößt es offenbar individuelle Ableger aus, die ganze Armeen im Alleingang auslöschen.
Sehr interessant, nebenbei bemerkt, wie Abraham und Franck diesen Plot-Faden weiterspinnen. Die chaotischen Ereignisse auf Ganymed lösen einen lokalen Konflikt zwischen irdischen und marsianischen Truppen aus, der auf dem Jupitermond schwere Verwüstungen anrichtet. Bald endet der unmittelbare Schlagabtausch wieder - nun sollte dieser Sub-Plot einem positiven Ende zugeführt sein, möchte man meinen. Und in den meisten anderen Romanen wäre dies wohl auch der Fall. Doch hier haben die Autoren andere Vorstellungen: Der Initialschaden am fragilen Habitat hat eine Reaktionskaskade ausgelöst, die sich trotz aller Anstrengungen und eintreffender Hilfslieferungen nicht mehr stoppen lässt. Ganymed steuert langsam, aber unaufhaltsam dem Untergang entgegen.
Und dann wäre da ja noch jenes außerirdische Mega-Artefakt, das all dies überhaupt erst ausgelöst hat. Das sollte am Ende von "Leviathan erwacht" auf die Erde stürzen, konnte aber im letzten Moment noch auf die Venus umgelenkt werden. Wo es offenbar höchst aktiv ist: Im ganzen Sonnensystem wirft man bange Seitenblicke auf die Venus, deren Oberflächenstrukturen umgekrempelt werden, deren Schwerkraft sich ändert und die immer wieder zum Ausgangspunkt mysteriöser Energieausstöße wird. Klar, dass sich hier das eigentlich Wesentliche zusammenbraut. Doch leider sind alle noch viel zu sehr mit dem schwelenden Konflikt zwischen Erde und Mars beschäftigt, um sich darauf konzentrieren zu können. Natürlich wird die Venus einen der beiden Cliffhanger am Romanende liefern ...
Bewertung
Im Klappentext steht "Mit seiner international erfolgreichen Space Opera sprengt James Corey alle Maßstäbe der Science Fiction". Über solche Formulierungen könnte ich mich vor Lachen immer kringeln, denn natürlich tut der nicht existierende James Corey nichts dergleichen, sondern bewegt sich strikt innerhalb eines wohldefinierten Rahmens, den Autoren wie Paul McAuley oder Wil McCarthy längst vorgegeben haben. Aber das ist ja schließlich auch keine Schande.
Bei einem Roman von so beträchtlicher Länge - und er ist ja nicht mal in sich abgeschlossen - springt bei mir automatisch der Reflex "Könnte/sollte man zumindest um ein Viertel kürzen" an. Andererseits wüsste ich nicht so recht, wo ich den Rotstift angesetzt hätte. Da war wenig dabei, was ich hätte missen wollen. "Calibans Krieg" ist spannend, unterhaltsam, erschreckend, wo es erschreckend sein muss, und witzig, wo es witzig sein darf. Insgesamt also eine runde Sache.
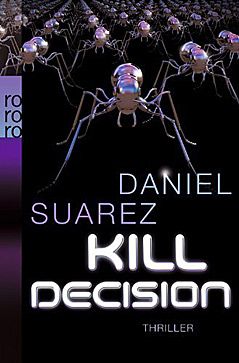
Daniel Suarez: "Kill Decision"
Broschiert, 496 Seiten, € 13,40, rororo 2013 (Original: "Kill Decision", 2012)
Mit seinem KI-Roman "Daemon", der zunächst nur im Eigenverlag erschienen war, hatte der US-Amerikaner Daniel Suarez 2006 einen Überraschungserfolg gelandet, der dann von einem Imprint der Penguin-Gruppe übernommen wurde. Danach brauchte Suarez für die Fortsetzung "Freedom™" (deutsch: "Darknet") keine Umwege mehr zu gehen. Auch sein drittes Werk, "Kill Decision", ist bei demselben Verleger herausgekommen und zügig ins Deutsche übersetzt worden. "Kill Decision" ist keine weitere Fortsetzung, hat aber einen ähnlichen zeitlichen Hintergrund: Näher an der Gegenwart als an einer Zukunft, die eindeutig das Label "Science Fiction" tragen müsste. Und auch seinem Leib- und Magenthema ist Software-Entwickler Suarez treu geblieben.
Halb zog er sie, halb sank sie hin
Tief in den Dschungeln Afrikas erforscht die Biologin Linda McKinney das Schwarmverhalten von Weberameisen. Nicht nur geografisch weit entfernt von der Serie an Terroranschlägen, die die USA in Atem halten, hätte sie sich nie ausmalen können, dass just ihr Forschungsgebiet in den Fokus von Politik, Geheimdienstumtrieben und einer großmaßstäblichen Verschwörung geraten könnte. Dass sie selbst einem Anschlag entgeht, hat sie einem Mann zu verdanken, der sie kurzerhand aus ihrem Camp entführt: "Odin" nennt er sich und führt - ebenso passend wie kinky - zwei Raben namens Hugin und Munin mit sich, die Draht-Headsets tragen.
Odin arbeitet irgendwie für die US-Regierung und ist ein gänzlich undurchschaubarer Held: Kompromisslos, aber auch ein waschechter demokratischer Idealist - eine Art Jimmy Stewart mit der Lizenz zum Töten. Odin schanghait Linda für sein buntes Einsatzkommando an SpezialistInnen, um sich jenen unsichtbaren Kräften, die die Welt in einen bewaffneten Konflikt treiben wollen, entgegenzustemmen. Gar so schnell funktioniert Teambuilding aber nicht: In einer zumindest von der Idee her realistischen Wendung büxt Linda bei erster Gelegenheit aus ... natürlich nur, um bald danach wieder zu ihren mysteriösen MitstreiterInnen zurückzukehren. Sonst bliebe ja auch die für Verschwörungsthriller offenbar unabdingbare Mann-Frau-Chemie auf der Strecke.
Dräuende Drohnen
"Kill Decision" positioniert sich eindeutig in dem Literatursegment, das den inoffiziellen Titel "Michael Crichton" trägt; insbesondere an den Crichton-Roman "Prey" fühlt man sich mehrfach erinnert. Während es dort aber um Schwärme tödlicher Nanomaschinen ging, siedelt Suarez seinen Roman ein paar Größenordnungen darüber an: nämlich bei bewaffneten Drohnen. Genauer gesagt: autonomen bewaffneten Drohnen - also solchen, die selbstständig Entscheidungen über Leben und Tod fällen können. Suarez liefert damit gleichsam den Roman zu einem sehr realen, wenn auch noch kaum beachteten Thema: Die vor kurzem ins Leben gerufene Initiative "Campaign to Stop Killer Robots" versucht eine Konvention gegen die Entwicklung ebensolcher autonomer Waffen zu erreichen (mehr dazu hier).
Aktueller kann man mit einem Roman also kaum sein. Wieder einmal zeigt Science Fiction eine ihrer Grundeigenschaften, nämlich die der Extrapolation. Verbunden - zumindest in diesem Falle - mit Exploitation. Unter den wüsten Action-Highlights, mit denen der Roman aufwartet, befinden sich unter anderem ein Luftkampf zwischen einer Drohne und einem Fallschirmspringer mit MP, die Belagerung eines Hauses durch einen Schwarm wie in Hitchcocks "Die Vögel" und ein wenig glaubwürdiger Showdown á la "Terminator 3" auf hoher See. Langweilig wird's jedenfalls nicht.
Alles logo?
Die Logik bleibt da manchmal auf der Strecke. Warum Linda überhaupt getötet werden sollte, habe ich nicht so ganz verstanden (außer natürlich, dass der Autor sie irgendwie mit Odin zusammenbringen musste). Eigentlich war Linda ja - anders als einige Leidensgenossen drüben in den USA - den Verschwörern, die ihre Forschungsergebnisse abgezapft hatten, gar nicht in die Quere gekommen. Aber bevor man dazu nähere Überlegungen anstellen kann, ist man eh schon wieder mit anderem beschäftigt; Suarez drückt aufs Tempo.
Zudem wirkt so mancher Drohnen-Einsatz, als wollte man mit einer Rube-Goldberg-Maschine einen Nagel in die Wand schlagen. All das komplizierte autonome Geschwärme, mit Pheromonkontrolle und was nicht allem! Das eine oder andere Mal wären die Verschwörer wirklich besser beraten gewesen, wenn sie stattdessen ein paar gute alte Auftragskiller vorbeigeschickt hätten. Aber gut, man soll den Bösen ja auch keine Tipps geben ...
Willkommen im Heute
Gruseliger als jede Schwarmattacke sind die zynischen Kommentare von PR-Experten zu den Fernsehbildern eines Massakers an irakischen Pilgern: "Das versendet sich." Oder: "Das könnte sehr schlecht für die Marke Amerika sein." Ebenso ungemütlich die Streiflichter, die Suarez auf das Big-Brother-Arsenal unserer Tage wirft. Etwa wenn es um die Analyse von Bewegungsmustern ganzer Städte oder das Manipulieren der öffentlichen Meinung (Stichwort: Astroturfing in sozialen Netzwerken) geht.
Auf seine reißerische Art lebt "Kill Decision" von dem allgemeinen Misstrauen gegenüber öffentlichen Institutionen, das seit dem Zeitalter von "Akte X" zu einem fixen Bestandteil der Populärkultur geworden ist. Aber was wäre seitdem auch schon passiert, um dieses Misstrauen zu mindern?
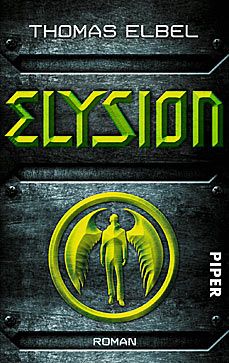
Thomas Elbel: "Elysion"
Broschiert, 480 Seiten, € 10,30, Piper 2013
Ich liebe bekanntlich Klappentexte, und der hier liefert sich einen faszinierenden Paarlauf der Kontraste mit dem sympathisch bescheidenen Nachwort des Autors. Heißt es bezüglich Thomas Elbels Debütroman "Asylon" vorne "gewann zahlreiche Preise", wird hinten nur der Leserpreis der Website "Lovelybooks" genannt (Zusatz: "weitere Preise gibt es nicht"). Und während der Klappentext jubelt: "'Asylon' begeisterte Presse und Leser", zieht der Autor aus Deutschland so Bilanz: "die Rezensionen sind überwiegend freundlich". Also, dieses Zusammenspiel verdient seinerseits einen Preis!
... aber genug davon und ab in die Handlung von "Elysion", das zwar erneut eine Dystopie, aber trotz gewollter Titel-Ähnlichkeit keine Fortsetzung von "Asylon" ist.
Die Ausgangslage
Da auch der Roman selbst im ersten Kapitel sehr viel Einführungstext zur allgemeinen Lage enthält, beginnen wir mit einem Infodump: Jahre, nachdem ein Bürgerkrieg Nordamerika verheert hat (vom Rest der Welt erfahren wir nichts), leben die übriggebliebenen Menschen entweder als plündernde Banden in den Ruinen der Städte oder in einem Waldreich namens Elysion. Nach dem Krieg haben sich nämlich in Rekordzeit dschungelartige Wälder zwischen den Städten ausgebreitet - erst am Ende des Romans wird angedeutet, wie dies zustandegekommen sein kann.
Zeitgleich betraten damals die Malachim die Szene, die mit übermenschlichen Kräften ausgestattet sind, wie schon ihr biblischer Name erahnen lässt. Rein optisch wirken sie, als hätte jemand einer "Körperwelten"-Ausstellung Beine gemacht - keine ätherisch schönen Engel also. Und sie sind auch brandgefährlich.
Die Hauptfiguren
Das hält die junge Cooper Kleinschmidt aber nicht davon ab, im Auftrag eines Bandenchefs Jagd auf die Malachim zu machen. Nicht im Sinne eines Widerstandskampfs, sondern weil sich aus deren sterblichen Überresten eine Droge gewinnen lässt, die einem kurzfristig die Kräfte der "Engel" verleiht (vor allem feste Materie durchdringen zu können). Der Plot verlangt's, dass nur Teenager Jagderfolg haben, also ist Cooper mit ihren Freunden Brent (Marke schön-und-weiß-das-auch) und Stacy unterwegs. Die Konfliktlinien innerhalb dieses Trios beginnen sich früh abzuzeichnen.
Mit Jimmy Larson kommt später ein weiterer Jugendlicher dazu: Ein Bewohner einer Waldsiedlung, der nach einem harmlosen Akt der Subversion zum Tode verurteilt wird, aber flüchten kann. Im Nachwort schreibt Thomas Elbel, dass er für "Elysion" eine neue Herangehensweise ausprobiert habe. Nämlich nicht von einem durchgeplanten Konzept auszugehen, sondern die Handlung eher aus den Impulsen der Hauptfiguren heraus weiterzuentwickeln. Das führt zu einer gewissen Unvorhersagbarkeit, und die zeigt sich auch darin, dass mehrfach kurz auf Nebenfiguren geschwenkt wird, von denen dann z.B. Jimmy fast zufällig wirkend als weitere Hauptfigur hängen bleibt.
Lücken im Gewebe
Nicht alle Folgen des freien Schreibens sind so positiv, manchmal hat zumindest mir ein Plan gefehlt. Die quasi-familiären Zusammenhänge zwischen den Hauptfiguren wittert man sehr schnell, für eine Klimax taugen die also nicht. Und das große Rätsel um die Malachim scheint dies ebenfalls nicht herzugeben, denn ihre Herkunft wird früh erklärt. Dazu folgt später zwar ein Twist - leider ein ziemlich an den Haaren herbeigezogener -, aber von dem ahnt man ja die längste Zeit nichts. Und fragt sich daher, worauf der Roman letztlich hinauslaufen soll. (Unter anderem übrigens auf einen Sequel-Verheißer ganz im Stil der letzten Einstellung eines Horror-Films.)
Und Löcher klaffen auch so einige im Stoff. Etwa 100.000 Menschen sollen verstreut in den Wäldern leben. Nachdem die an Lothlorien erinnernde Hauptsiedlung recht klein ist, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, mit welcher Logistik der dort residierende "Pontifex" (eigentlich ein wahrer Mad Scientist) dieses ganze Netzwerk zusammenhält. Und natürlich bleibt da noch die Frage nach dem Rest der Welt: War der vom US-Bürgerkrieg auch betroffen? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum kommt dann keiner nachsehen?
Anführer sind auch nur Menschen
Positiv fällt Elbels Konzept von Anführern auf, weil es nicht in gängige Stereotypen verfällt. Allesamt sind sich die Leaderfiguren des Romans dessen bewusst, wie leicht ihre Macht bröckeln kann. Big Mama, Coopers selbsternannte Adoptivmutter, hat ihre bereits verloren. Bandenchef McCann, in dessen Auftrag Cooper unterwegs ist, mag unüberwindlich erscheinen, sieht sich aber dazu genötigt, der Stimmung seiner Männer Zugeständnisse zu machen. Der Pontifex spielt seine Rolle, obwohl er von Selbstzweifeln geplagt wird, weil seine Ideale und sein Handeln längst nicht mehr im Einklang miteinander stehen. Und selbst der junge Jimmy macht bald seine Erfahrungen damit, wie schwer es ist, ein Anführer zu sein. - Das liest man in dieser Durchgängigkeit selten, zumindest nicht in Romanen mit pulp-artigem Szenario. Es reicht aber noch nicht, um "Elysion" zu etwas Besonderem zu machen.
Ein Roman, der Plots wie in "Elysion" und vergleichbaren YA-Dystopien parodiert und dennoch mit neuem Tiefgang versieht, wird später in dieser Rundschau noch folgen.
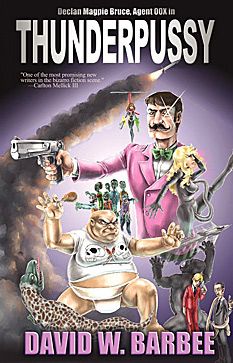
David W. Barbee: "Thunderpussy"
Broschiert, 117 Seiten, Eraserhead Press 2013
Die "Shatnerquest"-Bestellung war die Gelegenheit, mal wieder nachzuschauen, was sich in Bizarro-Land gerade so tut. Mit dem Output dieser im US-amerikanischen Nordwesten konzentrierten Subkultur kann ja leider niemand mithalten, der nebenbei auch noch was anderes liest. Zwei aktuelle Titel aus dem proppevollen Verlagsprogramm von Eraserhead habe ich mir herausgepickt, die die inhaltliche Bandbreite von Bizarro ganz gut demonstrieren: Das eine absurd-vergnügliche Unterhaltung ohne weiteren Mehrwert, das andere etwas, das ebenfalls auf Spaßfaktor zu setzen scheint, dann aber schnurstracks auf Verstörung zusteuert.
Erst mal die leichtere Kost, serviert von David W. Barbee, von dem ich bislang nur die Cthulhu-in-den-Suburbs-Erzählung "Grumpy Old Gods" in der Anthologie "Amazing Stories of the Flying Spaghetti Monster" kannte; eine eher harmlose Angelegenheit. "Thunderpussy" ist unverkennbar eine James-Bond-Parodie; sehr schönes Wortspiel, finde ich. Anders als es das Titel-Mashup vermuten lassen könnte, enthält Barbees Novelle aber kaum weiteres Namedropping oder Anspielungen auf konkrete Bond-Filme. Stattdessen ist es als parodistisches Substrat der typischen Bond-Motive und -Plotabläufe angelegt.
Die Ingredienzien einer Bond-Story
Da wäre zunächst mal der Supergangster mit Plan zur Eroberung der Weltherrschaft. Hier im wahrsten Sinne des Wortes verkörpert von Oberon Tubbs, dem Chef eines Hightech-Konzerns, der doch ein wenig an Auric Goldfinger denken lässt. Seine Statur wird übrigens durch die rare genetische Disposition des gigantic dwarfism erklärt, kurz: Er sieht aus wie ein Baby im Sumoringer-Format. Natürlich hat er auch ein verborgenes Hauptquartier und eine Privatarmee von Redshirts.
Gegen ihn hat nun unser britischer Held Declan Magpie Bruce, Agent 00X of Ze State, anzutreten. Nach einer globalen Schnitzeljagd, versteht sich (nächstes unabdingbares Element), und unterstützt von diversen Gadgets wie einem wandelbaren Wunderanzug. Generell tummeln sich diverse SF-Elemente im Geschehen, unter anderem Roboter und ein transkontinentales Netz unterirdischer Tunnel. Ze State übrigens, die Organisation, für die Declan in den Kampf zieht, ist ein internationales Spionagenetzwerk, an dessen Spitze ein paar ausgemusterte Hollywood-Androiden stehen. Die haben sich einfach einen neuen Beruf gesucht, lenken jetzt im Geheimen die Geschicke des Planeten und sind keineswegs erbaut davon, dass Tubbs die Roboter dieser Welt durch dienstbare Zombies ersetzen will. Und das ist nur ein Teil seines Masterplans, der zu allem Überfluss auch noch eine feministische Komponente enthält ...
Womanizing bis zum Abwinken
Selbstverständlich gibt es auch Bond-Girls mit sprechenden Namen wie Psyche Delia, Thunderpussy und Petite LaVulva - letztere setzt ihre messerscharfen Federboas ein wie Doc Ock. Für welche Seite sie kämpfen, lässt sich nicht immer so genau sagen. Vertrauen wir aber den fabelhaften Womanizer-Qualitäten unseres schnauzbärtigen Helden, dass er sie schon von der guten Sache überzeugen wird.
Denn wo Declan Bruce auftaucht, schmilzt weibliche Widerstandskraft dahin wie Butter in der Sonne. Hier eine Szene, die sich in einer Flugzeugtoilette zwischen Bruce und einer Stewardess abspielt: "I love you, Declan Bruce," she whispered. "I'll do anything for you. Let me cook all your meals while you make me pregnant every day." - "Come off it, you slag," said 00X with a smile, standing with both feet in the toilet. He pulled the cord and was sucked down through the jet's plumbing. The suction pushed Bruce to the tail of the jet where he was ejected into the sky. Das ist mal ein Abgang!
Nonstop Nonsense
Dazu kommt dann noch so allerhand Anderes, zum Teil wird dies ja bereits am Titelbild angekündigt. Man sieht's in der Größe nicht so gut, aber was der Typ da rechts unten um den Körper geschlungen hat, ist ein sehr, sehr langer Penis. Und ja, sein Killer-Kollege daneben ist ein Siamesisches Zwillingspaar, das zur Hälfte aus einem Gorilla besteht. Alles vollkommen sinnfrei, aber erstens ist dies hier eben Bizarro, und zweitens: Who cares?
Als Genre-Parodie ist "Thunderpussy" eine Art "Nackte Kanone" mit deutlich großzügigeren Vorgaben in Sachen Realismus. Nicht mehr als netter Nonsense, aber die richtige Muntermacherpille, wenn man sich gerade mal wieder durch irgendeinen Trilogie-Vierpfünder gearbeitet hat.
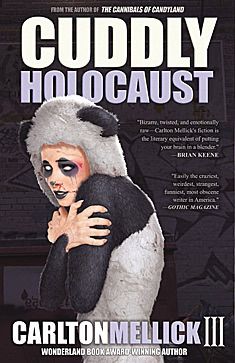
Carlton Mellick III: "Cuddly Holocaust"
Broschiert, 152 Seiten, Eraserhead Press 2013
Unmittelbar nach der Lektüre von "Thunderpussy" habe ich mir dieses Buch gegönnt und war gespannt, ob sich die Erwartung bewahrheiten würde, dass es nun deutlich intensiver wird. Immerhin nutzt Carlton Mellick III die Freiheiten von Bizarro - das er als Genre mehr oder weniger selbst erfunden hat -, um seine Geschichten superknallig aufzumachen ... versieht sie dann aber mit zusätzlichen Ebenen, die seine KollegInnen oft vermissen lassen. Die paar Werke aus Mellicks Mega-Œuvre, die hier bislang rezensiert wurden, legen da ein gutes Zeugnis ab ("The Cannibals of Candyland", "Teeth and Tongue Landscape", "Sunset With A Beard" und "Ultra Fuckers").
Die Plüsch-Apokalypse
Und Mellick enttäuscht nicht. Auch "Cuddly Holocaust" ist im Grunde eine Genre-Parodie - in diesem Falle geht es Nach-der-Apokalypse-Erzählungen und deren Mechanismen an den Kragen. Wir befinden uns einige Jahre nach dem Untergang unserer Zivilisation; die letzten Menschen verbergen sich in unterirdischen Bunkern. Wie die junge Julie, die ihre Eltern wiederfinden möchte und sich dafür in einer Reihe kosmetischer Eingriffe zum Plüsch-Panda umoperieren lässt.
Denn der Feind, den es zu infiltrieren gilt, sind sprechende Teddys, purpurne Plüschhasen, Glücksbärchis und sogar eine Stoff-Sonnenblume. Draußen zwischen den Ruinen kommen dann noch winzige Spielzeugsoldaten und riesige Transformers dazu. Kurz: Die smart-toys - ausgerüstet mit KI-Chips, die sie doch eigentlich nur zu besseren Spielgefährten machen sollten - haben die Welt erobert. Blendet man die grelle Optik mal aus, ist die Parodie hier genau genommen gar nicht so weit von tendenziell ernstgemeinten Apokalypse-Szenarien entfernt; siehe etwa Daniel Wilsons "Robocalypse".
Wenn schon, dann sorgt das absurde Aussehen der mörderischen Spielzeugfiguren eher für eine Art Pennywise-Effekt. Und Mellick hat das Ganze in todernstem Tonfall geschrieben. Zudem ist alles da, was so eine Geschichte ausmacht: Die Search-and-Rescue-Mission, Rachegelüste und allerblutigste Action. Plus wehmütige Erinnerungen an die Zeit, als alles noch so idyllisch war (und Julie einen Teddybären geschenkt bekam, der Nachbarskinder mit Sätzen wie "Why don't you come closer and say that to my face, punk? I'll rip your dick off and shove it up your ass!" anflegelte).
Schläge in die Magengrube als Mehrwert
Das alleine würde aber noch keinen Mellick ausmachen, dafür braucht es mehr. Und das kommt auch. Es wird in der Folge um Dinge wie das Verdrängen der Vergangenheit, den Verrat an den eigenen Idealen und das Arrangieren mit dem Feind gehen - auf kollektiver wie auch auf individueller Ebene. Gegen Ende hin wird das langsam immer ungemütlicher, zudem kombiniert es Mellick mit einer Art von "Familienzusammenführung", die auf so viele verschiedene Arten schauderhaft ist, dass man sich beim Lesen nur so krümmt.
Nicht umsonst hat Mellick im Vorwort geschrieben: It ended up being one of the most disturbing books I've ever written, especially toward the end. Der eigentlichen Erzählung ist dann ein niedlicher Krakel-Cartoon angefügt, in dem Mellick etwaige Vorwürfe, was zum Teufel er sich denn dabei gedacht habe, vorwegnimmt (und mit leisem Lächeln abschüttelt).
Preiset den Mellick
So langsam werden die Blurbs auf den Umschlägen der Bücher Carlton Mellicks III prominenter. Außerhalb seiner Szene haben ihn als erste Horror-Autoren wie Brian Keene oder Jack Ketchum entdeckt, mitterweile findet sich da auch bereits ein Cory Doctorow darunter. Und sogar vom "Guardian" hat Mellick bereits Beachtung gefunden.
Ich kann das nur unterschreiben. Ich komme mehr und mehr zu der Überzeugung, dass Carlton Mellick III einer der wichtigsten Phantastik-Autoren unserer Tage ist. Und ich lehne mich sogar noch weiter aus dem Fenster: Er wird einmal so kanonisch sein wie heute Philip K. Dick und James Tiptree Jr.

China Miéville & Mateus Santolouco: "Dial H. Volume 1: Into You"
Graphic Novel, broschiert, 168 Seiten, DC Comics 2013
Ungefähr um diese Zeit im Jahr steht normalerweise der neue Roman von China Miéville ins Haus. Auf Deutsch der, der ein Jahr zuvor im Original veröffentlicht wurde und in aller Regel jetzt auf diversen Literaturpreis-Shortlists stünde. Und auf Englisch schon der nächste. Heuer gibt's da einen Knick. Vom bislang letzten Roman "Railsea" (2012) ist seltsamerweise immer noch keine Übersetzung in Sicht - und das, obwohl es vermutlich der am leichtesten verständliche Miéville-Roman seit langem ist. Dass aber auch englischsprachige LeserInnen vorerst in der Warteschleife hängen, liegt an Miévilles neuem Comic-Engagement. Es ist nicht das allererste Mal, dass der Brite eine Story für ein Comic geschrieben hat, aber das erste Mal, dass er gleich eine ganze Serie produziert.
Dial: R for Relaunch
Und da hat sich der notorische Freigeist auf was eingelassen. Denn viel stärker kann man gar nicht in einen vorgegebenen Rahmen eingebunden sein, als wenn man einen Teil zum unüberschaubar gigantischen Universum des Superheldencomic-Verlags DC, Heimat von Superman und Batman, beitragen soll. Nur ganz kurz zur Orientierung: Unter dem Emblem "The New 52" hat DC vor zwei Jahren wieder mal einen Relaunch durchgeführt und seine diversen altgedienten Superhelden-Serien in ein neues, hoffentlich stimmiges Gesamtschema gepresst.
Das knirscht jetzt schon an allen Ecken und Enden, aber so ist das eben, wenn so viele verschiedene AutorInnen über Jahrzehnte hinweg mit denselben Figuren herumspielen. Auf Widersprüche folgen Kontinuitätsbrüche und Relaunches (Stichwort "Crisis on Infinite Earths"), darauf neue Widersprüche, 180-Grad-Volten ... und letztlich ist nach der "Vereinfachung" alles noch komplizierter als vorher. Näher darf man sich damit gar nicht auseinandersetzen, sonst wird man komplett narrisch. Wenn Disney demnächst seine Version von "Star Wars" vorlegt, ist ein ähnlicher Effekt zu erwarten: Bin mal gespannt, wie nahtlos die ihre Produktionen in den nicht minder ausgetüftelten Kanon der Wookieepedia einfügen werden.
Das Ding
"Dial H" basiert auf dem 60er-Jahre-Comic "Dial H for Hero", das später noch zwei kurzlebige Neuversionen erlebte und stets ein wenig im Abseits stand. Was für Miéville ein ungleich größeres Maß an schöpferischer Freiheit bedeutete, als wenn er sich Batmans angenommen hätte - und er hat diese Freiheit genutzt. "Dial H" hat sich in der seit 2012 laufenden Ausgabe rasch den Ruf erworben, exzeptionell bizarr zu sein (zumindest für DC-Verhältnisse). Der Meister des New Weird wird seinem Ruf also wieder mal gerecht.
In Littleville, einer Stadt im Niedergang, lebt der Slacker Nelson Jent: arbeitslos, allein, verwahrlost und verfettet. Bis sein bester Kumpel von einer Gang zusammengeschlagen wird, Nelson ohne Handy dasteht und in einer der letzten Telefonzellen Hilfe rufen will. Womit wir auch schon beim Grundkonzept der ganzen Serie angekommen wären: Wer auf dieser ganz speziellen Wählscheibe H wie Held eingibt, wird flugs selbst in einen verwandelt. Leider nur kurzfristig und anscheinend ganz nach dem Zufallsprinzip, in welchen ... aber alle, die im Repertoire stehen, haben es in sich.
Die bizarrsten Superhelden und -schurken aller Zeiten
China Miéville hat "Dial H" als celebration of the superherogenerative drive bezeichnet. Als bekennender Fan der Original-Serie frönt er ungehemmt der kindlichen Lust, sich ständig neue und möglichst originelle Superhelden auszudenken. Boy Chimney ist eine dämonische Vogelscheuche mit Zylinderhut, aus dem erstickender Rauch strömt, Cock-a-Hoop eine lächerliche (aber effektive) Mischung aus Kampfhahn und Hula-Reifen, Ctrl+Alt+Delete anthropomorpher Elektrosmog mit einem Computerbildschirm als Kopf - der Fantasie wurden hier keinerlei Grenzen gesetzt. Weiters wurden im Getümmel unter anderem eine Superheldin mit Badezimmerarmaturen am Körper und eine Schurkin, die wie ein menschliches Schweizermesser aussieht, gesichtet. Ein paar Impressionen dazu finden sich hier (und jede Menge weitere auf Tumblr). Surrealismus und hohes Tempo knallen aufeinander: Zeichner Mateus Santolouco hatte alle Hände voll zu tun, der überbordenden Fantasie seines Autorenpartners gerecht zu werden.
Miévilles fulminanter Umgang mit Sprache, der seine Romane kennzeichnet, kommt im Comic-Format nur sehr eingeschränkt zur Geltung. (Immerhin gibt es hübsche Wortspiele: zum Beispiel eine blitzeverschleudernde Kämpferin mit Schmollmund namens ElectroCutie.) Dafür dürfen wir eine seiner bizarren Fantasiewelten endlich einmal wirklich sehen. Und Vieles daran wird Miéville-LeserInnen vertraut erscheinen: Mensch-Maschine-Verschmelzungen, anachronistische Stil-Mixturen oder abstrakte Konzepte, die körperliche Gestalt annehmen. Einmal etwa gilt es gegen Abyss in den Kampf zu ziehen, das denkende und handelnde Nichts, dem nur andere Nichtse gefährlich werden können: Some people on my world think the whole of our universe is just the effluent of nihils' predation on each other ... that we live in the crumbling coprolite of nul-eat-nul. Das ist Miéville pur.
Bekanntes und Vermisstes
"Dial H" trägt teilweise parodistische Züge; am deutlichsten werden diese in Teil 6, der sich auch optisch abhebt: Während Santolouco auf giftfarbene Düsternis setzt, führt uns Gastzeichner David Lapham optisch ins Silver Age zurück (siehe hier). In dieser Episode ist Nelson dazu gezwungen, daheim zu bleiben, weil ihn die Wählscheibe zum politisch inkorrekten Abziehbild eines Klischee-Indianerhäuptlings gemacht hat. So kannst du heute nicht mehr auf die Straße gehen, da helfen alle Superkräfte nichts. Hilflos muss Nelson seine Zeit vor dem Fernseher absitzen ... und mitansehen, wie sein mit der Verwandlung mitgeliefertes Flügelross im Alleingang eine Geiselnahme beendet, indem es die Verbrecher im wahrsten Sinne des Wortes zuscheißt. Das ist schwer zu überbieten - für mich das absolute Highlight des Bands.
Miéville agiert also durchaus subversiv, ganz wie man es von ihm gewohnt ist. Aber nur in Bezug auf die Mechanismen des Genres. Politische Subversion - eigentlich einer der wichtigsten Grundzüge in Miévilles Schaffen - sucht man hier leider vergeblich; vermutlich ist DC dafür auch nicht die geeignetste Umgebung. Stattdessen dreht sich alles um Themen wie Identität und Selbstfindung - schön auf den Punkt gebracht in einer Sequenz, in der Nelson kein neues Alter Ego anwählen konnte und sich kurzerhand mit einer schlechten Entschuldigung von Kostüm und dem Mut zur Tat in den Einsatz begibt, ganz er selbst. Allerdings sind Identitätskrisen auch genau das Thema, das Superhelden-Comics ohnehin seit Jahrzehnten abgrasen. Dem wird hier nichts wirklich Neues hinzugefügt, es sieht nur schriller aus.
Fortsetzung folgt
Ein paar Worte noch zur Ausgabe: Dieser Band ist keine abgeschlossene Erzählung, sondern die Zusammenfassung der ersten sieben Hefte der Serie (eine deutschsprachige Ausgabe des Sammelbands ist übrigens zeitgleich mit der amerikanischen bei Panini erschienen). Jedes Original-Heft endet(e) mit einem Cliffhanger, dementsprechend steht man am Ende des Bands natürlich ebenfalls vor der Frage, wie's weitergeht. Und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, ist nach den Teilen 1 bis 6 eine "Zero Issue" angefügt, die die fortlaufende Handlung unterbricht und eine davon abgetrennte Vorgeschichte enthält (inklusive eines bedeutsamen Plot-Twists übrigens).
Das mag jetzt manchen verschrecken, der lieber eine Geschichte mit Anfang und Ende hätte. Zum Trost sei gesagt, dass bereits ein Auslaufen der Serie beschlossen wurde. Das ist zwar eigentlich eine schlechte Nachricht - andererseits ermöglicht es dem Autor wenigstens, ein befriedigendes Ende zu konzipieren. Und dann kann er sich auch wieder dem Romaneschreiben widmen, denn für seine Bücher ist "Dial H" trotz hohen Unterhaltungsfaktors letztlich doch kein ausreichender Ersatz.
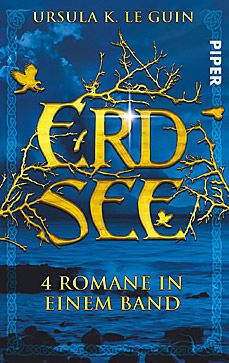
Ursula K. Le Guin: "Erdsee (Band 1 - 4)"
Broschiert, 928 Seiten, € 15,50, Piper 2013 (Original: "Earthsea", 1993)
Zum Abschluss noch weniger eine Rezension als ein Hinweis darauf, dass Piper eine Neuauflage von einem der Fantasy-Klassiker des 20. Jahrhunderts herausgegeben hat, Ursula K. Le Guins "Erdsee". Genauer gesagt von der 1968 bis 1972 erschienenen Original-Trilogie, ergänzt um das 1990 nachgeschobene "Tehanu". Diese Quartett-Zusammenstellung in einem Band gab's auf Deutsch schon einmal vor ca. einem Jahrzehnt; eigentlich hätte man da jetzt den 2001 erschienenen fünften Roman "The Other Wind" ("Rückkehr nach Erdsee") ruhig auch gleich dazupacken können, damit die Sache endlich einmal vollständig ist.
Wasserwelt als Wechselbad
Keine explizite Rezension deshalb, weil ich "Erdsee" vor Rundschau-Zeiten gelesen habe und die Erinnerungen im Lauf der Zeit natürlich verschwimmen. Sehr klar ist mir jedoch im Gedächtnis geblieben, dass mir die vier Romane damals ein ziemliches Wechselbad der Gefühle beschert haben. Band 1 ("A Wizard of Earthsea" / "Der Magier der Erdsee") verknüpfte in wunderbar zu lesender Weise klassische Fantasy-Topoi mit Unterhaltungswert und dem Tiefgang, der für Le Guins Zugang zu Genre-Literatur - egal ob Fantasy oder SF - typisch ist.
Alle vier Romane schildern Stufen eines sich über Jahrzehnte erstreckenden Reifungsprozesses. Hauptfigur in Band 1 ist der junge Ged, der auf einer der zahllosen Inseln seiner Wasserwelt als Ziegenhirte aufwächst, bis eines Tages sein magisches Talent erkannt wird. Ungestümer Tatendrang lässt ihn einen schweren Fehler begehen: Er ruft einen Schatten ins Diesseits, der ihn über die gesamte Welt verfolgen wird. Seine Gabe zu meistern und diesen Schatten zu besiegen, ist der erste Schritt auf Geds Weg zur Reife - es bedeutet letztlich nichts anderes, als dass er zu seiner Persönlichkeit findet. Dieser Roman ist alleine schon den Kauf der Neuausgabe wert, sollte man "Erdsee" tatsächlich noch nicht gelesen haben.
Nach diesem faszinierenden Abenteuer war Band 2 ("The Tombs of Atuan" / "Die Gräber von Atuan") für mich gewissermaßen eine Vollbremsung. Hauptsächlich deshalb, weil wir hier im Wesentlichen an ein- und demselben, von der Außenwelt abgeschotteten Schauplatz bleiben, was zwangsläufig Dynamik rausnimmt. Im Mittelpunkt steht nun die junge Tenar, die zur Priesterin ausgebildet wird und sich in nur allzu irdischen Machtintrigen bewähren muss, um letztlich ebenfalls ihre persönliche Freiheit zu erlangen.
Le-Guin-Fans bitte weghören!
Man kann über den "Earthsea"-TV-Mehrteiler von 2004 sagen, was man will. Le Guin war indigniert und ihre Fans entsetzt: Weil die sozialphilosophischen Elemente, die der Autorin wichtig sind, in der Serie zu kurz kamen. Weil Fantasy-Stereotypen auftauchten, wo vorher keine waren. Weil die Handlung mit einem nicht der Vorlage entsprechenden Welteroberungsplot überbacken wurde. Weil die Fernsehmacher erst wieder eine "europide" Mittelalter-Welt erschufen, was Le Guin explizit nicht gemacht hatte und auch nicht machen wollte.
... aber eines muss man der Serie zugutehalten: Dadurch, dass sie - wie frei auch immer - Band 1 und Band 2 verwurstete und diese als parallele Handlungsstränge führte, befanden sich die dynamischen und statischen Elemente der sehr unterschiedlichen Originalromane wenigstens im Gleichgewicht. (To add insult to injury darf ich an dieser Stelle hinzufügen, dass ich auch Peter Jackson für seine ähnlich geartete "HdR"-Umstrukturierung dankbar bin, weil mich die Frodo-Gollum-Kiste nie so sehr begeistert hat wie die Handlungsstränge in Rohan/Gondor/Fangorn.)
Band 3 ("The Farthest Shore" / "Das ferne Ufer") setzt dann wieder auf die Dynamik einer Queste und nutzt diese als Vehikel, um das Coming of Age Arrens, des künftigen Königs von Erdsee, zu schildern. Durchaus ähnlich dem Prinzip des ersten Bands, wenn auch nicht ganz so gut. Und Band 4 schließlich, "Tehanu", macht wieder die Rolle rückwärts: Erneut entschleunigt sich alles, wenn die älter gewordenen Tenar und Ged mit reichlich Introspektion beschäftigt sind. Ich muss gestehen, ich habe das mehrfach preisgekrönte "Tehanu" damals nicht fertiggelesen und sehe etwaigen "Banause!"-Postings nun mit Alamo-Haltung entgegen. Und wer weiß, vielleicht überzeugt mich ja jemand davon, dieses klaffende "Unerledigt" in meinem Bücherschrank nach all den Jahren doch noch auf "Gelesen" zu schieben.
Ausblick
Bis zur nächsten Rundschau werden hoffentlich alle mit dem Schimpfen fertig sein. Dann folgen unter anderem ein gemischtsprachiges Doppel von Lavie Tidhar, Oliver Henkels jüngste Manipulationen am Zeitstrom und ein paar allmächtige galaktische Mamas. Wir lesen uns! (Josefson, derStandard.at, 29. 6. 2013)