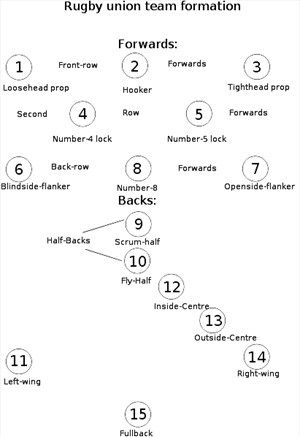Verwirrendes verlautete im Anlauf auf die Six Nations 2013, die am 2. Februar im Millennium Stadium in Wales anheben und am 16. März im Stade de France zu Paris finalisiert werden, aus dem Lager der schottischen Rugby-Nationalmannschaft. Man sei stark genug, ein großes Turnier zu gewinnen, verkündete da der Spieler Matt Scott. Nach Niederlagen in allen drei der traditionellen Testpartien im Herbst und dem daraufhin folgenden Rücktritt von Coach Andy Robinson wahrlich eine Ansage, die nicht unbedingt zu erwarten war.
Doch Scott, der Center aus Edinburgh mit dem Blick für die Trylinie, ist ein durchtriebenes Kerlchen. Gerade der erneute Rückfall in eine Schwächephase stellt in seiner Denkfigur Schottlands größtes Kapital dar. Aufgrund der nunmehr gegen Null tendierenden Erwartungshaltung der Öffentlichkeit würde seine Mannschaft in die Lage versetzt, völlig ohne Druck endlich Spitzenleistungen zu materialisieren. Scott: "Wir haben allen Grund zur Vorfreude."
Diese, eher an autosuggestive Techniken eines Ertrinkenden als an eine an Realismus orientierte Konstellationsanalyse gemahnende Vorstellungswelt, wird am Abend des 2. Februar deutlich an Validität verloren haben. Und Schottland in London an Erstrundengegner England zerschellt sein.
Dass also die Herren in den Distelshirts, notabene 2012 Stockletzte, die inoffizielle Europameisterschaft auch diesmal nicht für sich entscheiden werden, dürfte hinsichtlich der allgemeinen Ausgangslage jedoch eine der wenigen Wägbarkeiten darstellen.
Champion ohne Kopf
Widersprüchlichkeit ist nämlich Trumpf. Wales, der Titelverteidiger, ist dafür das beste Beispiel. Starke Weltmeisterschaft 2011 (bei der mehr möglich gewesen ware als Platz vier), anschließend makellos durch die Nations und damit der dritte Grand Slam in acht Jahren: die Welt der Drachen strahlte in Rosarot, der Erste Minister der Regionalregierung huldigte einer neuen Generation von Rugby-Helden. Dann fiel Trainer Warren Gatland von der Leiter.
Es folgten: sieben Niederlagen hintereinander unter der Regie von Einspringer Rob Howley, der den übel Blessierten vertreten musste. Gleich vier wurden von Australien verabreicht, wovon drei äußerst knapp bemessen waren und fallweise in herzergreifend unglücklicher Manier erlitten wurden. Das schmerzt, stellt aber gleichzeitig noch den positiven Aspekt des Absturzes dar. Das ernüchternde Element bildete die Erfahrung, vor heimischem Anhang von Argentinien und – aber selbstverständlich! – Samoa vorgeführt zu werden. Beides weit weniger stark einzuschätzende Teams als die Wallabies.
Unangenehmer Nebeneffekt: ein Rückfall auf Platz neun der Weltrangliste, wodurch man sich bei der Auslosung der Weltmeisterschaft 2015 in England bereits in der Gruppenphase zwei Kaliber einhandelte, nämlich die Gastgeber einerseits und (schon wieder) Australien.
Was also kann Wales? Oder anders gefragt: Wieviel von dem, welches das verfügbare Personal ja zweifellos drauf hat, wird es ohne Anleitung durch den mit allen Wassern gewaschenen Gatland umsetzen können? Denn der inzwischen gesundete Neuseeländer wird weiterhin nicht für seinen Arbeitgeber verfügbar sein, sondern gibt sich stattdessen die Ehre, über die Geschicke der British and Irish Lions zu wachen, einer traditionsreichen Rugby-Supergroup, die sich alle vier Jahre formiert um alternierend an überseeischen Territorien zu landen und diese mit einer Tournee zu beglücken. Im Sommer 2013 ist Australien an der Reihe. Bis dahin ist Gatlands walisischer Job ruhend gestellt.
Die Drei auf Augenhöhe
Vergleichsweise solide kamen die mutmaßlichen ersten Herausforderer, England und Frankreich, durch den Herbst. Das ist besonders im Falle der Blauen bemerkenswert. Ihre Neigung zu launenhafter Aufgeregtheit ist bekannt, Selbstzerfleischung in internen Grabenkämpfen nie auszuschließen.
Doch Manager Philippe Saint-André steuerte den Vizeweltmeister und Vorjahres-Vierten offenbar in ruhiges Fahrwasser. Alle Herbsttests wurden souverän gewonnen und dabei mit einem 33:6 gegen Australien gar ein Glanzlicht entzündet. Es war dies der zweithöchste Erfolg aller Zeiten gegen einen Gegner, den man zuvor sieben Jahr lang nicht mehr hatte überwinden können. Was wird bleibt trotzdem offen. Die beinahe sprichwörtliche Unberechenbarkeit der Gallier herrscht als der große Relativierer.
Der Moment Albions war ein verblüffendes 38:21 über Neuseeland, wodurch dem Weltmeister bei letzter Gelegenheit die Komplettierung eines Jahres ohne Niederlage vermasselt wurde. Auch wenn die All Blacks am Ende ihrer Saison sichtlich nicht mehr im Besitz aller Kräfte waren – ein Erfolg gegen einen der großen Drei hat Seltenheitswert und bleibt unzweifelhaft eine feiernswerte Leistung. Der Blick in die Statistikbücher macht sicher: Seit 2007 waren für Europas Avantgarde der Sechs von 49 Heimspielen gegen Neuseeland, Australien oder Südafrika nicht weniger als 40 verloren gegangen. Eine Bilanz, die mindestens zu Demut Anlass gibt.
Doch England bleibt auch weiterhin ein Work in Progress. Der von Trainer Stuart Lancaster nach dem WM-Desaster in Angriff genommene Neuaufbau ist trotz ermutigender Signale alles andere als abgeschlossen. Vor allem die Unerfahrenheit seines recht jungen Aufgebots erweist sich immer wieder als Achillesferse. Lancaster hat Englands Rugby zwar aus der Gosse geholt, aber noch keine austarierte Formation gefunden auf die er sich verlassen kann. Das Ausprobieren geht also weiter. Aber vielleicht gelingt ja ein (weiterer) Schritt nach vorne. Und der würde nach Platz zwei im Vorjahr ja schon für den Lorbeer reichen.
Im Nacken spüren die Vorgenannten den Atem Irlands. Übers Jahr nicht unbedingt berauschend unterwegs, fand man dort immerhin ein ideales Timing. Während nach einem sommerlichen 0:60-Schock gegen Neuseeland bereits das Ende der Ära von Teamchef Declan Kidney eingeläutet schien, geht dessen Mannschaft nun nach einer letzten Standortbestimmung der erhebenden Art mit geschwellter Brust ins Turnier. Sieben Tries waren im November beim 46:24 in Dublin gegen immer näher an die Weltspitze heranrückende Argentinier gelungen. Im debütierenden Craig Gilroy, einem aufregenden jungen Flügel, könnte zudem ein neues Prachtstück heranwachsen.
Verzagen gilt nicht (mehr)
Die vielleicht spannendste Ungewissheit trägt Bergblau und den Namen Italien. Seit die Azzurri im Jahr 2000 das bisherige Fünferfeld veredeln, war ein vierter Platz das höchste der Gefühle gewesen. Und obwohl die Italiener sich seit dieser auch sportstrategisch zu sehenden Entscheidung immer wieder einmal respektabel schlugen, bemängeln Beobachter doch den ausbleibenden Durchbruch. Die nackten Zahlen belegen das: neun Siege, ein Remis und 55 Niederlagen stehen in der Gesamtbilanz.
Doch es verdichten sich die Fingerzeige, wonach das Erwartete diesmal auch eintreten könnte. Beispiele? "Ich möchte Italien zu einem großartigen Match gratulieren." Das sagte am 17. November nicht irgendjemand, sondern Neuseeland-Coach Steve Hansen. Es handelt sich hier also um nichts weniger als einen Ritterschlag.
Die Nummer eins der Welt hatte sich in Rom gerade ein 42:10 erkämpfen müssen, bei dem ihm von einem beherzten Gegner besonders in der ersten Halbzeit heftig zugesetzt worden war. Und das war wohl das bemerkenswerteste an der Sache: 73.000 Zuschauer wurden im Olympiastadion nicht etwa Zeugen eines Abwehrkampfes, Italien war im Gegenteil bemüht, selbst die Initiative zu gewinnen. Noch einmal Hansen: "Italien ist gekommen um zu spielen, nicht, um die Punktzahl niedrig zu halten."
Wofür der Neuseeländer den Kronzeugen gibt, ist das Streben nach einer neuen Mentalität. Einer neuen Weltsicht. Seit einem Jahr arbeitet der Franzose Jacques Brunel daran, seinen Schutzbefohlenen den instinktiven Verfall in einen reaktiven Schadensbegrenzungsmodus auszutreiben. An dessen Stelle soll ein optimistischer und konstruktiver Geist implantiert werden.
Beinahe Australien
Die herbstliche Vorgabe sei es gewesen, so Brunel, die eigenen Ideen durchzubringen und den gewählten Spielplan nie aus den Augen zu verlieren. Das hat gut geklappt. Eine Woche nach der Neuseeland-Erfahrung hatten die Italiener Australien gehörig am Wackeln, drei Punkte fehlten beim 19:22 zum ersten Erfolg gegen den WM-Dritten überhaupt. Mit einem 13:0 in der zweiten Halbzeit konnte aber immerhin schon einmal ein Etappensieg verbucht werden.
Und auch der dritte Test, das nicht ganz so knisternde 28:23 gegen Tonga, bot positiven Interpretationsspielraum. Gegen einen Gegner auf Augenhöhe wurde einer der unglamouröseren, nichtsdestoweniger aber unverzichtbaren Aufgabenstellungen des Profisports genüge getan: zu liefern, wenn es darauf ankommt.
Die Vertiefung der Integration Italiens in die europäischen Rugby-Strukturen auf höchster Ebene beginnt offenbar Früchte zu tragen. Seit der Saison 2010/11 messen sich zwei italienische Franchises (der Traditionsklub Treviso und das Kunstprodukt Zebre) in der Pro12-Liga gegen walisische, irische und schottische Konkurrenz. Den besten Spielern soll die Möglichkeit geboten werden, an größeren Herausforderungen zu wachsen als jenen, die die nationale Meisterschaft, das Campionato di Eccellenza, zu bieten hat.
Am 3. Februar wird sich gegen Frankreich zeigen, wie weit die Beine tatsächlich tragen. (Michael Robausch, derStandard.at, 30.1.2013)