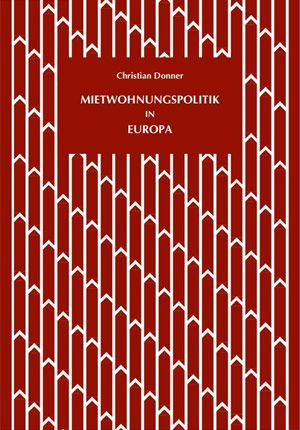Der Wohnbauforscher Christian Donner hat heuer ein gewichtiges Werk zur "Mietwohnungspolitik in Europa" vorgelegt. Sehr kritisch setzt er sich darin mit dem heimischen Wohnbaufördersystem auseinander. Österreich habe sich damit zwar – unter hohem finanziellen Aufwand – ein eindrucksvolles Neubauvolumen geschaffen, auf der anderen Seite seien über dieses Instrument aber auch viele Leute bedient worden, "die sich aus eigener Kraft etwas schaffen hätten können".
Die ohnehin als zu hoch kritisierten Einkommensgrenzen im geförderten Wohnbau würde er deshalb abschaffen, im derStandard.at-Interview hält er die Einführung einer reinen Subjektförderung (=Wohnbeihilfe) statt der derzeit üblichen Kombination aus Objekt- und Subjektförderung für möglich. "Das hätte den Vorteil, dass man sehr viele Mitnahmeeffekte vermeiden könnte. Denn man 'füttert' mit der Objektförderung auch alle jene mit, die sich eine Markt- oder eine echte Kostenmiete leisten könnten." Zur weiteren Finanzierung des Wohnbaus schwebt ihm ein Pensionsfonds-Modell vor – ähnlich jenem, das auch vom Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen (gbv) schon des öfteren vorgeschlagen wurde. Allerdings sollte die Bestandspolitik nach schwedischem Vorbild ablaufen: mit den Gemeinden als Eigentümer, aber einer ausgelagerten Bewirtschaftung der Wohnungen.
"Grundsteuer deutlich anheben"
In Umwidmungsgewinnen sieht er "leistungsfreies Einkommen pur" und schlägt vor, 80 Prozent der realen Wertsteigerung zu besteuern. Auch die Grundsteuer sollte seiner Meinung nach deutlich angehoben werden: Dadurch könnten andere Steuern ermäßigt werden, außerdem hätte das einen positiven Einfluss auf den Bodenmarkt, "weil man dann ein Grundstück nicht lange horten wird, wenn man es nicht braucht". Dänemark sei da ein gutes Beispiel, dort sei dann auch "meist Grund da, wenn jemand wirklich investieren will".
Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit der endlichen Ressource Boden schlägt Donner auch Mindestdichten vor. "Vor allem im urbanen Bereich sollte ein Einzelner nicht ein sehr großes Grundstück bewohnen dürfen, nur weil er es sich leisten kann, und damit potenzielles Bauland blockieren."
"Vermieter fördert Mieter"
Auf dem Sektor der geregelten privaten Mieten sieht er ein großes Problem in den oft sehr niedrigen "Uralt-Mieten". Diese seien oft "krass einseitig" und damit eine unfreiwillige "Förderung" des Mieters durch den Vermieter. Das Geld, das den Vermietern zur Instandhaltung ihrer Wohnungen fehle, werde dann nämlich oft erst recht von der öffentlichen Hand in Form von Förderungen bereitgestellt: "Es wird dem Vermieter also nachträglich das, was er vom Mieter nicht einnehmen konnte, aus öffentlichen Kassen zur Verfügung gestellt, damit er das tun kann, was er sonst aufgrund des Konkurrenzdrucks freiwillig getan hätte."
Den Verkauf von öffentlichen Wohnungsbeständen befürwortet Christian Donner unter gewissen Voraussetzungen: Man sollte nicht benötigte Wohnungen jedenfalls nicht "verschleudern", sondern "immer zum bestmöglichen Preis verkaufen" – auch, wenn sich Mieter darin befinden. Generell gelte es, aufzupassen, "dass die geförderten Mietwohnungsbestände nicht in private Hände abrutschen. Denn dann müsste man von vorne damit anfangen, mit hohem Mitteleinsatz einen öffentlichen Wohnungsbestand aufzubauen."
Das Gespräch führte Martin Putschögl.
derStandard.at: Herr Donner, Sie haben heuer eine umfassende Analyse über die "Mietwohnungspolitik in Europa" veröffentlicht, für die Sie unter anderem die Systeme von zehn EU-Ländern verglichen haben. Fanden Sie dabei auch das "ideale" Verhältnis zwischen Miet- und Eigentumswohnungen heraus?
Donner: Als grobe Richtwerte könnte man angeben, dass der Anteil des Wohnungseigentums etwa zwischen 50 Prozent und 80 Prozent liegen und der Mietwohnungssektor je zur Hälfte auf private und geregelte Mietwohnungen entfallen sollte. Das ist aber eine rein empirische Schlussfolgerung aus meinen Studien, das kann man nicht theoretisch errechnen.
derStandard.at: Die Österreicher wohnen zu 56 Prozent im Eigentum, der Rest teilt sich in etwa gleich auf geförderte Mieten und freie Mietwohnungen auf. Herrschen hierzulande also nahezu ideale Verhältnisse?
Donner: Ja, das könnte man so sagen. Aber mit großen regionalen Unterschieden: In Wien haben wir etwa 75 Prozent Mietwohnungen, während man im Burgenland zu mehr als 80 Prozent im Eigentum wohnt. Traditionell gibt es in den urbanen Zonen mehr Mieter, in den ländlichen Regionen mehr Eigentum.
Ich glaube jedenfalls, dass, wenn die Nicht-Markt-Mietwohnungen und die Markt-Mietwohnungen eine Balance halten, der geförderte Bereich den nicht geförderten Bereich ausreichend beeinflussen kann. Wenn man nur einen sehr kleinen Sektor geregelter Mietwohnungen hat, dann können die Vermieter der nicht mietengeregelten Wohnungen überhöhte Mieten verlangen. Ob jetzt der Eigentumssektor besser bei 60 oder 70 Prozent liegt, das hängt dann vom jeweiligen Land ab. Es gibt ja diese traditionelle, sehr stark verankerte Vorstellung, dass Wohnungseigentum einen höheren Rang einnimmt als eine Mietwohnung. In mehreren Ländern Südeuropas und in Irland gibt es einen viel größeren Anteil an Eigentum, um die 80 Prozent oder mehr. Ähnliches gilt für mittelosteuropäische Länder, wo umfangreiche Privatisierungen ehemals staatlicher Mietwohnungen stattgefunden haben. In den meisten zentral- und nordeuropäischen Ländern ist der Wohnungseigentumssektor hingegen kleiner.
derStandard.at: Soll die öffentliche Hand diese Strukturen überhaupt in irgendeiner Weise beeinflussen?
Donner: Nur soweit die vorhandene Wohnungsmarktstruktur stark von den genannten Verhältnissen abweicht. Die meisten Leute wissen nämlich sehr gut, was sie können oder wollen, und passen sich den Gegebenheiten an bzw. beeinflussen sie durch ihre eigenen Entscheidungen. Darüber hinaus sollte die öffentliche Hand den Bürgern gewisse grundsätzliche Kenntnisse vermitteln: Etwa, was es heißt, eine private oder öffentliche Mietwohnung zu beziehen oder Wohnungseigentum zu erwerben, vor allem in finanzieller Hinsicht. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang aber auch die Frage der Raumplanung. Da ist die öffentliche Hand viel mehr gefordert: Wie mit dem Boden umgegangen wird, ist eine ganz manifeste Aufgabe, die oft viel zu wenig wahrgenommen wird.
derStandard.at: Sehen Sie das als Aufgabe des Zentralstaats?
Donner: Raumplanung ist eine Aufgabe, die auf mehreren Ebenen von Gebietskörperschaften definiert und umgesetzt werden sollte. Natürlich ist der Staat für die großen Leitlinien zuständig. Vieles kann regional oder unter Umständen auch lokal geregelt werden. Nur: wenn man die Entscheidungen zu sehr auf der lokalen Ebene ansiedelt, dann sind der persönlichen Einflussnahme mehr die Tore geöffnet als auf einem mittleren Niveau.
In einer örtlichen Raumplanung sollten sowohl Höchst- als auch Mindestbebauungsdichten festgelegt werden. Die Höchstdichten sind uns vertraut, denn sie bedingen die Ausnützbarkeit eines Grundstücks, d.h. letztlich seinen Wert. Aber im Sinne eines sparsamen Umgangs mit dem endlichen Boden sollte es auch Mindestdichten geben. Vor allem im urbanen Bereich sollte ein Einzelner nicht ein sehr großes Grundstück bewohnen dürfen, nur weil er es sich leisten kann, und damit potenzielles Bauland blockieren.
derStandard.at: Sie schlagen vor, Umwidmungen erst nach einem Grundstückserwerb der öffentlichen Hand durchzuführen, damit diese nicht exorbitant viel für das spätere Bauland zahlen muss.
Donner: Ja, denn die Wertsteigerung, mit der Grundstücksverkäufer meist rechnen, ist eine ungerechte Sache. Das ist leistungsfreies Einkommen pur. Wenn Sie heute ein Grundstück kaufen und dafür 100.000 Euro zahlen, und es zehn Jahre später um 200.000 Euro verkaufen, haben Sie 100.000 Gewinn – wenn wir für den Augenblick die Inflation vernachlässigen. Da würde ich sagen: 80 Prozent der realen Wertsteigerung sollten als Steuer abgeführt werden. Ich sage absichtlich nicht 100 Prozent, denn es sollte auch ein gewisser marktmäßiger Steuerungseffekt Platz greifen. Es gibt da diesen Ausdruck: Eine Liegenschaft soll "zum besten Wirt wandern".
Die Verkäufer sind ja heute auch nicht dumm. Sie kennen die Zusammenhänge und verkaufen häufig nur mit einer Besserungsklausel. Wenn also innerhalb eines zeitlichen Rahmens eine höherwertige Widmung erfolgt, dann bekommen sie noch einen Aufschlag von z.B. 50 Prozent.
Die zweite Steuer in diesem Zusammenhang ist die Grundsteuer selbst, die in Österreich deutlich angehoben werden sollte. Das hätte viele positive Effekte: Einerseits könnten andere Steuern bei gleichem Gesamtaufkommen ermäßigt werden und andererseits wird dadurch der Bodenmarkt beeinflusst. Dessen Flexibilität wird gesteigert, wenn man die laufenden Belastungen anhebt, weil man dann ein Grundstück nicht lange horten wird, wenn man es nicht braucht. Gegenwärtig zahlt man eine Bagatelle dafür, dass man es 30 Jahre lang liegen lässt, und beim Wiederverkauf langt man zu.
Dänemark ist ein gutes Beispiel für die relativ hohe dauerhafte Belastung von Baugrundstücken. Deshalb ist dort auch meist Grund da, wenn jemand wirklich investieren will.
derStandard.at: Weil die Grundsteuer wesentlich höher ist?
Donner: Ja, die dänischen Steuerbehörden setzen jedes Jahr für den gesamten Liegenschaftssektor die aktuellen nominellen Werte differenziert nach Lage fest. Das zeigt, dass es mehr am Wollen als am Können liegt.
derStandard.at: Zurück nach Österreich. Das hiesige Mietrecht ist ein Dschungel, in dem sich nur noch eine Handvoll Leute wirklich auskennt. Haben Sie bei Ihrem Ländervergleich ein vorbildhaftes Mietrecht angetroffen?
Donner: Ein ideales Mietrecht für den Privatsektor wird es wahrscheinlich nicht geben. Zum Beispiel in Frankreich war man einmal vermieter-, dann wieder mieterfreundlich, das ging drei-, viermal hin und her. Letztlich hat man sich in etwa der Mitte getroffen. Das österreichische Mietrecht für Neuvermietungen, die nicht geregelt sind, ist wahrscheinlich praktikabel und funktionsfähig. Wir haben jetzt vernünftige Kündigungsfristen, üblicherweise eine Indexierung, und wir haben die Ablösen irgendwie geregelt. Ob es das in der Praxis auch so spielt, steht auf einem anderen Blatt. Grundsatz für ein ausgewogenes Mietrecht sollte jedenfalls sein, dass die Interessen der Mieter und der Vermieter angemessen berücksichtigt werden.
Was den Sektor der geregelten privaten Mieten hier betrifft, bin ich hingegen nicht einverstanden. Da gibt es diese uralten Erbschaften, wo es – in abnehmendem Maße, aber noch immer – Mietverhältnisse gibt, die krass einseitig sind, wo also der Vermieter den Mieter fördert, nolens volens. Das hätte viel früher bereinigt werden müssen. Natürlich bin ich der Letzte, der sagt, dass man in Notsituationen, also wenn eine gravierende Wohnungsnot herrscht, den Markt frei spielen lässt. Das wurde ja auch nicht gemacht. Aber den Abbau dieser "Wohnungszwangswirtschaft", wie er in mehr marktwirtschaftlich orientierten Ländern vonstatten ging, den ist man bei uns nur sehr schleppend angegangen.
derStandard.at: Wäre das aber nicht auch eine einseitige Bevorzugung der Vermieter, wenn beispielsweise bei den Uralt-Mietverträgen eingegriffen, aber gegen die hohen Marktmieten nichts getan wird?
Donner: Die geregelten Mieten sind ja meist marktunterschreitende Mieten. Sie können so niedrig sein, dass es für den Vermieter ein Verlustgeschäft wird. Er betreibt dann eigentlich Raubbau. Die erste Reaktion ist, dass er nichts mehr investiert, damit letztlich das Gebäude zusammenfällt. Dann kann er neu investieren. Das ist die extreme Variante. Oft ist es aber auch so, dass dann – wie in unserem Fall – diverse Förderungsmodelle entwickelt werden, um diesen verfallenden Bestand zu retten. Es wird dem Vermieter also nachträglich das, was er vom Mieter nicht einnehmen konnte, aus öffentlichen Kassen zur Verfügung gestellt, damit er das tun kann, was er sonst aufgrund des Konkurrenzdrucks freiwillig getan hätte.
Natürlich führen marktunterschreitende Mieten auch zu Ablösezahlungen und anderen negativen Begleiterscheinungen, wie etwa, dass die Wohnungen nicht freigegeben werden aufgrund der sehr weit gefassten Eintrittsrechte. Es gibt Länder, wo die Vermieter über Generationen nicht über ihre Wohnungen verfügen konnten.
Anstelle einer Mietenregelung für den privaten Sektor sollte daher ein ausreichendes öffentliches Mietwohnungsangebot unterschiedlichen Standards treten, das mit dem privaten Angebot konkurriert und damit indirekt auch das private Mietenniveau dämpft.
derStandard.at: Das österreichische Wohnbaufördersystem wird oft als vorbildlich bezeichnet. Sie teilen diese Meinung aber eher nicht. Warum?
Donner: Wir haben ein sehr großzügiges,aber auch aufwändiges Wohnbauförderungssystem entwickelt und damit ein eindrucksvolles Neubauvolumen geschaffen. Aber nicht unbedingt für die, die es am notwendigsten gehabt hätten. Wir haben über dieses Instrument nämlich auch viele Leute bedient, die sich aus eigener Kraft etwas schaffen hätten können. Möglich wurde das unter anderem einerseits durch den hohen finanziellen Aufwand, andererseits dadurch, dass mit dem privaten Sektor, der teilweise Mietenbegrenzungen unterliegt, ein komplementäres Angebot geschaffen wurde, das die Preise auf dem freien Mietwohnungsmarkt drückt.
derStandard.at: Was sagen Sie dazu, dass die AK seit Jahren oder Jahrzehnten fordert, dass der Lagezuschlag im Richtwertsystem überhaupt völlig abgeschafft gehört?
Donner: Das scheint mir weder logisch noch realistisch. In letzter Konsequenz würde das heißen: Alle sollen gleich wohnen. Das kann aber nicht so sein. Man kann allerdings manche Lagenachteile mit anderen Mitteln kompensieren. Die Lage ist nur ein Faktor, die Dichte der Bebauung ein anderer, wie auch die Ausstattung, die Größe und das Baualter der Wohnungen.
Wenn die öffentliche Hand beobachtet, dass sich die Grundpreise zwischen verschiedenen Wohngebieten zu weit auseinander entwickeln, dann muss das ja eine Ursache haben, weshalb die Menschen in bestimmten Gegenden nicht mehr wohnen wollen. Dann muss man in die Infrastruktur und die Qualität des Wohnumfelds dort investieren. Damit würde die Nachfrage nach Wohnungen auch wieder steigen – wie auch die Bodenpreise.
derStandard.at: Aus Ihrer Studie lässt sich auch herauslesen, dass das Wohnbaufördersystem auf eine reine Subjektförderung umgestellt werden sollte.
Donner: Nein, nur sollte meiner Meinung nach die Objektförderung neu gestaltet werden. Grundsätzlich könnte man zwar anstelle einer Objektförderung nur eine Subjektförderung, also eine Wohnbeihilfe einsetzen und mit ihr den Wohnungsaufwand so weit absenken, dass man auf dasselbe Niveau wie im (objekt-)geförderten Wohnbau kommt. Andererseits wirken Einkommenszuschüsse auch immer preissteigernd, womit der Subventionseffekt teilweise verloren geht. Deshalb wurden und werden ausschließlich oder ergänzend Objektförderungen eingesetzt. In diesem Sinne fördern Gebietskörperschaften zunächst den Wohnbau mit diversen Maßnahmen: Billiges oder kostenloses Bauland, Baukostenzuschüsse, und zur Finanzierung gibt es Zinsen-, Annuitäten- oder Bewirtschaftungszuschüsse.
Für die Festlegung der Miete werden in den einzelnen Staaten üblicherweise diverse Formen der Kostenmiete oder soziale Kriterien angewendet, also ein Medianeinkommen oder ein typisches Arbeitereinkommen herangezogen. Also eine "Sozialmiete", die keinen direkten Bezug zu den Bereitstellungskosten hat. Dann zeigt sich aber in der Regel, dass viele Haushalte auch diese Mieten noch nicht zu zahlen imstande sind. Deshalb wird die Miete zusätzlich über eine Wohnbeihilfe abgesenkt. Man könnte also theoretisch alles mit der Wohnbeihilfe allein machen, d.h. mit ihr die Miete so weit absenken, dass man auf dasselbe Niveau kommt – eine reine Subjektförderung statt einer Kombination aus Objekt- und Subjektförderung. Das hätte den Vorteil, dass man sehr viele Mitnahmeeffekte vermeiden könnte. Denn man "füttert" mit der Objektförderung auch alle jene mit, die sich eine Markt- oder eine echte Kostenmiete leisten könnten.
Jedenfalls sollten Wohnbeihilfen anhand der realen Bereitstellungskosten öffentlicher Mietwohnungen berechnet werden, unabhängig von der tatsächlichen Rechtsform.
derStandard.at: Was sind Ihre Vorschläge punkto Objektförderung?
Donner: Mit allen Formen laufender Zuschüsse erreichen wir mit einem Mitteleinsatz von 100 lediglich eine gleich hohe Entlastung für den Mieter. Viel sinnvoller wäre es, Objektförderungsformen einzusetzen, die eine höhere Effizienz erreichen. Aber wie ließe sich mit dem Aufwand von 100 eine Entlastung von 150 oder 200 oder noch mehr erzielen?
Das wäre mit der Form eines Förderungsdarlehens möglich, wenn man es richtig gestaltet. Also etwa anfangs das gesamte Investitionsvolumen begünstigt zu finanzieren – was natürlich eines großen Mitteleinsatzes bedarf. Danach sollte sich aber die öffentliche Hand über eine Laufzeit von 50 Jahren das gesamte Kapital wieder wertgesichert zurückholen, also real 100 Prozent. Durch eine derartige Finanzierungshilfe entfielen die realen Finanzierungskosten, die bei einem Kapitalmarktdarlehen anfallen würden.
Die grundsätzliche Frage ist natürlich: Woher soll das nötige Kapital kommen?
derStandard.at: Ja – woher?
Donner: Ich glaube, die logische Antwort darauf ist ein Refinanzierungsfonds; ein Umlauffonds, der als staatlicher Pensionsfonds gestaltet ist. Er sollte die Mittel der zweiten Säule zeitgenössischer Pensionsfinanzierungssysteme konzentrieren und mit einer staatlichen realen Wertsicherungsgarantie ausstatten.
derStandard.at: Diesen Vorschlag haben aber auch die Gemeinnützigen schon mehrmals eingebracht ...
Donner: Nicht wirklich. Sie sprechen zwar von einem Umlauffonds, aber unter eigener Verwaltung. Das scheint mir nicht zielführend. Ein derartiger Pensionsfonds müsste eine staatliche Institution sein, mit einer ganz klaren Trennung von allfälligen Mittlerstrukturen.
derStandard.at: Mit den Mitteln des Pensionsfonds würden also Wohnhäuser gebaut werden, und die Mieter in diesen Häusern würden dann laufend die Pensionen zahlen?
Donner: Das ist ein bisschen zu kurz formuliert. Es ist ein Dreier-Gespann: Ein Einsatz von Mitteln dieses Pensionsfonds für den Mietwohnungsbau sollte nur den Gemeinden zugänglich sein. Also eine Gemeinde holt sich aus dem Fonds die Mittel um z.B. 100 Wohnungen zu bauen und führt über die Mieterlöse das aufgenommene Darlehen wertgesichert wieder zurück an den Fonds.
Hinsichtlich der Umsetzung der Bestandspolitik bevorzuge ich das schwedische Modell: Die Gemeinden, also letztlich die Eigentümer, sollten die Entwicklung der kommunalen Wohnungsbestände aus politischer Warte beaufsichtigen, also das Controlling ausüben, aber sie nicht selbst bewirtschaften. Die Umsetzung von Investitionen und die Vergabe von Drittleistungen sollte in einer ausgelagerten Institution angesiedelt sein. Die tatsächliche Bewirtschaftung könnte meiner Meinung nach durchaus auch bei privatwirtschaftlich und/oder gemeinnützig agierenden Unternehmen liegen. Das wäre auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe für Letztere. Aber gehören sollten ihnen die Wohnungen nicht. Und das ist eine große Gefahr, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern: Man muss aufpassen, dass die geförderten Mietwohnungsbestände nicht letzten Endes in private Hände abrutschen. Denn dann müsste man von vorne damit anfangen, mit hohem Mitteleinsatz einen öffentlichen Wohnungsbestand aufzubauen.
Was den Wohnungseigentumssektor betrifft, da sollte die öffentliche Hand nicht direkt investieren, sondern nur ein ähnliches System der Finanzierungshilfe mit kürzerer Laufzeit bereitstellen, sodass im Prinzip jeder Staatsbürger – nach Verfügbarkeit der Mittel – ein Darlehen in ähnlicher Form beantragen könnte. Dieses bekäme man dann nur einmal im Leben, und man könnte es eventuell auch für seine Tochter oder seinen Sohn "mitnehmen", um eine Drei-Zimmer-Wohnung zu kaufen, oder ein Einfamilienhaus zu bauen. Die Förderung bestünde dabei in der Zinsersparnis, ohne realen Kapitalverlust der öffentlichen Hand.
derStandard.at: Würden Sie dann auch etwa bei den Einkommensgrenzen für geförderte Wohnungen herumschrauben?
Donner: Die Einkommensgrenzen im geförderten Mietwohnungsbereich sind eigentlich zu vergessen. Sie umfassen 85 oder 90 Prozent der Bevölkerung, das ist nur noch ein Formalismus. Es gibt Staaten, die diese Grenzen überhaupt abgeschafft haben.
derStandard.at: Da wird dann immer dagegen argumentiert, dass man dadurch keine sozialen Ghettos schafft.
Donner: Ja, aber das ist gleich wieder das andere Extrem. Die Leute, die geregelte Mieten zahlen, das sind ja nicht lauter Hungerleider. Daher müssen wohlhabende Leute nicht sehr günstig oder nahezu umsonst wohnen, damit wir ein ausgewogenes Sozialgefüge haben. Das ist zu extrem. Ich bin sehr dafür, möglichst überall eine gute Sozialstruktur zu sichern, aber gleichzeitig die tatsächlichen Kosten voll zu decken.
In Schweden oder Dänemark beispielsweise gibt es auch den Begriff "Sozialwohnung" gar nicht. Dort gibt es einfach einen öffentlich verwalteten oder einen selbstverwalteten Mietwohnungsbestand, der den mietrechtlichen Rahmenbedingungen unterliegt, zu dem aber alle Menschen Zugang haben. Probleme gibt es freilich auch dort, insbesondere mit illegalen Ablösen. Wenn die Mieten die Marktmieten zu stark unterschreiten, dann ergeben sich alle möglichen Arrangements.
derStandard.at: Die Bestandspolitik haben sie schon kurz angesprochen. In Ihrer Studie sprechen Sie sich nicht prinzipiell gegen den Verkauf von gefördert errichteten Wohnungsbeständen aus. Warum?
Donner: Nein, da bin ich nicht prinzipiell dagegen. Es kann auch ein örtliches Überangebot öffentlicher Mietwohnungen entstehen, z.B. in Abwanderungsgebieten. Wenn aber Wohnungen aus dem öffentlichen Bestand verkauft werden sollen, dann sollte dies immer zu Marktpreisen, also zu bestmöglichen Preisen erfolgen, und auch nicht an Bestandsmieter billiger verkauft werden. Obwohl dies in vielen Ländern eine übliche Praxis ist. Der Mieter "blockiert" also sozusagen die Wohnung, und sie ist deshalb weniger wert. Die scheinbare Minderung des Marktwerts erfährt die Wohnung aber nur dadurch, dass sie einer Mietenregelung unterliegt, die marktunterschreitende Mieten mit sich bringt.
Grundsätzlich halte ich bei der Bewirtschaftung eines öffentlichen Mietwohnungsbestands das schon angesprochene Monitoring für sehr wichtig. Man muss ständig beobachten, wie sich der Markt entwickelt, wo sich eine Wohnungsknappheit entwickelt, etc. Das läuft letztendlich auf eine strategische Bestandspolitik hinaus, das heißt man muss als öffentlicher Wohnungsverwalter vorausdenken, was passiert in den nächsten 10, 15 Jahren? Schließlich muss man zu verhindern versuchen, dass die einzelnen Wohnungsstandorte auseinanderklaffen, dass also gewisse Orte irgendwann als stigmatisiert gelten. Wir haben das in Österreich praktisch überhaupt nicht, in anderen Ländern ist das viel gravierender, da gibt es richtige Slums. Dann muss man etwas tun – wie in der ehemaligen DDR, wo sehr umfangreiche Wohnungsbestände wieder mit öffentlichem Geld abgebrochen werden mussten. Ein derartiger Rückbau wirkt sich aber bis auf die vorhandene Infrastruktur aus.
derStandard.at: Sehen Sie da nicht auch ein bisschen eine Generationen-Ungerechtigkeit, wenn die eine Generation die Wohnungen, die von der vorhergehenden gefördert errichtet worden sind, nun verkauft und die Erlöse lukriert?
Donner: Nein, denn das ist ja nicht die Generation, die am Ruder ist, sondern der Staat, die Gesellschaft als Ganzes, die eine Umwandlung von Realkapital in Geldkapital vornehmen würde. Wenn man die Wohnungen nicht mehr braucht, weil der Bedarf in bestimmten Regionen zurückgeht, dann soll man vorhandene Wohnungsbestände nicht justament zurückhalten, nur um sagen zu können, sie wurden nicht verkauft. Schließlich verursachen Wohnungsleerstände ungedeckte laufende Kosten. Man soll nicht benötigte Wohnungen nur nicht verschleudern, also immer zum bestmöglichen Preis verkaufen.
Umgekehrt kann man natürlich auch private Bestandswohnungen zukaufen – es ist ja nicht gesagt, dass man immer neu bauen muss. Damit könnte man auch vermeiden, dass bei zu knappem Bestand ärmere Haushalte Neubauwohnungen beziehen müssen, deren Mieten aufwändig heruntergefördert werden. Andererseits würden Haushalte mit etwas höheren Einkommen unter Umständen keine der knappen öffentlichen Mietwohnungen bekommen und im privaten Sektor zu höheren Mieten logieren müssen. Der Ärmere wohnt dann besser als der nicht ganz Wohlhabende. Das ist auch nicht ganz logisch.
Wichtigster Grundsatz einer sozial orientierten Wohnungspolitik sollte sein, dass auch die Wohnungen der einkommensschwächeren Haushalte akzeptable Wohnungen sein sollen. Dabei wird die Definition einer "akzeptablen Wohnung" immer auch vom jeweils erreichten allgemeinen Standard der Wohnraumversorgung abhängen. (Martin Putschögl, derStandard.at, 19.12.2011)