
Cameron Pierce (Hrsg.): "Amazing Stories of the Flying Spaghetti Monster"
Broschiert, 228 Seiten, Eraserhead Press 2011
Die sommerliche Realsatire um Niko Alms Führerscheinfoto mag für viele der Erstkontakt mit dem Pastafarianismus gewesen sein - für andere war die Religionsparodie rings um das Fliegende Spaghettimonster da natürlich schon längst ein alter Hut bzw. ein altes Nudelsieb. Wer mehr zum FSM wissen möchte, kann dies in Bobby Hendersons "Evangelium des Fliegenden Spaghettimonsters" nachlesen. Bizarro-Autor Cameron Pierce, mit "Shark Hunting in Paradise Garden" selbst schon auf religiösen Irrwegen gelustwandelt, will seine neue Anthologie denn auch als gnostic supplement zu diesem Evangelium verstanden wissen. 23 "Amazing Stories" hat er hier versammelt, und mit Namen wie Jeffrey Thomas, Mykle Hansen, Andersen Prunty, Cody Goodfellow, Bruce Taylor oder Kevin L. Donihe ist hier auch so einiges an Bizarro-Prominenz vertreten.
Dem Thema entsprechend wimmelt es in den 23 Kurzgeschichten nur so vor religiösen Topoi, die "bis zur Kenntlichkeit entstellt werden", wie das so schön abgedroschen heißt: Erleuchtungsmomente, Glaubenskriege, Propheten und Märtyrer, Apokalypseerwartungen und und und. Mykle Hansen etwa, der sich mit "Help! A Bear Is Eating Me!" und "The Cannibal's Guide to Ethical Living" als Großmeister des schwarzen Humors erwiesen hat, macht in "How I Became A Famous Author" sich bzw. seinen Ich-Erzähler zum Born Again Pastafarian. Schön, wie er vor allem den Aspekt der Selbstgefälligkeit herausstreicht, der dergleichen Erweckungsgeschichten stets durchdringt - hier musste der Bekehrte auf seinem Weg zu Ruhm und Geld erst mal so tief sinken, dass sich sogar seine Katze den goldenen Schuss gesetzt hat. Weniger Glück haben da schon die Protagonisten von Kirk Jones' "The Noodly Appendage That Feeds You" und Steve Lowes "Praise The Lord And Pass The Parmesan" nach ihren jeweiligen Transzendenzerlebnissen: Ersterer wird als Ketzer massakriert, letzterer gerät in eine tragikomische Rachegeschichte inklusive Torture-Porn-Einschlag und vergeblichen Versuchen, in einer Filiale der Restaurantkette "Olive Garden" einen Gottesdienst zu feiern.
An die Frühzeit des Christentums erinnert Len Kuntz in "Belief Without Evidence", in dem Kampfjets das sich am Himmel manifestierende FSM vertreiben. Von nun an erwarten seine treuen AnhängerInnen täglich seine Wiederkehr, woraus zu ihren Lebzeiten aber wohl nichts mehr werden dürfte. Da fackelt man in "How We Got Rid Of You (And How We Got Along After)" von Cody Goodfellow nicht lange: Weil der religiöse Teil der Menschheit das dauernde Warten auf die Apokalypse satt hat, führt man sie kurzerhand selbst herbei. Hinter schwarzen Pointen (z.B. der Ausrottung aller säkular Gesinnten durch eine tückisch ausgetüftelte iPhone-App) scheint hier sogar ein Tick echte spirituelle Verzweiflung durchzuschimmern.
Einige Geschichten machen das FSM selbst zur Hauptfigur: "Inside The Monster's Studio" von S. G. Browne etwa ist das Transkript einer Talkshow, in der das FSM über seine Kumpels Godzilla und Mothra und seine sprunghaft ansteigende Zahl an Facebook-Freunden quasselt. Den Sprung hat es in "Down And Out In Mythos City" von Adam Bolivar noch nicht geschafft - hier muss es erst mal vor einem Tribunal etablierter Gottheiten wie Thor, Jehova und (huch?) Charlie Sheen antanzen, die über seinen Gott-Status abstimmen. In "Grumpy Old Gods" von David W. Barbee ist ihm dieser mitsamt einem eigenen Häuschen im Suburb der Götter bereits zuerkannt worden - wäre da bloß nicht ein missgünstiger Nachbar namens Cthulhu. Die Geschichte ist eher naja, aber Cthulhu beweist einmal mehr äonenalten Durchblick: "You new gods, you don't understand how it used to be in prehistoric times. To be a god you had to be bigger than the sky. Now all you've gotta do is have a few morons click you on the internet. You don't even eat any of them."
Da es sich bei den "Amazing Stories" um eine Bizarro-Anthologie handelt, gilt: Abgefahren ist Trumpf. Den Gipfel erklimmt hier Marc Levinthal mit seiner Parodie auf Far-Future-Szenarien "Bloodskeleton, Scourge Of The Christies": In einer postapokalyptischen Wüstenei macht der Piratenkapitän Bloodskeleton Jagd auf die letzten Christen und stößt dabei unter anderem auf die Show-Götter von Las Vegas, die Vivian Girls des Outsider-Schriftstellers Henry Darger und die Mafia. Beachtenswert dabei unter anderem, wie er die Geschichten von Jesus Christus, Superman und Santa Claus im Vorbeigehen zu einer zusammenmantschkert. Mit vielen Verweisen auf Pop- und Underground Art zeigt sich Bizarro hier wieder mal als kultureller Müllschlucker, der alles, was man in ihn hineinstopft, in grotesk verzerrter Form wieder ausspuckt. Und apropos: Das Buch enthält eine krakelige Illustration aus der Feder von Dave Brockie - den meisten eher unter dem Namen "Oderus Urungus" als Frontmann der kostümierten Schockrocker Gwar bekannt. Wer je bei einem Gwar-Konzert ganz vorne stand, um sehen zu können, wie die Bandmitglieder einander die Gummigliedmaßen abhacken, und dabei von Kopf bis Fuß mit "Blut" durchtränkt wurde, wird vielleicht mit Interesse vernehmen, dass Brockie mittlerweile unter die Romanciers gegangen ist. "Whargoul" heißt sein Erstlingswerk ... und Brockie hat sich darin nicht allzuweit von seinen Lieblingsthemen entfernt.
Gwar ist irgendwie auch eine passende Überleitung zum Schwachpunkt der Anthologie: So einige Geschichten planschen in Gore und Marinarasoße herum, ohne dass dies erkennbar über den Selbstzweck hinausginge. Das lässt ein wenig den Umstand vergessen, dass das FSM selbst zwar eine Klamauk-Konstruktion ist - der Zweck dieser Konstruktion aber ein überaus ernster: Nämlich eine Argumentationshilfe im Kampf zwischen der Evolutionstheorie und dem Kreationismus, der nicht nur in den USA an Boden gewonnen hat. Da kommt es fast wie eine Erlösung, wenn Kelli Owen mit "Hot Dogma" unter Verzicht auf jegliches Genre-Element eine Episode aus einem ganz normalen Familienleben schildert. Ein christlicher Vater, eine agnostische Mutter und eine kleine Tochter in der "Warum?"-Phase, die die Frage nach der Existenz von Gott bzw. Göttern stellt - was tun? Nur zwei weitere Geschichten greifen das Evolutionsthema ebenfalls auf: "23, 28" von Kirsten Alene lebt vor allem von seiner Hauptfigur, einem wahren Feldwebel von Archäologin, die damit leben muss, dass ihre Ausgrabung mit Geldern des Bibel-TVs gesponsert wurde. Und auch in "Darwin's Revenge" von Bruce Taylor ringt ein wissenschaftlich denkender Mensch mit religiösem Lobbying. In der hochgradig vergnüglichen Geschichte treiben die VertreterInnen des "Intelligent Design" einen Museumsdirektor so sehr auf die Palme, dass er schließlich die Initiative ergreift und die Evolutionstheorie in die Praxis umsetzt.
Und es muss auch nicht um jeden Preis lustig sein. In "All Children Go To Hell" von Kevin L. Donihe erscheint das FSM einem kleinen Jungen wie der Erlkönig, um ihn erst aus seiner vertrauten Welt und schließlich aus der Welt überhaupt zu reißen. Sehr tragisch - Donihe, zu dem ich bei nächster Gelegenheit mal ein Special bringen werde, ist ohnehin das Seelchen des Bizarro-Genres. Und auch die beste Erzählung der Anthologie ist von der traurigen Sorte: In "The Holy Bowl" schildert "Punktown"-Autor Jeffrey Thomas den Alltag eines Gefangenen. Er weiß nicht, warum er inhaftiert wurde, warum er täglich gefoltert und verhört wird - und auch nicht, ob in der Nachbarzelle, mit der er verstohlene Gespräche führt, überhaupt jemand ist. Eine Geschichte von Trotz und Würde unter unmenschlichsten Bedingungen - und es sind solche Beiträge, die aus "Amazing Stories of the Flying Spaghetti Monster" in Erinnerung bleiben. Für den Rest der Anthologie gilt die unbeschwerte Empfehlung im Vorwort: This is a celebration of all things noodly, so crack open a beer and relax. Kurz: eine b'soffene G'schicht.
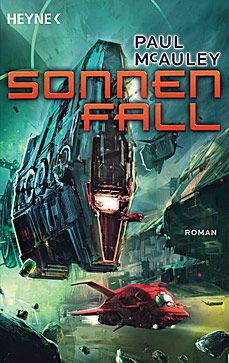
Paul McAuley: "Sonnenfall"
Broschiert, 702 Seiten, € 10,30, Heyne 2011
Hundert ermordete Schiffe umkreisten in endlosen Ellipsen den Saturn. Wer sagt, Hard-SF könne nicht poetisch sein? Gerade die Gabe, wissenschaftliche Faktentreue in kühle, aber nichtsdestotrotz schöne Dichtung umzuwandeln, macht den Reiz der Reihe, die Paul McAuley 2008 mit "The Quiet War" ("Der stille Krieg") begann, aus. Wir tauchen ein in den faszinierenden Tanz der Monde, Ringe und Raumschiffe im Sonnensystem, staunen über Fulleren-gestützte Weltraumhabitate und nanotechnologische "Biotope" aus Vakuumorganismen, wie sie die Genzauberin Avernus in ihren "Gärten" geschaffen hat. McAuley, ein wichtiger Vertreter der neuen britischen Space Opera seit den 90ern, bedankt sich im Nachwort bei sämtlichen NASA- und ESA-Missionen für die Daten, die sie geliefert haben. Im Gegenzug dafür, dass diese Daten seinen Romanen ein festes astrophysikalisches Fundament verleihen, lässt er in ihnen die Konzepte, die bislang in den Schubladen der Weltraumorganisationen schlummern, wahr werden - vom Aufbau von Weltraumkolonien bis zum Wasserstoffsammeln in den Atmosphären der großen Gasplaneten. Hut ab an dieser Stelle vor der Übersetzerin, die so manches Nachschlagewerk zu Astronomie, Biologie, Chemie und Raketentechnik bereitliegen haben musste.
"Der stille Krieg" endete mit der Annexion der Außenweltler-Kolonien auf den Jupiter- und Saturnmonden durch das aristokratische Großbrasilien und seine irdischen Verbündeten. Damit ist vorerst auch die Zeit der gesellschaftlichen Experimente, die die Außenweltler wagten, vorüber - gerade ihre Entwicklung in Richtung Transhumanismus war es ja, die die konservativen Kräfte auf der Erde auf den Plan gerufen hatte. Von einem "Krieg gegen die Evolution" ist an einer Stelle die Rede ... was den Konservativen auf lange Sicht eigentlich nichts Gutes verheißen dürfte. Erst einmal haben sie aber den Sieg davongetragen, und "Sonnenfall" (im Original 2009 als "Gardens of the Sun" erschienen) setzt unmittelbar nach seinem Vorgänger ein, um die weitere Entwicklung im Verlauf mehrerer Jahre zu schildern.
McAuley übernimmt dafür das komplette Ensemble seines ersten Romans - überraschenderweise auch den brasilianischen Kampfpiloten Cash Baker. Der schien in "Der stille Krieg" nur als Anschauungsbeispiel dafür zu dienen, was aus jemandem wird, der sein System nicht hinterfragt, sondern dessen Vorgaben in übereifriger Pflichterfüllung sogar noch übertreffen will. Doch McAuley hat mehr mit Cash vor. Mit modernster Medizintechnik dem Tod gerade noch mal von der Schaufel gekratzt, findet Großbrasilien eine neue Aufgabe für seinen Veteranen: Als vermeintlicher Kriegsheld wird er von Veranstaltung zu Veranstaltung herumgereicht, und erst ganz langsam beginnt ihm zu dämmern, dass seine neue Rolle eine genauso passive ist wie sein Pilotendasein zuvor. Vom selbstständig Denkenden ist der Weg zum Ausgemusterten und schließlich zum Widerstandskämpfer dann nicht weit. - Im Gegensatz dazu entpolitisiert sich die Genzauberin Sri Hong-Owen, vermeintliche Hauptfigur des ersten Romans, zusehends. Sie interessiert sich nur noch für die Gärten der Avernus und will ihr Vorbild um jeden Preis übertreffen. So zieht sie sich langsam von ihrer Familie und auch aus der Handlung zurück.
Wie eine Klette hängt dafür eine zunächst rein negativ geschilderte Figur an der Handlung fest: Loc Ifrahim, ein opportunistischer brasilianischer Verwaltungsbeamter, der sich um den Lohn für seine Rolle im Krieg geprellt sieht - eine unsympathische, aber interessante Figur. (Und wir wissen ja, dass Gandalf über Gollum sagte, auch er könnte noch einmal eine entscheidende Rolle spielen ...) Der genmodifizierte Ninja Dave #8 hingegen - hier nur noch der Spion genannt, weil er jeden Namen und jede Identität abgelegt hat - konnte seine Unabhängigkeit von Großbrasiliens Einsatzkommando erringen und lebt nur noch für den Gedanken, das verschwundene Außenweltler-Mädchen zu finden, in das er sich verliebt hat. Von Romantik kann hier keine Rede sein: Mit unmenschlicher Ausdauer folgt er ihren Spuren von Mond zu Mond, und als er sie schließlich findet, muss er - ein Beispiel für McAuleys realistische Herangehensweise - erkennen, dass er lediglich einer fixen Idee aufgesessen hat, für die es in der Wirklichkeit keinen Platz gibt.
Bleibt als letzte Hauptfigur und gewissermaßen als Vertreterin der Normalo-Welt die Biologin Macy Minnot, die einst unschuldig in die politischen Schachzüge vor dem Ausbruch des Krieges verstrickt wurde und nun mit der immer kleiner werdenden Schar freier Außenweltler immer weiter hinaus ins Sonnensystem flieht: vom Uranussystem zum Neptunmond Proteus und schließlich zu einem mickrigen Asteroiden, der fernab von allem durchs Sonnensystem zieht. Die stetige Verringerung von Lebensraum und Ressourcen scheint die düstere Zukunft der letzten freien Außenweltler widerzuspiegeln - doch bekanntlich ist es in der Stunde vor dem Sonnenaufgang am dunkelsten. Es liegt eine Revolution in der Luft. - Während sich also in der Rahmenhandlung die politischen Fronten im Vergleich zum komplizierten Gefüge des ersten Romans geklärt haben, laufen die Lebensgeschichten der ProtagonistInnen weit auseinander. Dahinter steckt eine klare Erzählstrategie, und McAuley legt sie an einer Stelle offen, in der sich Macy mit ihrem Ehemann darüber unterhält, wie man seinen Kindern Gutenachtgeschichten am besten erzählt: "Du musst einfach ein paar gute Figuren erfinden", sagte Macy, "und schauen, wo sie dich hinführen. Die Geschichte entwickelt sich aus dem, was sie sind und wollen, und den Problemen, die sie überwinden müssen. Es ist nicht irgendein Haufen Zeug, das ihnen passiert."
... das als Kontrast zu den Urteilen einiger LeserInnen, die in ihren Amazon-Bewertungen just von "nicht nachvollziehbaren Motivationen" oder "mangelnder Psychologie" sprechen - Kommentare, die so unfassbar danebenliegen, dass mir echt der Verstand stillsteht. Mir fällt nichts ein, was ein Roman, der selbst der strengsten Definition von Science Fiction Genüge tut, noch mehr bieten könnte. Beeindruckendes Werk.

Connie Willis: "Die Jahre des Schwarzen Todes"
Broschiert, 784 Seiten, € 10,30, Heyne 2011
Was soll ich sagen? Ich musste am nächsten Tag arbeiten gehen und hab trotzdem bis halb fünf in der Früh durchgelesen, um mir die letzten paar hundert Seiten in einem Rutsch reinzuziehen. Connie Willis ist einfach eine mitreißende Erzählerin, und hier beweist sie es mit einer Geschichte, die einen durch das ganze Gefühlsspektrum jagt: Auf Humor, der in dem Ausmaß nicht zu erwarten war, folgt Hochspannung, und die geht schließlich ins sehr, sehr Tragische über. "Die Jahre des Schwarzen Todes" ist 1992 als "Doomsday Book" im Original und 1993 zum ersten Mal auf Deutsch erschienen. Die Wiederveröffentlichung nach so langer Zeit kommt perfekt getimt in einem Jahr, in dem die US-amerikanische Autorin mit ihrem Doppelroman "Blackout/All Clear" den Hugo und den Nebula abgeräumt hat. Ein Déjà-vu: Dieser Doppelschlag glückte ihr nämlich schon damals mit dem "Doomsday Book", das überdies vor demselben Handlungshintergrund angesiedelt ist wie ihr jüngstes Werk.
In den 50ern des 21. Jahrhunderts zehrt die universitäre Geschichtswissenschaft von einer zu diesem Zeitpunkt bereits wohletablierten Forschungsmethode: Zeitreisen. So auch in Oxford, wo Willis mehrere inhaltlich verbundene, aber in sich abgeschlossene Erzählungen angesiedelt hat. In "Die Jahre des Schwarzen Todes" startet die Studentin Kivrin Engles ins Jahr 1320: Eine Premiere, und eine unter zwiespältigem Vorzeichen noch dazu. Denn bislang galt das Mittelalter als zu gefährliches Reiseziel, doch nutzt der Leiter des Fachbereichs Mediävistik den Umstand, dass er kurzfristig das Sagen hat, weil der Dekan der Uni in die Weihnachtsferien abgedampft ist. Eine Terminplanung übrigens, die noch für so manche Misslichkeit verantwortlich sein wird. So wird die Reise ohne die üblichen Vorab-Tests vom Zaun gebrochen, und prompt geht jede Menge schief. Es folgt ein Spoiler, wenn auch nicht meiner: Denn niemand, der das Buch in die Hand nimmt, kommt vor dem Lesen um die Info in Umschlag- und Klappentext herum, dass Kivrin versehentlich im Jahr 1348 landet, also mitten in der verheerenden Pest-Epidemie, die England damals heimsuchte. Ob das so weise ist, derart mit der Tür ins Haus zu fallen? Im Roman selbst vergehen über 500 Seiten, ehe dieses Geheimnis offiziell gelüftet wird - mag auch Kivrins Mentor Mr. Dunworthy (eine der Figuren, die Willis später für "Blackout/All Clear" übernehmen sollte) schon lange vorher Übles geschwant haben. Sei's drum. Diese Pestratte ist unwiederbringlich aus dem Sack, zum Glück ist das aber gar nicht mal der zentrale Aufhänger der Geschichte.
Ab Kivrins Ankunft im 14. Jahrhundert spaltet sich die Handlung gemäß den beiden Zeitebenen in zwei parallele Stränge. Kivrin kommt bei einer Landadelsfamilie unter und muss unter anderem feststellen, dass ihre peniblen Vorbereitungen auf den Trip großteils für die Katz sind, sobald das historische "Wissen" mit dem tatsächlichen Mittelalter konfrontiert wird. Willis baut hier einige nette satirische Spitzen auf den Gelehrtenbetrieb ein: So wurden Kivrin von einem Professor sämtliche Deklinationen des Mittelenglischen eingebläut und trotzdem versteht sie vor Ort zunächst einmal nur Bahnhof. Viel schlimmer wiegt jedoch der Umstand, dass Kivrin trotz aller Schutzimpfungen bei ihrer Ankunft erkrankt war und in bewusstlosem Zustand auf den Landsitz ihrer Gastfamilie transportiert wurde. Mit zunehmender Verzweiflung versucht sie in der Folge den eigentlichen Ort ihrer Ankunft - irgendwo mitten im Wald - zu eruieren, denn nur von dort kann sie wieder zurückkehren. Währenddessen mehren sich die Anzeichen, dass sich rings um sie und ihre Gastfamilie ein Verhängnis zusammenbraut. Aber auch im 700 Jahre entfernten Oxford kommt es zu unerwarteten und gravierenden Problemen: Eine Viruserkrankung (also nicht die Pest) breitet sich aus, Oxford wird unter Quarantäne gestellt und der ohnehin von der Weihnachtslähmung befallene Uni-Betrieb kommt endgültig zum Erliegen. Und mit ihm leider auch alle Hoffnungen Dunworthys, Kivrin schnell in die Gegenwart zurückzuholen. In der Folge wird es nicht nur darum gehen, wie sich eine Epidemie bei unterschiedlichem medizintechnischen Entwicklungsstand auswirkt, sondern auch darum, wie die beiden Krankheitswellen zusammenhängen könnten.
Bevor's an die verdiente Lobhudelei geht, noch eine kurze Anmerkung: Technische Aspekte interessieren Willis wenig bis gar nicht. Gerade einmal zwei Elemente einer Zukunftstechnologie kommen vor, und beide bleiben eher schwammig beschrieben: Zum einen das Netz, mit dem man durch die Zeit geschickt wird, und das auf irgendeine nicht näher genannte Weise selbsttätig dafür sorgt, dass man nirgendwo landen kann, wo man ein Zeitparadoxon auslösen könnte - wie in vielen anderen SF-Erzählungen gilt also auch hier das Selbstkonsistenzprinzip. Zum anderen der Übersetzer, der Kivrin implantiert oder injiziert wurde und sie bei der Verständigung mit den Einheimischen unterstützen soll. Meistens scheint Kivrin seine Übersetzungsvorschläge wie eine innere Stimme zu hören, was auf ein künstlich erzeugtes Subprogramm ihres Bewusstseins hindeutet. Mal scheint der Übersetzer aber auch ohne ihr Zutun anderen Menschen zu antworten - wurde ihr auch ein Lautsprecher eingebaut? Egal, ein Hard-SF-Autor hätte dies sicher schlüssiger beschrieben, aber Willis konzentriert sich eben lieber aufs Menschliche. Und es passt auch irgendwie zur sympathisch unvisionären Schilderung einer Zukunft, die in keinster Weise mit Gadgets klotzt. Ganz wie heute auch fährt man hier Fahrrad und ärgert sich über Regenschirme, die sich nicht zusammenklappen lassen. Detail am Rande: Im Jahr 2054 sind die ProtagonistInnen ständig auf der Suche nach einem Festnetzanschluss - das Buch wurde eben kurz vor der Handy-Revolution geschrieben.
Was "Die Jahre des Schwarzen Todes" von Anfang an auszeichnet und trotz beträchtlicher Romanlänge niemals Langeweile aufkommen lässt, ist der Humor. Eine Landstraße, hatte es geheißen, aber so sah sie nicht aus. Was vor ihr lag, war noch nicht einmal eine Straße. Eher ein Fußweg. Oder ein Weideweg für Rinder. Dies also waren die Fernstraßen im England des 14. Jahrhunderts, die den Handel förderten und Horizonte erweiterten, konstatiert Kivrin bei einer der zahlreichen Kollisionen von Schulbuch-Phrasen mit der Wirklichkeit. Leise und trocken ist der Humor aber nicht immer, im Gegenteil: In der Quarantänezone Oxford geht es geradezu turbulent zu, und wie so oft setzt Willis hier vor allem auf egozentrische Verhaltensweisen, um Situationskomik zu erzeugen. Für Running Gags sorgen unter anderem Dunworthys Assistent, der einen Warenengpass nach dem anderen bejammert, oder die überfürsorgliche Mutter eines Studenten, wenn sie wie eine Harpyie über arme Epidemie-Opfer herfällt und sie mit aufbauenden Bibelstellen über Tod und Pestilenz malträtiert. Angereichert wird das burleske Gewimmel zudem um Uni-Gelehrte, die derart auf ihre Fachinteressen fixiert sind, als wären sie direkt aus Jonathan Swifts Laputa zur Erde gestürzt, und die Krone setzt ihm ein in Oxford gestrandetes Ensemble von Handglockenspielerinnen aus den USA auf. Armer Dunworthy, und er muss versuchen, da irgendwie Struktur reinzukriegen!
Das ist ausgesprochen vergnüglich zu lesen, und umso schwerer fällt der Schlag in den Magen aus, wenn die Ereignisse auf beiden Zeitebenen einen dramatischen und auf einer davon sogar einen erschütternden Verlauf nehmen. Im Bild einer Kuh, die verzweifelt nach jemandem sucht, der sie melkt, führt Connie Willis schließlich das absurd-komische und das todtraurige Element ihrer Erzählung in grandioser Weise zusammen - eine der vielen vermeintlichen Nebensächlichkeiten, vor denen der Roman geradezu überquillt und die ihn so überaus lebendig machen. Willis balanciert geschickt Details, deren Bedeutung erst später erkennbar wird, mit solchen aus, die einfach nur die Zufälligkeiten des Lebens widerspiegeln. (Ein Gegenbeispiel wären die platten Erzählstrukturen von Soaps, wo wirklich nichts ohne Ausrichtung auf einen künftigen Handlungsstrang passiert. Wenn da mal einer scheinbar zufällig stolpert, kann man gleich Wetten darauf abschließen, wieviele Folgen später ein Gehirntumor diagnostiziert wird, der Gleichgewichtsstörungen auslöst ...) Das gibt in Summe Science Fiction ohne allzuviel Science, aber dafür mit umso mehr Erzählkunst. Wer "Die Jahre des Schwarzen Todes" also bislang noch nicht gelesen hat: Es lohnt sich!
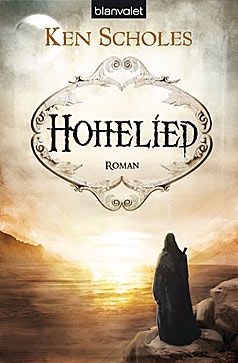
Ken Scholes: "Hohelied"
Broschiert, 542 Seiten, € 15,50, Blanvalet 2011
"Vater, ich erkenne meinen Weg nicht mehr", stöhnt Zigeunerkönig Rudolfo an einer Stelle in "Hohelied". Kein Wunder, denn auch im dritten Teil der fantastischen "Psalms of Isaak"-Reihe hat nur ein einziger den Faden, der aus der labyrinthischen Handlung führt, in der Hand: Ken Scholes, der Autor selbst. Und hier zeigt sich auch die Qualität seines Masterplans. Des Rätsels Lösung kommen wir nämlich nicht linear, von Station zu Station, von Horkrux zu Horkrux, näher. Stattdessen lüftet sich der Schleier überall in den Benannten Landen und darüber hinaus zur gleichen Zeit. Es ist also nicht die typische Schnitzeljagd-Fantasy, sondern ähnelt einem Rätselbild, bei dem der Verzerrerfilter Schritt für Schritt zurückgeschaltet wird, bis sich die Konturen herausschälen.
Diese Erzählstrategie hat auch eine entscheidende Bedeutung für die Mitglieder des mittelgroßen - und innerhalb der Gesamthandlung gleichberechtigten - Ensembles. Jeder sieht nur ein kleines Stück des Gesamtbilds, für jeden nimmt die historische Veränderung, die in den Benannten Landen gerade stattfindet, daher ein ganz unterschiedliches Gesicht an. Rudolfo beispielsweise sieht sein Waldkönigreich bedroht - unter anderem durch die benachbarten Sumpflande, in denen die neue Königin Ria ein religiös verbrämtes System mit eindeutigen Expansionsgelüsten etabliert hat. Trotzdem sieht sich Rudolfo genötigt, Frau und Kind in Rias Obhut zu geben, weil Unbekannte seiner Familie nach dem Leben trachten. Für Rudolfo resultiert dies in einem tiefsitzenden Gefühl von Machtlosigkeit; verschlimmert noch dadurch, dass er es hinnehmen muss, wie sich sein traditionell freimütiges Reich in den neuen, raueren Zeiten verändert. Ein Heer und ein Geheimdienst werden aufgebaut; undenkbare Vorgänge bislang. Das Mädchen Winters hingegen, die rechtmäßige Königin der Sumpflande, versteht die neue Lage immer mehr als persönliche Herausforderung. Für sie geht es nun darum, ihrer aus dem Nichts aufgetauchten angeblichen Schwester Ria die Macht wieder zu entreißen und ihrem Volk seine eigentliche Kultur, vor der Ausbreitung der neuen Religion, zurückzugeben. Eine sehr zielorientierte Perspektive, die Winters vom Opfer zur Akteurin reifen und sie erwachsen werden lässt.
Den persönlichsten Blickwinkel von allen hat der Junge Neb, der auch weitab von den übrigen Schauplätzen agiert. Scholes hat Neb - ohne ihn aber deswegen zur Hauptfigur zu machen - für eine Rolle vorgesehen, die nur er allein ausfüllen kann, eine Art Katalysator für den bevorstehenden Wandel der Welt. Neb nimmt dieses Schicksal an und wächst zur metaphysischen Gestalt heran. Stichwort Wandel: Dass die Welt sich im Verlauf der Jahrtausende mehrmals drastisch verändert hat, wurde bereits in den Vorgängerbänden "Sündenfall" und "Lobgesang" angedeutet. In "Hohelied" dringen wir erstmals - und buchstäblich - in tiefere Schichten vor und sehen, dass die Fundamente der gegenwärtigen Kultur auf den Resten einer vergangenen Zivilisation ruhen, wie es diese wiederum mit noch älteren tun. Für zwei Protagonisten, den abgedankten Androfranziner-Papst Petronus und den Patriarchen Vlad Li Tam, hält Scholes in "Hohelied" die Rolle von Entdeckungsreisenden bereit. Nachdem sie in den bisherigen Büchern ihre jeweilige persönliche Katharsis erleben mussten und ihre Rollen als politische Strippenzieher ein für alle Mal verloren haben, werden sie nun an den äußeren Rändern des großen Rätselbildes tätig. Und stoßen dabei auf die gigantischen Hinterlassenschaften einstiger Supertechnik, sei es ein Behemoth genanntes Unterwasserfahrzeug oder die bis zum begrünten Trabanten führende Mondleiter.
Rudolfos Frau Jin Li Tam, samt Sohn im sicheren, wenn auch verstörend fremdartigen Exil an Rias Hof, hat Scholes in den ersten Romanen als nüchterne, politisch denkende Figur eingeführt. Und genauso beurteilt sie zunächst auch die Lage: Der neue Kult in den Sumpflanden scheint nur ein Instrument der weltlichen Macht zu sein, etwas, das eine Invasion vorbereiten helfen soll, eine rein politische Gefahr also. Wie alle rational denkenden Figuren in den "Psalms of Isaak" muss Jin aber allmählich erkennen, dass diese weltliche Sicht das Gesamtbild nicht mehr erfassen kann. Die von Ria praktizierte Blutmagie ist nicht nur ekelerregend gewalttätig (und noch ekelerregender eingebettet in religiöses Nächstenliebe-Gesäusel), sie wirkt. Und zeigt damit, dass die Welt auf einen sehr viel fundamentaleren Wandel zusteuert als nur einen Machtwechsel zwischen Herrscherhäusern.
Anlässlich der Vorgängerbände habe ich Scholes' Saga schon mit George R. R. Martins "Lied von Eis und Feuer" verglichen, mit "Dune" und Gene Wolfes "Buch der neuen Sonne". Aber noch ein klassisches Werk drängt sich geradezu auf: Nämlich Jack Vances "Dying Earth"-Zyklus, angesiedelt in einer fernen Zukunft, in der Magie die wissenschaftliche Anwendung der Naturgesetze als Wirkprinzip abgelöst hat. Kurzer Tipp zwischendurch: Vor einem Jahr ist die Anthologie "Songs of the Dying Earth" erschienen, in der AutorInnen von Neil Gaiman bis zu Robert Silverberg Vances Universum durch neue Geschichten huldigten. Außerdem hat der kanadische Autor Matt Hughes bereits einige Romane (inklusive "Majestrum") veröffentlicht, die als Quasi-Vorgeschichte in ebendieser Übergangsphase von Wissenschaft zu Magie angesiedelt sind. Und genau das scheint auch Scholes' Welt bevorzustehen: Petronus' Androfranziner-Orden hatte die äußerliche Organisationsform einer Religion angenommen, in Wahrheit aber für Vernunft, Wissenschaft und Empirie (vereint unter der Licht-Metapher) gestanden. Mit der Zerstörung des Ordenszentrums im ersten Band begann der Wandel, dem die Romanfiguren nun ihre Erwiderung (im Original heißt der Roman "Antiphon") entgegenhalten müssen. Und war ihnen der Feind bislang immer einen Schritt voraus, so können sie nun sogar erste Erfolge verbuchen.
Es wird überaus spannend sein zu sehen, wie Scholes' Saga weitergeht. Wird nur leider ein wenig dauern: Im Moment ist Scholes noch damit beschäftigt, den vierten Band ("Requiem") fertigzustellen, ein fünfter ist angekündigt.

Harald Giersche (Hrsg.): "Prototypen und andere Unwägbarkeiten"
Broschiert, 208 Seiten, Begedia 2011
Die jüngste Ausgabe seiner noch kurzen Anthologie-Reihe "phantastic episodes" hat der Begedia-Verlag unter das Motto "Prototypen" gestellt, und solche begegnen uns hier in Form von Kernfusionsreaktoren, Zeitmaschinen, Waffen, Androiden, Mutanten mit nützlichen Eigenschaften und vielem mehr. Nicht dass sich alle AutorInnen sklavisch an die Stichwort-Vorgabe halten würden (wäre ja auch langweilig), aber insgesamt lassen sich die 15 Beiträge (nanu, am Cover steht 14?) gut unter dem Titel subsumieren und fächern dennoch ein breites Themenspektrum auf. In der AutorInnenliste tauchen von Uwe Post über Heidrun Jänchen bis zu Nina Horvath viele bekannte Namen auf, denen man in deutschsprachigen SF-Anthologien immer wieder begegnet - was zugleich eine ungefähre Vorabeinschätzung der Qualität ermöglicht.
Das gilt zum Beispiel auch für den Hamburger Frank Lauenroth, der mit "Goldene Zeiten" eine sehr klassische SF-Kurzgeschichte vorlegt, die ganz auf eine originelle Ausgangsidee als Zentrum setzt. Im konkreten Fall ist das ein neuartiges Gewehr, das zeitversetzt schießt und somit dem Schützen eine Frist einräumt, seinen Kram zusammenzupacken und vom Tatort zu verschwinden, ehe seine Kugel ins Ziel trifft. Daraus entwickelt sich ein vergnügliches Katz-und-Maus-Spiel zwischen einem Attentäter und einem FBI-Agenten mit gelungener Schlusspointe. Im Vergleich dazu kann Nicklas Peineckes Idee für "300 PS intravenös" schon auf eine längere Genregeschichte zurückblicken, die von Philip K. Dicks Theodorus-Nitz-Werbemaschinen in "Simulacra" bis zu den schrecklichen Spamtauben in Uwe Posts "Symbiose" reicht: Kleine Quasi-Organismen, die ihre Umgebung mit Werbebotschaften beschallen - bei Peinecke injizieren sie diese sogar per Insektenstich und bringen damit den Protagonisten aus dem seelischen Gleichgewicht.
Dicks Infragestellen von Identitäten könnte auch durchaus Pate für "Die Reise" des Anthologie-Herausgebers Harald Giersche gestanden haben: Sein Ich-Erzähler folgt einer gewissen Julie bis zum Mars - scheint eine Liebesgeschichte zu sein, ist es aber nicht, denn vor allem beschäftigt den Protagonisten das Gefühl, dass er sich von den Menschen um ihn herum unterscheidet. Zu Recht, wie sich zeigen wird. Auch die einsame Überlebende einer globalen Katastrophe in Miriam Pharos "Der Junge" ist nicht das, was sie zu sein glaubt. Als sie auf einen weiteren Menschen trifft, nimmt die Begegnung daher eine unerwartete Wendung. Verwüstet ist die Erde auch in der bösen Erzählung "Handlungsreisende" von Thorsten Küper. In Kältekapseln verlassen die Richniks der globalen "Corporation" samt Anhang die alte Heimat Richtung Kolonialhabitate - 184 Tonnen schockgefrosteter Geldadel in den Augen derer, die im Orbit schon auf sie warten. Und noch eine zweite Geschichte handelt vom globalen Exodus: "Der Tag der Zikade" des Österreichers Lucas Edel mag rein raumfahrttechnisch eher der 50er-Jahre-SF als dem zuvor vorgestellten "Sonnenfall" Paul McAuleys nahestehen, zeichnet aber ein schönes melancholisches Stimmungsbild. Im Mittelpunkt steht mit dem letzten "Wächter" im Sonnensystem jemand, der niemandem einen Gefallen abschlagen kann und dementsprechend am Ende buchstäblich übrig bleibt. Der vermeintlich liebevolle Schlusssatz bekommt dadurch eine außerordentlich zynische Note.
Nah an der Realität hat Merlin Thomas seine Erzählung "Wunschkind" angesiedelt. Darin können angehende Eltern unter dem Motto "Präkonzeptiv investieren - postnatal sparen" simulierte Begegnungen mit ihren künftigen Designer-Babys absolvieren. Sehr gute Idee, auch wenn sie noch ein Mehr an Atmosphäre vertragen hätte können. Generell sind die Geschichten hier meist so kurz, dass ein Ideen-bezogener Plot besser kommt als einer, der auf Stimmung setzt. Christian Endres' "Das erste Orakel" etwa, in dem ein Forscher besessen nach ebendiesem sucht, wirkt ein wenig so, als hätte man für eine Minute in einen Film hineingezappt und gerade noch den Cliffhanger vor der nächsten Werbepause mitbekommen. Zwar nicht unvollständig, aber jederzeit gerne erweiterbar ist "Die Isolierbox" der Jenaer Autorin und Herausgeberin Heidrun Jänchen ("Simon Goldsteins Geburtstagsparty"). Im Zentrum ihres Beitrags stehen der 17-jährige Ben und seine Brüder - Mutanten allesamt, die in einer De-facto-Gefangenschaft leben und im Auftrag einer militärisch-wissenschaftlichen Organisation Behälter aus verstrahlten Zonen evakuieren. Zum Hintergrund der Handlung bleiben einige Fragen offen - könnte also Teil eines Romans sein, den ich gerne lesen würde.
Wie in jeder Anthologie überzeugen manche Beiträge mehr, manche weniger; erfreulicherweise wird aber kein einziger davon komplett in Grund und Boden gefahren. Die drei, die neben Lauenroths "Goldene Zeiten" am prägnantesten in Erinnerung bleiben, illustrieren zugleich die Breite des Themenspektrums. "Das Leuchten in der Ferne" von Dirk Ganser macht anfangs noch einen idyllischen Eindruck: Kurz vor Weihnachten sieht der junge Adam ein "poetisches" Leuchten am Himmel. Doch wenn er sich aus seinem Dorf in die verlassene Stadt, deren Grenze er bewachen soll, aufmacht und dort einige ihm unverständliche Rituale absolvieren muss, erkennen wir in diesen rasch Strahlenschutzmaßnahmen. Es stellt sich die alte Frage, ob es notwendig ist, die Perspektive der Hauptfigur zwischendurch zu verlassen, um einen Absatz einzufügen, der das Geschehen in einen erklärenden Gesamtüberblick rückt (ich persönlich bin da kein Fan von), aber immerhin nutzt der Autor diese Passage, um einen zusätzlichen Aspekt der Grausamkeit einzubauen. So berührend die Suche Adams nach seiner Kollegin Natascha ist, so klug führt die Wiener Autorin Nina Horvath ihre Geschichte "Die Duftorgel" zu Ende: Auf einem fremden Planeten hat die Forscherin Ieva ein Instrument gebastelt, mit dem sie sich den einheimischen Insekten, die mit Düften kommunizieren, verständlich machen kann. Mit ihrer Duftorgel schafft sie es sogar, einen gestrandeten Kollegen aus der Umzingelung der Planetenbewohner zu retten. Während sich die beiden auf den langen Rückweg zu ihrem Basiscamp machen, scheint die Chemie zwischen den beiden Menschen in den Vordergrund zu rücken und vielleicht sogar als Echo auf die Duft-Kommunikation gemeint zu sein - stattdessen aber zaubert Horvath eine ebenso folgerichtige wie unerwartete Schlusspointe aus dem Hut.
Und dann ist da natürlich noch Uwe Post, der wirklich immer Unterhaltung garantiert. In "Träumen Bossgegner von nackten Elfen?" kann er seinen skurrilen Humor sogar austoben, ohne gegen die Gesetze der Realität verstoßen zu müssen - wir befinden uns nämlich im virtuellen Raum. Entsetzt müssen die martialischen Avatare dreier Nerds erleben, wie in ihre düstere Fantasy-Spielwelt MAGEDAWN etwas gänzlich Inkompatibles eindringt: "HAPPYLIFE, die fröhliche Casual-Welt!" Während Fledermäuse ziellos unter der neuen Smiley-Sonne kreisen und höllische Bestien die Gestalt regenbogenfarbener Pudel annehmen, begeben sich die drei auf die Queste nach dem dahintersteckenden Bug. Langsam drehte sich der Zwerg um. Ließ den Blick schweifen, über die Sümpfe von MAGEDAWN und die Hutgeschäfte von HAPPYLIFE. Herrlich.
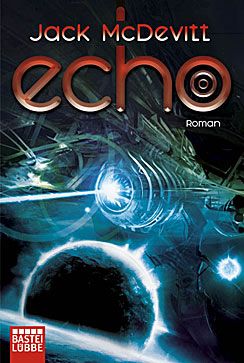
Jack McDevitt: "Echo"
Broschiert, 527 Seiten, € 10,30, Bastei Lübbe 2011
"Echo" ist der fünfte Roman aus Jack McDevitts preisgekrönter "Alex Benedict"-Reihe, in der der gleichnamige Protagonist - ein interstellarer Antiquitätenhändler und Hobby-Detektiv - jedes knifflige Rätsel löst ... bis auf ein einziges: Nämlich warum es nicht "Chase Kolpath"-Reihe heißt. Die Berufspilotin Chase fungiert schließlich nicht nur als Alex' Assistentin, sondern auch als Ich-Erzählerin der Romane. Und wir bleiben sogar dann bei Chases Perspektive, wenn sich die Wege der beiden Hauptfiguren vorübergehend trennen. Das Mysterium der Namenspatenschaft bleibt zwar auch in "Echo" (im Original 2010 unter dem gleichen Titel veröffentlicht) ungelüftet. Ansonsten demonstriert der "Nebula"-nominierte Roman aber dasselbe Geschick des Autors im Verweben von Krimi- und SF-Plots, das dieser schon in "Das Auge des Teufels" bewiesen hatte. Die fiktive Zukunftswelt dient hier nicht einfach nur als bunte Kulisse, vor der ein ganz "altmodisches" Verbrechen aufgeklärt wird - der Kriminalfall selbst ist von einer Art, die es nur in einer solchen Welt geben kann. Im konkreten Fall geht es um die Suche nach außerirdischen Intelligenzen.
Zur Handlung: Bei einer Online-Auktion sticht Alex ein Stein mit unbekannter Inschrift ins Auge. Ist das Artefakt etwa nicht-menschlichen Ursprungs? Das wäre eine Sensation, denn während sich die Menschheit im Verlauf mehrerer Jahrtausende über den Orion-Arm der Milchstraße ausgebreitet hat, ist sie nur ein einziges Mal auf intelligente Aliens gestoßen (diese Stummen bzw. Ashiyyur scheinen aber aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich zu zählen; warum, darauf wird in "Echo" nicht eingegangen ... man hat sich einfach an sie gewöhnt). Ansonsten finden sich in den Weiten der Galaxis nur die Relikte einer menschlichen Kolonialisierungswelle nach der anderen. Es türmt sich Kultur über Kultur - ein Paradies für jeden Antiquitätenhändler.
Wie Alex bei seinen Recherchen herausfindet, war der Stein einst im Besitz des mittlerweile verstorbenen Forschers Sunset Tuttle, der sein Leben der Suche nach Außenweltlern verschrieben hatte und ob dieses scheinbar sinnlosen Unterfangens als Lachnummer in die Geschichte einging. Allerdings stoßen Alex und Chase bald auf Hinweise, dass Tuttle am Ende seines Lebens - knapp drei Jahrzehnte vor der Romanzeit - tatsächlich fündig geworden sein könnte. Wie wir dem Prolog entnehmen können, machte Tuttles Freundin Rachel Bannister, ebenfalls eine Berufspilotin, damals eine Entdeckung, die ihr Entsetzen einflößte. Dementsprechend sträubt sie sich dagegen, dass der Fall nun noch einmal aufgerollt werden soll - und Alex & Chase stoßen zum ersten Mal an ihre Grenzen. Ohnehin stehen sie in akademischen Kreisen im Ruf, professionelle "Grabräuber" zu sein. Nun aber, da sich vor allem Alex in die Aufklärung von etwas verbeißt, das vielleicht besser in Vergessenheit bleiben sollte, sehen sie sich selbst zunehmend ins Zwielicht gerückt und dazu genötigt, ihre Rolle als Detektiv-Duo ohne Auftrag zu hinterfragen. Es kommt zum Bruch zwischen den beiden - und da die komplizierte Chemie zwischen Chase und Alex so sehr im Vordergrund steht, hat man fast schon den Mordanschlag vergessen, der früh im Roman auf die beiden verübt wurde. Bis es zu einem zweiten Attentat kommt.
Mehr sei zur Handlung nicht gesagt, kommen wir stattdessen noch einmal zum Stichwort "SF-Kulisse" zurück. Jack McDevitt konstruiert wie gesagt Fälle, die untrennbar mit dem SF-Setting verbunden sind - im ersten Benedict-Roman "A Talent for War" ("Die Legende von Christopher Sim") ging es beispielsweise darum, wie der Erstkontakt zwischen Menschen und Stummen tatsächlich ablief und warum die offizielle Geschichtsschreibung ein ganz anderes Bild zeichnet. Kulissenhaft könnte man freilich das Setting selbst nennen; nur wenn man böse sein will allerdings. Offiziell befinden wir uns ja knapp 10.000 Jahre in der Zukunft, tatsächlich aber fühlt es sich sehr nach Gegenwart bzw. eher sogar jüngerer Vergangenheit an: Da gibt es Talkshows und Touristen-T-Shirts mit interstellaren Entsprechungen von Aufschriften à la "There are no Kangaroos in Austria" & Co, da trägt man exotische Namen wie Peggy oder Betty Ann und wechselt von Mary's Bar & Grill in Will's Café, um sich dort zwischen Kirschkuchen und Schokoladenpudding zu entscheiden. Versetzt wird das Ganze mit Elementen, die Zukunftsvisionen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts entsprungen sein könnten - sei es der Freizeitsport Aeroball mit wechselnden Schwerkraftfeldern, seien es Reisebüroangebote wie "Schwören Sie sich ewige Treue im Ringsystem von Große Pracht VI! Feiern Sie die Bar Mizwa im Licht der Mondtriade!". Kurz: Es ist eine bunte Googie-Welt, angesiedelt irgendwo zwischen Russ Mannings "Magnus"-Comics und Bruce McCalls satirischem Bildband "The Last Dream-o-Rama".
Größere soziale Probleme scheint McDevitts Zukunft nicht zu kennen, zudem fällt ein hoher Grad an ehrenamtlichen Tätigkeiten auf (die meisten Romanfiguren engagieren sich in einer großen Bandbreite von karitativen Organisationen bis zu Amateurtheatergruppen). In Summe ergibt das eine idealisierte Form der westlichen Dienstleistungs- und Freizeitgesellschaft des späten 20. Jahrhunderts - mit Überlichtflug. "To boldly go where no man has gone before" bedeutet hier nicht mehr als eine Richtung einzuschlagen, die zufällig noch niemand anderer genommen hat. Wenn Alex und Chase nonchalant zwischen Sonnensystemen herumjetten, dann hat dies absolut nichts mit einer physikalischen Limits unterworfenen Raumfahrt zu tun, wie Paul McAuley sie in "Sonnenfall" beschreibt - umso mehr dafür mit dem Gedanken uneingeschränkter und unbeschwerter Mobilität, wie er uns lange Zeit als gesellschaftliches Ideal eingebläut wurde. - Das alles ist Lichtjahre entfernt von den fremdartigen zukünftigen Gesellschaften eines Charles Stross oder Hannu Rajaniemi und wohl in erster Linie dem Alter des Autors geschuldet (Jack McDevitt ist heuer süße 76 geworden) - allerdings keineswegs etwas, das den Unterhaltungswert seiner Romane schmälert. Im Gegenteil: Das Retro-Flair verleiht McDevitts Romanen noch eine Extrawürze. Und auch diesen hier kann ich wieder guten Gewissens empfehlen.

Chan Koonchung: "Die fetten Jahre"
Gebundene Ausgabe, 298 Seiten, € 20,60, Eichborn Verlag 2011
"Wir alle fühlten uns in einem Rausch der Einheit und Harmonie verbunden." Das ist ein Satz, der in dieser oder ähnlicher Form zigmal in Chan Koonchungs Roman "Die fetten Jahre" fällt. Glücklich bis zum Anschlag, wie es eine Prostituierte später formulieren wird, taumeln uns die neureichen BewohnerInnen Pekings auf den ersten Seiten entgegen. Und wer könnte es ihnen verdenken? Während der Rest der Welt in einer tiefen wirtschaftlichen Depression versunken ist, hat für China das Neue Goldene Zeitalter begonnen. Wir befinden uns nur einen Katzensprung in der Zukunft ... und mit Blick auf die aktuellen Warnrufe von IWF-Chefin Christine Lagarde vielleicht sogar noch näher, als Koonchung es beschreibt.
Wie schon in beispielsweise Gary Shteyngarts "Super Sad True Love Story", Frank Schätzings "Limit" oder Jörg-Uwe Albigs "Berlin Palace" zu unterschiedlichen Graden ausgearbeitet, ist auch hier das 21. Jahrhundert ein chinesisches. Mit dem Journalisten und mehrjährigen Greenpeace-Vorstandsmitglied Chan Koonchung folgt auf die genannten westlichen Titel nun also so etwas wie eine Innenperspektive. Oder wenigstens eine halbe, denn der in Hongkong aufgewachsene Autor wahrt stets eine gewisse Restdistanz zum "Festland", die er auf seine Hauptfigur, den ehemaligen Bestsellerautor Chen, überträgt und diesen daher aus Taiwan kommen lässt.
Klar, dass das Paradies seine Schattenseiten hat. Von der Neunzig-Prozent-Freiheit ist die Rede, was im Internet oder im Druck nicht ins Bild passt, wird wegharmonisiert. Doch das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, sitzt tiefer. Warum sind eigentlich alle so glücklich? Etwa aus demselben Grund, warum Chen kein Stoff mehr für ein neues Buch einfallen will? Und hängen damit vielleicht auch die drückenden Kopfschmerzen zusammen, die ihn befallen, wenn er in der Buchhandlung von der Trivialliteratur zum Regal mit Politik und Philosophie gehen will? Das Geheimnis vertieft sich, als der weitgereiste Querdenker Fang Caodi, ein Bewunderer Chens, davon raunt, dass ein ganzer Monat aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden sei - gerade einmal zwei Jahre würden die verlorenen 28 Tage zurückliegen.
Die von den drakonischen Strafen des chinesischen Systems angewiderte Ex-Juristin Xiaoxi, eine alte Bekannte Chens, schlägt in dieselbe Kerbe - sie kann den seit zwei Jahren anhaltenden Glückstaumel nicht mehr ertragen. Und weil Chen ganz unerwartet bemerkt, dass er auf sie steht, beginnt er sein Urteilsvermögen, von dem er doch so überzeugt war, in Frage zu stellen. Derart auf den Handlungskern heruntergebrochen, liest sich das wie ein klassischer Genre-Roman: Einer hinterfragt das System, einer ist mit dem Status quo eigentlich ganz zufrieden und lässt sich nur dem anderen zuliebe mitreißen, und gemeinsam machen sie sich an des Rätsels Lösung.
Von dieser Art Roman ist "Die fetten Jahre" allerdings meilenweit entfernt; die vermeintlich genretypischen Elemente treiben nur als Einsprengsel in einem wahren Strom von Informationen. Fiktive Daten aus der Zukunftshistorie bilden dabei nur das letzte Glied einer sehr, sehr langen Kette an hierzulande wenig bis gar nicht bekannten Namen und Ereignissen aus der jüngeren chinesischen Geschichte - und das zu lesen kann durchaus fordern. Vielleicht ist dies der richtige Zeitpunkt, um anzumerken, dass man sich gar nicht unbedingt so sehr auf China fixieren muss und den Roman auch ein wenig abstrakter bzw. allgemeingültiger betrachten könnte. Eine Gesellschaft, die sich selbstgefällig in ihren wirtschaftlichen Erfolgen sonnt und dabei von einer Total-Amnesie in Sachen dunkle Flecken der eigenen Vergangenheit befallen ist ... sowas gab's auch mitten in Europa einmal. Wirtschaftswunder hieß das damals.
Es gibt einige wunderbare Stellen in "Die fetten Jahre". Etwa die herrlich paradoxen Zehn Leitgedanken für das Neue Goldene Zeitalter oder Chens selbstbetrügerische Gedankenschleife: Erst wenn ich vergessen hatte, würde ich die neuen Themen und Anregungen finden, über die ich schreiben wollte. Und wenn ein hoher Staatsbeamter die Umgestaltung Chinas ausgerechnet unter den Projektnamen Plan des Himmlischen Friedens stellt, dann kommentiert sich das mit Blick auf den Juni 1989 selbst. Auf der anderen Seite steht die gewöhnungsbedürftige Erzählstruktur. Waren es im ersten Romandrittel ausschweifende biografische Angaben zu den Charakteren, in denen die Handlung der Romangegenwart ins Stocken kam, so mutiert die Erzählung im letzten Teil durch einen langen Monolog zum Essay. Deshalb ist "Die fetten Jahre" zwar unbestritten ein sehr kluges Buch, aber irgendwie auch nicht Fisch noch Fleisch.

Mark Hodder: "The Strange Affair of Spring Heeled Jack"
Broschiert, 371 Seiten, Pyr 2010
Jack the Ripper kennen alle, Spring Heeled Jack - hierzulande zumindest - nicht ganz so viele. Auch das war ein Schurke, der im viktorianischen England sein Unwesen trieb. Berichten zufolge handelte es sich um einen kostümierten Mann mit glühenden Augen, der mit känguruartigen Sprüngen auf Frauen losstürzte, um ihnen mit seinen Klauen die Kleider vom Leibe zu reißen. Da der Übeltäter mit den Sprungstiefeln nie gefasst wurde, ranken sich seitdem unzählige Mythen um ihn und haben ihn zur popkulturellen Ikone gemacht. Den vielleicht originellsten Erklärungsversuch dürfte "Primeval" für sich verbuchen können. Wer sich nicht erinnert - das war die britische TV-Serie, in der Portale zwischen den Erdzeitaltern aufgehen und unzählige ausgestorbene - und natürlich ausschließlich gefährliche - Tiere das tun, was Tiere eben tun, wenn sie vor sich ein grelles Lichtphänomen aufstrahlen sehen: Sie stürzen sich sofort rein und gelangen in unsere Gegenwart, um dort männliche Statisten abzuschlachten und sich bei den weiblichen so lange Zeit zu lassen, bis diese gerettet werden können (im britischen Fernsehen verhalten sich eben auch die Monster gentlemanlike). In "Primeval" war Spring Heeled Jack ein Raptor aus der Kreidezeit - aber das, was der in Spanien lebende Engländer Mark Hodder in seinem Debütroman als des Rätsels Lösung anbietet, kann sich auch sehen lassen. Großartige Geschichte, das gleich vorneweg.
Um ein potenziell gefährliches Mysterium aufzuklären, braucht es einen echten Mann der Tat - und den muss man nicht einmal erfinden, denn wer bitteschön könnte den Job besser erledigen als Richard Francis Burton; Entdecker, Abenteurer, Schriftsteller, Skandalnudel und Ubermensch schlechthin. Den hatte ja schon Philip José Farmer aus gutem Grund zur Hauptfigur seiner "Flusswelt"-Reihe gemacht. Athletisch, hochintelligent, bombig aussehend und charismatisch, so führt ihn auch Hodder augenzwinkernd ein - zu Beginn dürfen wir uns mit Burton angenehm schaudernd an eine Episode erinnern, in der ihm ein Speer durchs Gesicht gestoßen wurde ... den er nur mehr rausbekam, indem er den Speerschaft in voller Länge durch die Wunden zog. Burton war eben der härteste Hund des viktorianischen Zeitalters - auch wenn wir bald feststellen, dass er mit dem Begriff "viktorianisch" mangels einer Viktoria gar nichts anfangen kann. - Als Kontrastprogramm wird Burton ein komischer Sidekick bzw. Assistent in Form des dürren kleinen Poeten Algernon Charles Swinburne zur Seite gestellt; ebenfalls eine historische Figur. Ein kindliches Gemüt und eine lustvoll masochistische Ader prädestinieren "Algy" geradezu für gefährliche Abenteuer.
Als Erzählung hat "The Strange Affair of Spring Heeled Jack" die Form einer Eskalation in mehrfacher Hinsicht - bis hin zum finalen und herrlich absurden Showdown. Nicht nur für die Romanfiguren wird das Geschehen immer turbulenter, auch wir LeserInnen werden zunächst sanft in eine Welt des 19. Jahrhunderts eingeführt, die erst nach und nach zu etwas Fremdartigem verschwimmt. Zunächst einmal weichen nur ein paar Details vom uns bekannten Geschichtsverlauf ab; die dürften den meisten noch nicht einmal auffallen. Burton steht da gerade vor der großen Debatte mit seinem Gegenspieler John Hanning Speke, mit dem er einst nach der Quelle des Nils gesucht hatte. Doch die entfällt, weil Speke - wie in unserer Welt, bloß drei Jahre früher - einen Unfall(?) mit seinem Gewehr erleidet. Burton langweilt sich, und hier fließt ein Quantum Sherlock Holmes ein: Ohne neue Herausforderung driftet Burton ziellos durch den Tag und schwebt in Gefahr den Drogen zu verfallen - da kommt ein Angebot des Königs (richtig: König, nicht Königin) gerade recht, als Spezialagent der Krone seltsamen Vorkommnissen nachzugehen: Schornsteinfegerjungen werden entführt, Werwölfe werden gesichtet (keine Angst, für die gibt es eine "realistische" Erklärung), und zu allem Überfluss hüpft wieder dieser Spring Heeled Jack durch die Gegend, der zuletzt eine Generation zuvor gesichtet worden war.
Parallel dazu lernen wir die Romanwelt besser kennen und staunen über Hubschrauberstühle, dampfbetriebene Hochräder und die Atmosphärische Eisenbahn - alles Konzepte, die in unserer Welt zu den Akten gelegt werden mussten, hier jedoch wie am Schnürchen laufen. Im Gegensatz zu Luftschiffen übrigens, auf die man nach diversen Gas-Explosionen lieber verzichtet hat (ein ironischer Kommentar des Autors - damit und mit der Ermordung Königin Viktorias in jungen Jahren hat er gleich zwei beliebte Steampunk-Klischees entsorgt). Und dazu kommen dann noch die Errungenschaften der sich auf Darwin berufenden Eugenicists: Riesenschwäne, die Passagierkörbe schleppen, etwa oder Papageien als Kombination aus Tonbandgerät und Telegrammbote ... würden sie ihre Botschaften bloß nicht dauernd mit ordinären Flüchen garnieren. Hodder zeichnet eine Gesellschaft im totalen Umbruch: Technologists und Eugenicists krempeln mit ihren Erfindungen den Alltag um, radikale Libertines stellen sämtliche moralischen Grundfesten in Frage. Insofern ist es nicht ganz gerecht, wenn SF-Großmeister Michael Moore Hodder im Vorwort zwar Rosen streut, aber wieder seinen Kampfbegriff Steam Opera verwendet, den er in Umlauf bringen will, weil er in den Samt-und-Seide-Settings der meisten Steampunk-Romane den -punk vermisst. Dabei geht Hodder ausführlich auf das soziale Elend in Londons weniger noblen Teilen ein - einmal stellt Burton fest, dass die Zustände im East End die in jedem Dorf draußen in der "unzivilisierten" Welt in den Schatten stellen.
Und es sind diese sozialen Bewegungen, die auch die groteske Verschwörung motivieren, der Burton allmählich auf die Schliche kommt. Daran beteiligt sind unter anderem der visionäre Eisenbahn-Ingenieur Isambard Kingdom Brunel, die legendäre Krankenschwester Florence Nightingale(!) und der "Computer"-Pionier Charles Babbage ... und in James-Bond-Schurkenmanier eröffnet wird dies Burton von einer noch wesentlich prominenteren Figur der Historie. Bleibt noch Spring Heeled Jack selbst. Der hat es von Anfang an auf Burton abgesehen und fordert ihn nachdrücklich auf, sich nicht einzumischen, sondern lieber seinen "vorgesehenen" Lebensweg zu beschreiten. Damit zeichnet sich schon früh im Roman ab, dass die Themen alternative Welten und Zeitreisen eine Rolle spielen - und es ist einer der genialen Züge von "The Strange Affair of Spring Heeled Jack", seine Steampunk-Handlung in einem SF-Rahmen zu verankern und letztlich sogar aufzuklären, warum hier alles so anders ist, als wir es aus den Geschichtsbüchern kennen. Der zweite geniale Zug ist es, den Handlungsablauf der ersten Kapitel im letzten Abschnitt noch einmal aus einer anderen Perspektive und einer anderen Chronologie heraus zu schildern. Und auch wenn der Kontext früh klar wird, ist es doch in höchstem Maße vergnüglich herauszufinden, wie die Handlungsstränge zusammengeführt werden und in was für eine Conclusio bzw. sogar Botschaft sie letztlich münden.
Eine gute Nachricht noch zum Schluss: Bastei Lübbe hat die deutschsprachigen Rechte am Roman erworben. In der Übersetzung wird zwar das Vergnügen verloren gehen, statt "bullshit" Wörter wie "poppycock" oder "balderdash" zu lesen, dafür kommen dann auch diejenigen unter den potenziell interessierten LeserInnen zum Zuge, die vor einem englischsprachigen Roman zurückscheuen. Und die Abenteuer werden damit nicht enden: Auf seinen preisgekrönten Erstling ließ Hodder im Frühling bereits "The Curious Case of the Clockwork Man" folgen, für Jänner ist mit "Expedition to the Mountains of the Moon" ein dritter Burton&Swinburne-Roman angekündigt.
Ted Chiang: "Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes"
Kartoniert, 200 Seiten, € 15,40, Golkonda 2011/12
Ist schon schräg, was einen manchmal auf einen Autor anfixen kann. Bei Ted Chiang war's für mich das Wort Onager. Womit hier nicht die Belagerungsmaschine gemeint ist, sondern der Asiatische Wildesel. Denn es waren nicht einfach "Lasttiere", die Ted Chiang 1990 in seiner ersten Kurzgeschichte "Tower of Babylon" zur Karawane formierte, und auch keine bloßen "Esel" - nein, eben "Onager". Das mag wie ein vollkommen unbedeutendes Detail erscheinen, aber es steht auch irgendwie symbolisch für das Bemühen eines Autors, stets die größtmögliche Präzision einzuhalten. Eine Philosophie, die sich vor allem in der Akribie äußert, mit der Chiang die Konsequenzen einer Ausgangsidee berücksichtigt, was seinen Geschichten einen unvergleichlichen Grad an Durchdachtheit verleiht. Und was seinerseits wieder - eine schöne Kausalkette von Ursache und Wirkung, Chiang würde sich freuen - dazu geführt hat, dass der gelernte Computerwissenschafter aus den USA ein Verhältnis von Output und Literaturpreisen erzielt hat, das so nahe an 1:1 herankommt wie bei wohl keinem anderen SF-Autor. Jetzt - genauer gesagt ab Jänner - gibt's Chiang endlich auch auf Deutsch.
"Ausatmung" ("Exhalation") zeigt den unverwechselbaren Chiang-Stil in beispielhafter Weise: Gekleidet in die Form eines Forschungsberichts eines nicht-menschlichen Wissenschafters sorgen darin zunächst einmal die exotischen Details für Staunen. Wir befinden uns offenbar in einem durch Chromwälle begrenzten Universum, dessen metallische Bewohner Argon atmen und täglich ihre verbrauchten Aluminium-Lungen gegen neue austauschen. Damit schafft Chiang aber nur ein möglichst fremdartiges Setting, um verallgemeinerbare Themen wie die Entropie, den Energieerhaltungssatz oder die Unmöglichkeit von Perpetuum mobiles zu illustrieren. Der Erzähler führt eine Biopsie an seinem eigenen Gehirn durch und kann so endlich die alte Streitfrage klären, in welchem Medium die Gedanken seines Volkes gespeichert sind. Allerdings deduziert er aus dieser Erkenntnis auch das Wissen um das unvermeidliche Ende seiner Kultur und seines ganzen Universums - sein Appell am Ende ist zugleich Chiangs zentrale Botschaft.
Fünf Geschichten sind in "Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes" enthalten, drei davon erschienen - zusammen mit einigen weiteren - im englischsprachigen Sammelband "Stories of Your Life and Others" (hier der Link zur damaligen Rezension). Die Titelgeschichte ("Hell Is the Absence of God") denkt religiöse Dilemmata weiter. In der hier beschriebenen Welt - einer alternativen Version unserer Gegenwart - ist Glauben im wörtlichen Sinne gegenstandslos. Der biblische Gott existiert, das beweisen nahezu täglich Engel, deren Manifestationen Wunderheilungen ebenso wie Katastrophen auslösen; nicht zu vergessen die Visionen von Himmel und Hölle, die sich den Menschen ebenso regelmäßig offenbaren. Statt Glauben geht es hier also nur um die bedingungslose Hingabe - doch wie liebt man einen Gott, der offensichtlich völlig willkürlich straft und belohnt? Damit hat nicht nur der Protagonist Neil Fisk, der seine Frau beim Erscheinen eines Engels verlor, zu raufen. Neils weiteres Schicksal wird auch auf die LeserInnen lange Zeit nachwirken.
In "Der Turmbau zu Babel" ("Tower of Babylon") gibt das antike geozentrische Weltbild tatsächlich die Realität wieder. Daher wird das Vorhaben, von einem Turm aus das Himmelsgewölbe anzubohren, Erfolg haben. Was das Expeditionskorps an der Spitze seines steinernen Weltraumlifts dann vorfindet, hat man allerdings nicht vorhergesehen ... und hätte es doch müssen. - "Geschichte deines Lebens" ("Story of Your Life") dreht sich um den Kontakt zu einer außerirdischen Spezies, deren Schrift nicht linear ist. Wer den Anfang eines Satzes kennt, nimmt zugleich auch dessen Ende und alles Dazwischenliegende wahr. Als sich die Linguistin Louise Banks in diese Kommunikationsform einarbeitet, ändert sich damit gemäß der Sapir-Whorf-Hypothese auch ganz allmählich die Struktur ihres Denkens - und diese bestimmt die Chronologie, in der die Geschichte erzählt wird. Lässt sich viel besser lesen als in einem Absatz beschreiben. Sehr beeindruckende Geschichte; wie auch alle anderen.
Die neben "Ausatmung" zweite Erzählung, die nicht in "Stories of Your Life and Others" enthalten war, ist "Der Kaufmann am Portal des Alchemisten" ("The Merchant at the Alchemist's Gate") und zeigt, dass Chiangs Werke jede beliebige Form annehmen können, ohne dadurch an Klarheit im Kopf einzubüßen. Hier ist es die eines Märchens aus 1001 Nacht. Unterwürfig berichtet der Stoffhändler Fuwaad ibn Abbas dem Kalifen von Bagdad, wie er beim Meister-Handwerker Bashaarat ein Tor vorfand, durch das man 20 Jahre in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen kann. Doch weder die eine noch die andere ist veränderbar, wie Bashaarat Fuwaad anhand von drei Geschichten über drei Zeitreisende demonstriert. Besonders vergnüglich dabei der Wettstreit der Argumente zwischen den beiden: Wenn man weiß, dass man in 20 Jahren noch am Leben sein wird, könnte man sich doch eigentlich ohne Bedenken in jede Schlacht stürzen. - Ah, aber würde jemand, der solche Gedanken hegt, in 20 Jahren tatsächlich ein älteres Ich vorfinden?
Dass alles Künftige ebenso wie alles Vergangene festgeschrieben und unveränderlich ist (egal, ob in Begriffen wie Selbstkonsistenz, Minkowski-Würfel oder Allahs Wille ausgedrückt), mag auf den ersten Blick niederschmetternd wirken. Und doch gibt es Raum für Trost, wie Fuwaad am eigenen Leib erfahren wird. Und so wie in dieser Geschichte mit Schicksal und freiem Willen das scheinbar Unvereinbare unter einen Hut gebracht wird, so verhält es sich auch mit Chiangs Geschichten insgesamt: Sie sind auf der einen Seite elegant gelöste Gleichungen, auf der anderen pure Poesie. Was ein verdammt staunenswerter Trick ist, den Chiang ein ums andere Mal wieder hinzaubert.

Megan Whalen Turner: "Der Dieb"
Broschiert, 301 Seiten, € 9,30, Blanvalet 2011
Klein, aber fein - so lässt sich der Start von Megan Whalen Turners Young-Adult-Reihe "Attolia" am besten zusammenfassen. Wobei vor allem die Vokabel klein im Fantasy-Kontext bemerkenswert ist. "The Thief" hat bereits 15 Jahre auf dem Buckel, dennoch ist es keine reine Willkür, dass die deutsche Übersetzung zu diesem Zeitpunkt auf den Markt kommt: Die in Ohio lebende Turner ist nämlich weder eine Seitenschinderin noch eine Fließbandproduzentin und der vierte Band ihrer Reihe ("A Conspiracy of Kings") ist erst im vergangenen Jahr erschienen. Der wird dann im nächsten Sommer auf Deutsch veröffentlicht werden, die ersten drei hingegen, die aus den Jahren 1996, 2000 und 2006 stammen, hat Blanvalet nun simultan herausgegeben. Der eine oder die andere mag grummeln, dass sie dann lieber gleich einen fetten Sammelband gehabt hätten und nicht für jeden Roman extra bezahlen müssten - ich persönlich finde es eine schöne Abwechslung, dass ein Fantasyroman auch mal angenehm in der Hand liegt, ohne dass man zuvor ein Stützskelett anlegen musste.
Der Reiz von Turners Roman liegt in der Art, wie sie mit dem gewählten Plot umgeht (deshalb bitte über diesen Absatz hinaus weiterlesen), der Plot selbst hingegen ist höchst klassisch: Der junge Dieb Gen sitzt im Gefängnis des Königreichs Sounis, weil er allzulaut mit seinem jüngsten Coup geprahlt hat. Bis ihn der Magus - kein Magier, sondern ein Gelehrter und Berater des Königs - aus seiner Zelle holt und ihn wegen seiner Fähigkeiten zu einer Expedition zwangsverpflichtet. Es gilt, Hamiathes' Gabe, einen rituellen Stein, der für die Thronfolge im benachbarten Königreich Eddis hohe symbolische Bedeutung hat, zu finden. "Was, wenn keiner mehr an Hamiathes' alberne Gabe glaubt? Was, wenn wir sie finden und alle nur 'Na und?' sagen?" wird Gen später seine Gefährten auf der Queste - den Magus, zwei von dessen Schülern und einen abgebrühten alten Soldaten - fragen. Und diese Frage allein zeigt schon, dass Turner mit klischeebeladener Mythenduselei nichts am Hut hat.
Im Zentrum steht eher die Chemie innerhalb der Gruppe, angeheizt vom Trotzkopf-Verhalten Gens, der seine Gefährten ebensosehr provoziert wie die LeserInnen vergnügt. Und immer deutlicher zeichnet sich ab, dass der sich dumm und tapsig gebärdende Gen in Wahrheit eine einzige Show abzieht. Es scheint mehr in ihm zu stecken, als selbst die Augen des Magus wahrnehmen. Ganz ähnlich wie in den Erzählungen K. J. Parkers haben wir es hier also mit einem Ich-Erzähler zu tun, dem man nicht unbedingt aufs Wort glauben sollte - mag er auch nicht die selben Abgründe verbergen, wie dies Parkers Figuren in der Regel tun. Ist schließlich immer noch Young Adult.
"Der Dieb" ist Fantasy ohne epische Schlachten, ohne nichtmenschliche "Völker" und ohne angewandte Magie. Stattdessen fließt das Übernatürliche auf eine originelle Weise ein. Am Lagerfeuer unterhalten sich die Gefährten mit Erzählungen aus der Welt der Götter, welche stark an das griechische Pantheon erinnern - und besonders mit Geschichten über Gens Namenspatron Eugenides, den Gott der Diebe. Interessant dabei: Die griechischen Götter spiegelten einst höchst irdische Familien- und Herrschaftsstrukturen wider. Das greift Turner auf, indem sie die Abenteuer der "beiden Gens" parallel schildert - und so tänzelt "Der Dieb" in der Folge geschickt um die Frage herum, was hier eigentlich das Original und was das Spiegelbild ist.
Turners Romanwelt ist deutlich mediterran geprägt, und im Nachwort erläutert die Autorin, dass sie dazu von Griechenland-Reisen inspiriert wurde. Eine eindeutige räumliche oder zeitliche Zuordnung wollte sie jedoch vermeiden. So vermischen sich Direkt-Entnahmen aus der altgriechischen Mythologie wie der Zyklop Polyphem mit Eigenerfindungen. So ist der Name Archimedes bekannt und lauert am Rande der drei verbundenen Königreiche Sounis, Eddis und Attolia das Volk der Meder - doch spielen diese noch zu einer Zeit, da man schon Buchdruck und Pistolen kennt, eine Rolle, während sie in unserer Welt bereits in der Antike aus der Geschichtsschreibung verschwunden sind. Turner platziert ihre Fantasy-typische Queste also genau genommen in einem Alternative-History-Setting - sie selbst sieht es als Gedankenspiel, wie sich eine antike Zivilisation ohne den Aufstieg des Monotheismus weiterentwickeln hätte können.
Erzählt in einem bewusst schlicht gehaltenen Stil ergibt das eine sympathische Abenteuergeschichte mit Humor und überraschenden Twists. Und wer "Der Dieb" mochte, kann sich wie gesagt Band 2 ("Die Königin") und 3 ("Der Gebieter") auch schon jetzt besorgen ... darin stehen Gen übrigens einschneidende körperliche und karrieremäßige Veränderungen bevor. Band 4 ("Die Verschwörer") ist für Juni angekündigt.

George Mann: "Affinity Bridge"
Kartoniert, 447 Seiten, € 17,50, Piper 2011
Mit Piper ist also ein weiterer deutschsprachiger Verlag ins Steampunk-Business eingestiegen. Hat ein bisschen länger gedauert als in den USA und Großbritannien, aber jetzt rollt der Zug. "The Affinity Bridge" von George Mann hab ich seinerzeit schon anlässlich der Original-Veröffentlichung besprochen, daher kann ich mich jetzt damit begnügen, schlank einen Link auf die damalige Rezension zu legen.
Hier nur kurz eine Zusammenfassung des Inhalts für diejenigen, die nicht klicken wollen: "Affinity Bridge" hat einen eigentlich recht ähnlichen Plot wie Hodders (deutlich besseres) "Spring Heeled Jack", inklusive einer vergleichbaren Personenkonstellation. Mit Sir Maurice Newbury ist erneut ein - diesmal fiktiver - Gentleman mit wissenschaftlicher Bildung nebenbei als Agent der Krone tätig. Zur Seite steht ihm jedoch kein sexuell devianter Poet, sondern das schlagkräftige Frollein Veronica Hobbes. John Steed und Emma Peel im Fin de siècle, gewissermaßen - Mann mag's eben lieber traditioneller als Hodder. Merkt man auch daran, dass Queen Victoria hier noch die Macht in Händen hält ... mag sie auch ein dampfbetriebener Cyborg sein. Drei Romane rund um sein Duo hat Mann bislang zu Papier gebracht, im ersten haben es Newbury & Hobbes unter anderem mit Zombies, einer Mordserie und einem abgestürzten Luftschiff voller gefesselter Leichen zu tun. - Und das Morden geht weiter bzw. lebt im Februar unter anderen Umständen wieder auf: Dann erscheint mit "Osiris Ritual" der zweite Band der Reihe.
Da lässt sich die Konkurrenz natürlich nicht lumpen: Ebenfalls im Februar startet Heyne mit "Boneshaker" die deutsche Ausgabe der erfolgreichen "Clockwork Century Universe"-Reihe von Cherie Priest. Da ist's nix mit "Steam Opera", da fließen Schweiß, Blut und Maschinenöl (plus welche faulen Säfte auch immer in den Adern von Untoten stocken mögen). Und quasi als ergänzende Veredelung folgt einen Monat später die Neuausgabe des Klassikers "Die Differenzmaschine" von William Gibson und Bruce Sterling aus dem Jahr 1990 - heute gerne dem Steampunk zugeordnet, auch wenn zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung davon noch nicht die Rede sein konnte. Und Bastei Lübbe hat sich wie schon zuvor gesagt nicht nur die Rechte an "Spring Heeled Jack" gesichert, bereits im März wird dort Jay Lakes monumentale "Mainspring"-Saga starten. Hier laufen nicht nur Maschinen, sondern die Erde selbst auf Zahnrädern.
Wem das alles jetzt zuviel dampft: Keine Sorge, 2012 bringt auch jede Menge anderes. In Sachen Wiederveröffentlichungen zum Beispiel meine persönlichen Lieblingsmonster, nämlich John Wyndhams "Triffids" bei Heyne, während der Septime-Verlag seine James Tiptree Jr.-Reihe fortsetzt. Neues kommt natürlich auch: So übersetzt der Golkonda-Verlag die Kurzgeschichten von Neo-Star Paolo Bacigalupi für einen Sammelband, Heyne bringt mit "Cyberabad" endlich einen der Romane, in denen Ian McDonald Visionen für die nahe Zukunft der Schwellenländer entwirft, auf Deutsch heraus und Bastei Lübbe liefert den jüngsten Ringwelt-Roman "Verrat der Welten" nach. Und ein Buch, auf das wir alle schon die längste Zeit sehnsüchtig warten, ist für April angekündigt: "Vortex", die zweite Fortsetzung von Robert Charles Wilsons phänomenalem Roman "Spin". Wer sagt da noch, 2012 hätte außer einem popligen Weltuntergang nichts zu bieten? Auf Wiederlesen Ende Jänner! (Josefson)