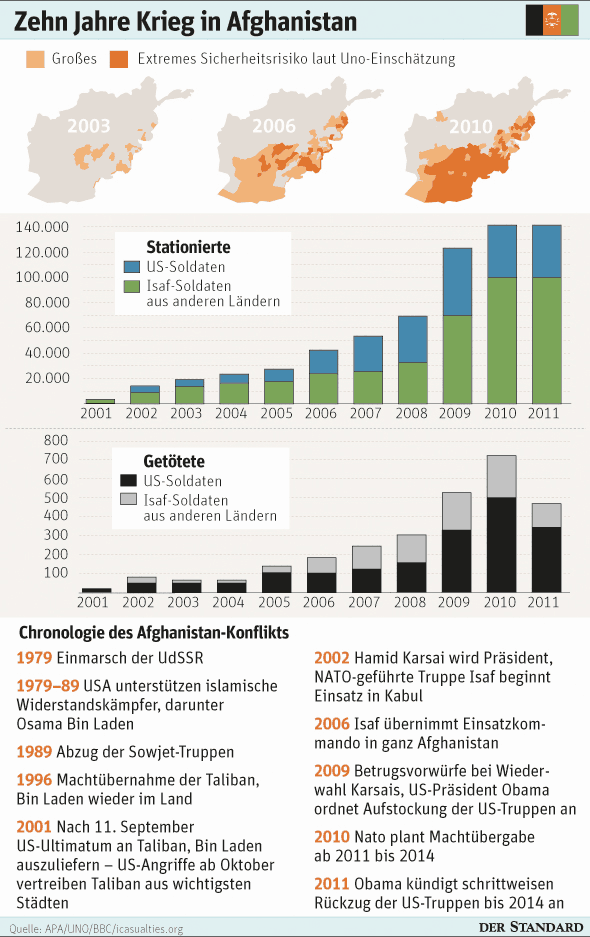Der Westen ist am Hindukusch gescheitert.
*****
Kabul/Neu-Delhi - Als am 7. Oktober 2001 die Nato ihre ersten Luftangriffe auf Afghanistan fliegt, überschlagen sich viele US-Medien beinahe vor Euphorie. Und der damalige US-Präsident George W. Bush schwört das Volk in einer Fernsehansprache auf das Kommende ein. "Die Taliban werden bezahlen." An einen schnellen Sieg und an einen kurzen Einsatz glaubten damals viele Menschen im Westen. Nur wenige ahnten, dass es der Beginn eines Krieges war, der als bisher längster in die US-Geschichte eingehen würde. Und der zu einem Albtraum für den Westen werden sollte.
Ein ganzes Jahrzehnt dauert der Krieg am Hindukusch nun schon, zehntausende Menschen hat er das Leben gekostet, Milliarden Euro verschlungen. Noch immer ist ein Ende des Blutvergießens nicht in Sicht. "Der Afghanistaneinsatz ist auf ganzer Linie gescheitert" , zieht Medico-Geschäftsführer Thomas Gebauer bittere Bilanz. Medico zählt zu jenen Organisationen, die vor zehn Jahren warnten, dass der Krieg in einem Fiasko enden könnte.
Siegesfeiern und Aufbruch
Doch zunächst schien alles erstaunlich gut zu laufen. Beinahe in Windeseile verjagten die USA und ihre Verbündeten mithilfe der Nordallianz die Taliban aus Kabul und feierten sich als Sieger. Tatsächlich waren die meisten einfach nur in Pakistans Grenzregionen geflohen. Doch in Kabul herrschte Aufbruchstimmung, in Scharen strömten Helfer ins Land, Kinder winkten den Ausländern zu. Die Afghanen glaubten dem Westen, der dem Land Frieden, Freiheit und Wohlstand verhieß.
Doch dann wandten sich die USA dem Irakkrieg zu, und die Ressourcen flossen dorthin. Die Chance wurde vertan, Afghanistan militärisch und wirtschaftlich zu stabilisieren. Zugleich unterschätzte der Westen die Gefahr, dass sich die Taliban neu formieren. Als er schließlich aufschreckte, weil diese immer weitere Teile des Landes kontrollierten, war es offenbar zu spät.
Heute sind zwar 130.000 ausländische Soldaten am Hindukusch stationiert, doch auch sie scheinen der Taliban nicht Herr zu werden, die leicht in der Bevölkerung untertauchen können. Der Krieg gleicht immer mehr einer endlosen Geschichte, deren Sinn abhanden gekommen ist: Viele Taliban-Kämpfer sind so jung, dass sie sich nicht einmal an die Terroranschläge am 11. September 2001 erinnern. Sie sehen in den ausländischen Truppen schlicht feindliche Besatzer, wie es die Russen waren.
Von Sieg redet heute keiner mehr. Inzwischen zerbrechen sich Politiker und Militärs im Westen vor allem die Köpfe, wie sie sich aus der Affäre ziehen können, ohne völlig das Gesicht zu verlieren. Das westliche Publikum ist längst kriegsmüde. US-Präsident Barack Obama hat angekündigt, dass er die meisten Truppen bis Ende 2014 aus Afghanistan zurückholen will. Doch bis heute ist er ein überzeugendes Abzugskonzept schuldig geblieben, das erläutert, wie der Westen verhindern will, dass das Land wieder in einem blutigen Bürgerkrieg versinkt, wie er nach Abzug der Russen ausbrach.
Zwar verkündet die Nato munter Fortschritte im Kampf gegen den "Feind" . Doch Militärs und Diplomaten scheinen ihren eigenen Bekundungen zur Sicherheitslage nicht recht zu trauen. Die Botschaften in Kabul ähneln Festungen, das Hauptquartier der Nato-Truppe Isaf liegt einer Trutzburg gleich in der weiträumig abgeriegelten Sicherheitszone.
Zehntausende Tote
Dagegen fühlen sich die Afghanen unsicherer denn je, Angst lähmt das Land. "Niemand hier ist glücklich" , sagt der 22-jährige Afghane Samir, der im Ausland nach Arbeit sucht. Der Krieg wird immer blutiger. Es sind vor allem die Afghanen, die den Preis zahlen: Auf 20.000 bis 40.000 wird die Zahl der Toten seit 2001 geschätzt. Wie viele davon Taliban und wie viele Zivilisten waren, lässt sich kaum prüfen.
Der Krieg verlagert sich immer mehr in die Häuser der Menschen, seitdem die Amerikaner auf der Jagd nach versteckten Taliban ihre umstrittenen Nachtrazzien massiv ausweiten. Auch die Hoffnung auf ein bisschen mehr Wohlstand hat sich für die meisten Afghanen zerschlagen - nimmt man eine korrupte Elite aus, die sich die Taschen vollgestopft hat.
Sicherlich, es gibt Fortschritte. Schulen, Hospitäler und Straßen wurden gebaut, auf dem Papier ist Afghanistan eine Demokratie. Aber das Land ist weiter bitterarm. Die Kinder- und Müttersterblichkeit ist eine der höchsten der Welt. Die Arbeitslosenrate wird auf 30 bis 40 Prozent geschätzt.
"Ein politisches Desaster"
Von einem "militärischen, moralischen und politischen Desaster" spricht Medico-Chef Gebauer. Der Westen werde immer mehr "mit Respektlosigkeit, Willkür und Gewalt" verbunden. Tatsächlich scheint die Stimmung in der Bevölkerung umzuschlagen. Wurden die Ausländer anfangs noch mit offenen Armen empfangen, wird das Klima feindseliger.
Viele Afghanen beklagen, dass sich vor allem die Amerikaner wie die Herren des Landes aufführten, dass es ihnen nie um den Aufbau ging, sondern um geostrategische Machtinteressen. Zwar haben die USA angeblich ihre Fühler ausgestreckt, um mit den Taliban Chancen für einen Frieden auszuloten. Aber wie ernst es allen Seiten ist, weiß niemand. Die Friedensbemühungen erlitten zudem einen Rückschlag, als ein Selbstmordattentäter Friedensunterhändler Burhanuddin Rabbani ermordete. (Christine Möllhoff/DER STANDARD, Printausgabe, 7.10.2011)