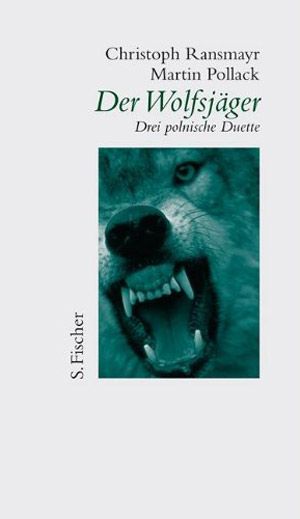Ein Gespräch über das Reisen, Schreiben und Wölfe. Von Mia Eidlhuber und Stefan Gmünder
STANDARD: Herr Ransmayr, in einer Reihe im S. Fischer Verlag beschäftigen Sie sich seit Jahren immer wieder mit den "Spielformen des Erzählens", so der Übertitel der Bände. Es gibt in Ihrem Roman "Die Schrecken des Eises und der Finsternis" einen Satz, der besagt, dass eine Luftlinie noch kein Weg sei. Erzählen hat für Sie nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit einem körperlichen Sich-Aussetzen zu tun ...
Ransmayr: Ich habe die Weisheit, dass die wahren Abenteuer im Kopf stattfinden sollen, immer als platt empfunden. Welche Abenteuer sollen in einem Kopf stattfinden, wenn ihnen keine Erfahrungen vorausgegangen sind? In einer Schreibstube fällt kein Schnee, rauscht kein Meer und werden - im Normalfall - auch keine Wölfe gejagt. Eine Reise ist ja nicht bloß ein Weg in die Außenwelt, sondern auch ein Weg ins Erzählen.
STANDARD: Die Spielform, die Sie mit Martin Pollack gewählt haben, ist das Duett. Zwei Stimmen, die sich zu einer vereinen. Wie funktioniert das in der Literatur?
Pollack: Es ist ein Prinzip unseres gemeinsamen Erzählens, dass wir alles gemeinsam machen. Wir arbeiten nicht mit verteilten Rollen. Wir recherchieren gemeinsam, führen alle Gespräche gemeinsam, machen die Reisen gemeinsam. Da heißt es nie: Du machst dies, und ich mache das. So ist das auch beim Schreiben, wir schreiben jeden Satz gemeinsam. Vom Anfang bis zum Ende.
STANDARD: Setzt eine derartige gemeinsame Unternehmung eine Freundschaft voraus - oder kann ein intensiver Prozess wie dieser eine solche sogar gefährden?
Pollack: Wahrscheinlich. Wir sind, Gott sei Dank, nie in eine solche Situation gekommen. Natürlich setzt gemeinsames Schreiben gutes Verstehen, ja Freundschaft voraus. Mit einem Menschen, mit dem mich nichts verbindet, könnte ich nicht so viel Zeit in intensiver Arbeit verbringen.
STANDARD: Beim Reisen und Recherchieren ist das Gemeinsame vorstellbar. Aber wie schreiben zwei Schriftsteller gemeinsam eine Geschichte? Allein an welchem Schreibort?
Ransmayr: Am besten an einem überdachten, windgeschützten, notfalls beheizbaren Ort und dort an einem Tisch, an dem Bilder, Szenen, zuerst besprochen und noch einmal besprochen und dann gemeinsam formuliert werden, Wort für Wort, Satz für Satz. So kann aus zwei verschiedenen Erzählweisen so etwas wie eine dritte Stimme entstehen. Aber wir haben mit unseren "polnischen Duetten" nur eine Exkursion unternommen, einen Ausflug, von dem jeder wieder an seinen eigenen Schreibtisch zurückkehren wird. Der Wolfsjäger ist schließlich das neunte Bändchen einer weiß gebundenen, den "Spielformen des Erzählens" gewidmeten Reihe, in der ich in den vergangenen Jahren auch die Tirade, die Festrede, das Verhör, den dramatischen Dialog oder auch rhythmische, strophische Prosa als Erzählformen vorgeführt habe. Ich habe Martin Pollack gefragt, ob er sich im Rahmen dieser Reihe noch einmal einen gemeinsamen Ausflug vorstellen könnte ...
Pollack: Dabei stört es auch nicht, dass wir unterschiedliche Charaktere sind und unterschiedlich schreiben. Viele sind erstaunt, dass das funktionieren kann, und fragen sich, wie das geht. Ganz einfach. Wir ergänzen uns gut. Das hat auch etwas Leichtes, etwas Spielerisches an sich, wir sind ja nicht bis ans Ende unserer Tage aneinandergekettet. Wir haben das gemeinsame Schreiben schon früher betrieben, vor vielen Jahren. (zu Christoph Ransmayr:) Kannst du dich erinnern, wie es zu unserer ersten gemeinsamen Geschichte gekommen ist?
Ransmayr: Es begann, wie so vieles, beim TransAtlantik. Meine erste Geschichte für diese Monatszeitschrift war eine Reportage über die Schwarze Madonna von Tschenstochau. Martin Pollack wurde mir als Polen-Experte empfohlen, so haben wir uns kennengelernt. Ich durfte aber damals, Anfang der 80er-Jahre, nicht nach Polen einreisen. So betrieb ich meine Recherchen in Flüchtlingslagern und polnischen Gemeinden in Österreich, und als ich die Einreisebewilligung nach Monaten endlich bekam, war die Geschichte fertig. Schon eine der nächsten Reportagen haben wir bereits gemeinsam gemacht, auch weil wir - und das blieb an unsere damals beginnende Freundschaft gebunden - nicht nur eine ähnliche Art von Humor hatten, sondern auch einen verwandten Zugang, in einem zunächst chaotisch erscheinenden Material die Struktur einer Geschichte zu entdecken. Die Freude über solche Entdeckungen fördert ja nicht nur die Freundschaft, sondern verkürzte auch Arbeitsprozesse. Das war auch bei der Arbeit am Wolfsjäger der Fall. Ich kann mich nicht erinnern, eine Geschichte jemals so zügig geschrieben zu haben.
Pollack: Es war für uns überraschend, dass das so gut geklappt hat. Es gab dann eine lange Zeitspanne, in der wir nichts gemeinsam geschrieben haben. Das hat sich einfach nicht ergeben, jeder hat seine eigenen Sachen gemacht. Aber wir haben einander nie aus den Augen verloren. Vor einiger Zeit ist Christoph Ransmayr auf mich zugekommen und hat gesagt: Probieren wir's doch noch einmal. Das Thema des Wolfsjägers hatten wir im Kopf. Wir waren vor Jahren gemeinsam in den Bieszczady, Ausläufern der Karpaten im südlichen Polen, und haben damals Material gesammelt, Eindrücke. Das Problem bestand darin, ein Zeitfenster zu finden, damit wir uns gemeinsam hinsetzen und ohne Unterbrechung arbeiten können. Bei mir am Land hat das wunderbar funktioniert, wir konnten sehr konzentriert arbeiten.
Ransmayr: Bis zu zehn Stunden am Tag. Für mich allein wäre ein Schreibtag dieser Länge eine Qual.
STANDARD: Was hat Sie am Thema des Wolfsjägers so fasziniert?
Pollack: Wölfe gibt es überall in den Karpaten. Daraus ergeben sich zahlreiche Konflikte, etwa zwischen Naturschützern und Schafzüchtern. Es gibt eine Abschussquote, die ist den einen zu hoch und den anderen zu niedrig. Wölfe sind extrem schwer zu jagen, sie sind unglaublich klug. Ich habe einmal in Polen an einer Wolfsjagd teilgenommen. Da wurden mit bunten Fetzen behängte Stricke quer durch den Wald gespannt, angeblich scheuen sich Wölfe, unter solchen Hindernissen durchzulaufen. Es wurde kein einziger Wolf gesichtet, geschweige denn einer geschossen, was mich froh machte. Ich bin schon mit Wolfsgeschichten aufgewachsen. Die hat mir mein Großvater erzählt, ein passionierter Jäger. Er hat zu seinen Geschichten wie ein Wolf geheult, das war gruselig schön. Von ihm habe ich sogar ein Wolfsfell geschenkt bekommen, von einem selbstgeschossenen Tier.
Ransmayr: Ich wandere gelegentlich im westlichen Taurusgebirge in der Türkei. Dort werden Wölfe immer wieder zur Bedrohung für die Schafherden von Nomaden. Für einen Wanderer sind allerdings die mit Stachelhalsbändern gegen Wolfsbisse bewehrten Hirtenhunde gefährlicher. Die Hunde sind so scharf, dass man sich unterwegs eher vor ihnen fürchten muss als vor den scheuen Wölfen.
STANDARD: Anfang der 80er-Jahre waren Sie beide viel gemeinsam unterwegs und Schreiber für das legendäre "TransAtlantik"-Magazin, das viele heute nicht mehr kennen. Hatte man als Schreiber den Ehrgeiz, Teil dieses "TransAtlantik"-Mythos zu sein?
Ransmayr: Diese Monatszeitschrift war damals für Leute, die Reportagen oder für das Feuilleton schrieben, so etwas wie ein Wallfahrtsort. Die Dichter und Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger und Gaston Salvatore haben die Zeitschrift gegründet, der Philosoph Karl Markus Michel war ihr Chefredakteur. Ich habe mich in meinem Leben niemals irgendwo beworben - mit einer Ausnahme: das TransAtlantik. Ich bin damals nach München gepilgert, habe dort den verehrten Berühmtheiten und späteren Freunden Essays und Reportagen vorgelegt und dafür einen ersten Auftrag bekommen. Das Problem dieser Zeitschrift war vielleicht, dass sie den New Yorker zum Vorbild hatte, aber das großartige Modell - Schriftsteller und Essayisten schreiben Reportagen im Stil und auch in der Länge von Erzählungen - ließ sich nicht so einfach übertragen. Hierzulande hat in den Jahren des Hitler-Wahns ja auch eine literarische Selbstverstümmelung stattgefunden, nach der nicht nur unendlich viele Menschen fehlten, sondern mit ihnen auch Erzählformen, eine ganze Schreib- und Lesekultur. So gab es im gesamten deutschsprachigen Raum zwar vielleicht noch genügend Menschen, die für ei- ne Zeitschrift wie TransAtlantik schreiben konnten, aber nicht genügend entsprechende Leser.
STANDARD: Gibt es heute etwas Vergleichbares? Oder sehen Sie das Genre der großen, aufwändigen Reportagen gefährdet?
Pollack: Im deutschen Sprachraum sehe ich nichts Adäquates. Längere Geschichten im TransAtlantik hatten 30 Blatt. Das ist heute undenkbar. In Polen hat die Reportage einen anderen Stellenwert, dort erscheint zum Beispiel eine große Tageszeitung wie die Gazeta Wyborcza mit einer wöchentlichen Beilage, die ausschließlich Reportagen bringt, literarisch anspruchsvolle Texte. Die können sehr lang sein, 30 Blatt und mehr. Mit einem Text solcher Länge würde Sie hier jeder Chefredakteur mit dem Stock rausjagen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ein polnischer Kollege mit mir geführt hat. Als es erschien, in der Beilage der Gazeta Wyborcza, hatte es ungefähr 30.000 Zeichen. Der Mann war unglücklich und hat sich entschuldigt, die Redaktion habe gnadenlos gekürzt - ursprünglich hatte das Gespräch 48.000 Zeichen. Er war eigens aus Warschau angereist und hatte für das Gespräch drei Tage Zeit. Wir sind dann nur zwei Tage gesessen, jeweils acht Stunden, aber immerhin. Hierzulande wäre so etwas kaum möglich. Da heißt es immer: Kürzer, kürzer, die Leute wollen keine langen Texte lesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe da meine Zweifel. Warum funktioniert das in Polen?
STANDARD: Warum gibt es diese Tradition hierzulande nicht?
Pollack: Da bin ich überfragt. Wer das TransAtlantik endgültig zu Fall brachte, war ja ausgerechnet der Spiegel, der das Magazin gekauft hatte. Es kann keiner sagen, dafür seien ausschließlich wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend gewesen. Das waren Peanuts für den Verlag. Es braucht jemand, der sagt: Ich will das! Wie Adam Michnik in Polen, der Chefredakteur der Gazeta Wyborcza. Die erwähnte Beilage erscheint übrigens auf Zeitungspapier, kein Hochglanz. Das finde ich schön, die Reportage gehört in die Zeitung. Die Gazeta Wyborcza hat eine ganze Abteilung mit fix angestellten Reportern, die sich auf Reportagen konzentrieren. Da kommt es schon vor, dass einer einmal nur vier Texte im Jahr liefert. Die Qualität ist wichtig. Jeder aus einem anderen Ressort kann eine Reportage für die Beilage anbieten. Die Reportage gilt als Königsdisziplin. Das erzeugt Druck, der den Texten zugutekommt.
STANDARD: Zwei der drei Erzählungen wurden im "TransAtlantik" veröffentlicht, den "Wolfsjäger" haben Sie neu geschrieben. Aber in allen drei Erzählungen geht es um individuelle Lebensgeschichten, eingebettet in zeitgeschichtliche Themen, und deren Aufarbeitung. War das beabsichtigt?
Pollack: Alle Figuren, von denen in diesen Texten erzählt wird, der österreichische Soldat Schimek, der polnische Jude Leon oder der Wolfsjäger, sind in der Zeitgeschichte verwurzelt und auf die eine oder andere Weise durch die Geschichte gebrochen worden. Es erscheint mir wichtig, solche Geschichten zu erzählen, weil sie immer auch uns selber betreffen.
STANDARD: Die Geschichten bewegen sich an einer feinen Grenze zwischen Journalismus und Literatur. Sie waren beide Journalisten und sind Schriftsteller geworden. In einem Vorgängerband aus den "Spielformen des Erzählens" ist viel die Rede von der Freiheit des Schriftstellers gewesen. Worin besteht sie?
Ransmayr: ... das bloße Faktum mit allen sprachlichen Mitteln in Wahrheit verwandeln zu dürfen. Man spricht oft von der journalistischen Recherche für einen Roman, von der Verflechtung der Tatsachen mit erzählerischer Fantasie, man spricht aber wenig vom Romanhaften im Journalismus. Dabei sind die erzähltechnischen Zugänge nicht so unterschiedlich. Für mich war Schreiben immer unteilbar, gleichgültig, ob das Resultat eine Reportage, eine Erzählung oder ein Roman sein sollte. Es ging immer darum, sich der Welt zuzuwenden, ihren unzähligen Quellen, ihren Menschen. Zur Reportage im engeren Sinn würden wir heute nur noch im Notfall zurückkehren. Die Literatur erlaubt uns, aus der Geschichte von drei Menschen eine Gestalt zu machen, in der sich Erfahrungen verdichten. Ursprünglich hatten wir ja überlegt, nur den Wolfsjäger als Duett und neunte der Spielformen des Erzählens erscheinen zu lassen, aber weil den beiden anderen Geschichten noch immer etwas Beispielhaftes geblieben ist, haben wir sie als "Bonusmaterial" angefügt, auch um zu dokumentieren, wie das Duett aus der Reportage entstanden ist.
Pollack: Die Geschichten, die wir erzählen, haben nichts an Aktualität verloren. Die Geschichte des österreichischen Soldaten Schimek, der in Polen zum Helden gemacht wurde, habe ich übrigens zweimal erzählt, beim ersten Mal gutgläubig dem Mythos folgend. Die ist bezeichnenderweise am österreichischen Nationalfeiertag erschienen.
STANDARD: Wie kam es zur Demontage dieser Heldengeschichte?
Pollack: Ich hatte schon während des Schreibens ein komisches Gefühl, ob sich das tatsächlich so zugetragen hat. Ich habe dann Christoph von den Bedenken davon erzählt und ihn gefragt, ob wir die Geschichte vielleicht noch einmal gemeinsam recherchieren sollen?
Ransmayr: Aber ich glaube, dass noch nie jemand entschiedener Partei ergriffen hat für diesen armen Soldaten Schimek, als wir das getan haben. Davon, dass dieser kindliche, im wahrsten Sinn des Wortes unschuldige Mann "entzaubert", der Lächerlichkeit preisgegeben oder gar als Fahnenflüchtiger denunziert werden sollte, kann keine Rede sein. Wir haben auch einen Vorschlag gemacht, welche Inschrift ein wahrhaftes Denkmal für diesen Mann tragen könnte: "Otto Schimek. Geboren 1925. Hingerichtet 1944. Er war am Krieg nicht interessiert."
STANDARD: Wie findet man für die jeweilige Geschichte die richtige Erzählform?
Ransmayr: Indem man ihren Gestalten, Quellen, Hintergründen alle Zeit und allen Raum lässt, den sie fordern, und sich fragt, von welchem inneren Ort aus die Geschichte erzählen werden muss. Soll ein allwissender, unsichtbarer Erzähler sprechen? Oder ein Ich mit Namen und Anschrift? Diese Fragen stellen sich für den Schriftsteller wie für den Reporter. Irgendwann zeigt sich ja: Es gibt nur Erzählungen, nichts anderes. Selbst die Naturwissenschaften erzählen. Der Glaube, man könnte aus einem Mikro- oder Makrokosmos objektiv berichten und so ein maßstabgetreues Abbild der Wirklichkeit liefern, ist ein grotesker Irrtum.
Pollack: Jeder sieht ganz unterschiedliche Sachen. Selbst die Fotografie funktioniert so. Wenn zwei Fotografen von ein und derselben Situation eine Aufnahme machen, entstehen unterschiedliche Ausschnitte der Wirklichkeit, zwei unterschiedliche Aufnahmen. Auch wenn wir uns zusammen auf den Weg machen, sehen wir oft ganz unterschiedliche Dinge, so ist das auch bei Gesprächen, die wir gemeinsam führen.
Ransmayr: Es war ja durchaus riskant, das Erzählen im Duett noch einmal zu versuchen, nach so vielen Jahren, die seit unseren Arbeiten für TransAtlantik vergangen sind - zwanzig Jahre! -, in denen wir wohl beide spleeniger, eigenwilliger und wohl auch unnachgiebiger geworden sind. Vielleicht, dachte ich, würde im Fall des Misslingens unsere Freundschaft leiden. Aber das Ergebnis war ein Glücksfall. (Mia Eidlhuber/Stefan Gmünder, DER STANDARD/ALBUM - Printausgabe, 24./25. September 2011)