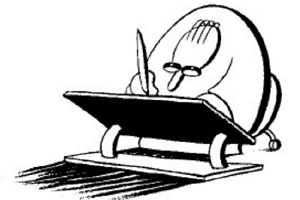
In 70 Publikationen präsent: Rudi Klein. Zeichnung: Katalog
Wien - Er kann sich selbst gut zu Papier bringen: ein paar nach hinten frisierte Haare, eine Brille, vor sich ein Zeichenbrett, und fertig ist der Rudi Klein.
Dabei habe er nie das Bedürfnis gehabt, Ähnlichkeiten herzustellen. "Das zwang mich dazu, eine andere Art von Humor zu bauen." Damit ist der Cartoon-Künstler Klein im Lauf von vier Jahrzehnten immerhin so gut gefahren, dass ihm das Wien-Museum nun eine große Ausstellung widmet: Alles Gute wünscht es zum Sechziger, und "Mann - ist das gut!!" kommentiert das Klein-Männchen gleich auf dem Cover des schönen Katalogs (Czernin Verlag). Selbstironie ist ihm nicht fremd.
Mit der anderen Art von Humor hat der aus Floridsdorf gebürtige Zeichner ein eigenes Universum geschaffen. Den lakonischen, eiförmig minimalen Figuren, die an manche US-Comics der Dreißiger- und Vierzigerjahre anknüpfen und mittlerweile fast 70 Publikationen bevölkern, legt er einfältige oder entwaffnende, unsinnige oder wahnsinnige Sätze in den Mund. "Ich schreibe eigentlich Kurzprosa", sagt er, "die von Sprechblasen begrenzt wird." In der Schule schon seien seine Aufsätze immer zu kurz gewesen.
Apropos Schule: Sie ist ein Beispiel für die Zufälle und Anstöße, die er für seinen Weg verantwortlich macht. Er hatte eine ungewöhnliche Zeichenlehrerin, "die war wirklich mit uns saufen, die einzige Lehrerin unter 50, in einer Knabenschule! Besorgte Eltern haben sie dann entsorgt." Wenn er eine Archäologin als Lehrerin gehabt hätte, wäre er wohl ganz woanders gelandet.
So landete er jedenfalls am Zeichentisch, umgeben von Tuschefeder und Papier, von hochgeschätztem Junk aller Art ("aus den Kommandozentralen des Bösen in China, wo Leute sitzen, die solche Sachen entwerfen und uns dann verkaufen"), von alten amerikanischen Uhren, die er sammelt, und Platten von George Ivan (Van) Morrison, den er verehrt - "auch so a oide Zwiderwurzn". Nach ihm nennt sich Rudolf neben Rudi und Ruud manchmal Ivan (und nicht, wie Dirk Stermann im Katalog-Vorwort spekuliert, nach den Russen, deren Rückkehr nach 1955 dem kleinen Klein vielleicht eine ganz andere Künstlerkarriere ermöglicht hätten).
Einiges aus seiner Sammlung hat neben den Zeichnungen in der Schau Platz, darunter auch die Originale eines bemerkenswerten Briefwechsels: 2004 wandte sich Andreas Khol an ihn mit der Bitte, er möge für eine Festschrift für Wolfgang Schüssel eine seiner Kanzler-Karikaturen beisteuern. Es sei ihm eine Ehre, antwortete Klein, gerne werde er etwas Besonderes aussuchen, und das Honorar von 175.000 Euro würde er "selbstverständlich zu einem großen Teil einem karikativen Zweck" zuführen.
Um dem vielfach Kreativen gerecht zu werden, öffnet sich, in geografischer Nähe zum Museum, außerdem die Arbeiterkammer für seinen "Arbeitskampf auf Papier" und die Paulanerkirche tatsächlich für seinen aus dem Standard bekannten Lochgott, den es auch als Buch gibt; die Galerie Kargl lässt ihn ein Schaufenster füllen, und er selbst führt sein Studio als "Museumsshop ohne Museum".
Nach herkömmlichen Kriterien hat er also geschafft. Er sieht die Ausstellung allerdings als "letztes Aufbäumen", ein Preis fürs Lebenswerk, in den er reingerutscht sei. Er zählt sich weder zur "Friedenstaubenabteilung" noch zu den politischen Zeichnern, die anderen zeigen, was richtig wäre, auch nicht zu den marketingtechnisch motivierten Geniedenkern. "Meine Grundeinteilung der Welt ist: Es gibt große und kleine Arschlöcher. Und man muss sich bemühen, dass man noch zu den kleinen zählt." (Michael Freund, DER STANDARD - Printausgabe, 7. September 2011)