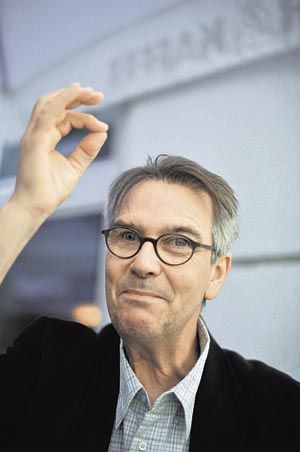
Ein Tonträger mit Kompositionen erscheint dieser Tage bei "col legno": Klanginstallationskünstler Ruedi Häusermann. Der 63-Jährige arbeitete einst als gelernter Jazz-Musiker (Pepe Lienhard) mit Christoph Marthaler zusammen. Seine zusehends eigenwilligeren Performances sicherten ihm den Ruhm eines theatralisch eigenwilligen Klanginstallationskünstlers.
Seine nunmehr bei den Wiener Festwochen gastierende Arbeit "Gang zum Patentamt" (Komposition für vier wohlpräparierte Einhandklaviere und Perpetuum mobile mit Texten von Paul Scheerbart) hatte im Berliner Hebbel-Theater am Ufer Premiere. Premiere Freitag, 27.5.: Akzent, 19.30 Uhr.
Häusermann erläuterte sein Werk Ronald Pohl.
Standard: Ein Perpetuum mobile zeigt die Möglichkeit auf, wie eine Maschine selbsttätig alle unsere Probleme lösen kann: Sie "erzeugt" Energie, sie bindet den Erfindungsgeist begabter Menschen. Ist eine solche Maschine nicht eine herrliche Metapher für die Künste?
Häusermann: Ich habe gerade erst Abstand gewonnen zu meiner eigenen Arbeit. Ich frage mich gerade: Ist der Gang zum Patentamt eigentlich das, was mich interessiert? Es kommt gar nicht darauf an, worüber ich rede. Was interessiert mich eigentlich an der Kunst, die ich mache? Mich interessieren Menschen, die eine eigene Welt erschaffen. Die will ich zeigen.
Standard: Präziser gesagt?
Häusermann: Wie schafft man eine Welt? Indem man sein eigener Fachmann wird! Wie sucht man man sich einen solchen Spielplatz, einen Sandkasten, in dem man eine ganze Welt erfindet?
Standard: Niemand schöpft etwas aus dem Nichts heraus. Die Antwort hieße: Man nimmt etwas Vorgefundenes, macht es sich zu eigen.
Häusermann: Ja, das wirft die andere Frage auf: Wie drückt man das aus? Im Moment finde ich extrem interessant, was ich selbst mache.
Standard: Was machen Sie selbst?
Häusermann: Ich schreibe Musik. Ich stecke genau in diesem Sandkasten der Künstlichkeit drin. Ich präpariere Klaviere, wobei es um die Erzeugung exakter Tonhöhen geht. Ich erfinde mir eine Klangwelt - die ist für nichts da, die verkauft sich im Endeffekt auch nicht. Ich habe lange Streichquartettkompositionen geschrieben. Jetzt übersetze ich diese Stimmenvielfalt auf vier Klaviermanuale, wobei die Regel gilt: Jedes darf nur von einer Hand benutzt werden. Natürlich ist das eine virtuelle Welt - aber sie ist für irgendetwas da. Und so ist sie vielleicht Symbol für die Darstellung einer Welt, die in letzter Konsequenz hoffentlich viele etwas angeht.
Standard: Ist die ästhetische Welt eine solche der höheren Genauigkeit? Teilt sie diese Eigenschaft vielleicht sogar mit den Naturwissenschaften?
Häusermann: Aber ganz gewiss. Dabei spielt das Thema, dass Paul Scheerbart (1863-1915) ein Dichter, aber eben auch ein physikalischer Tüftler war, eine untergeordnete Rolle. An die Oberfläche wird eine Scheinebene gesetzt: Die neue Produktion kreist um Scheerbart, den utopischen Schreiber und Erfinder im wilhelminischen Berlin, aber eigentlich brauche ich den gar nicht.
Standard: Damit teilen Sie aber den alten Traum Gustave Flauberts von der Moderne: Sie machen Kunst, die sich thematisch nicht festgelegt sehen will. Dinge passieren, aber ihre Abfolge entspringt keinem Kalkül.
Häusermann: Um mit Robert Walser zu sprechen: Über dem täglichen Unterricht von Kunst darf die Fröhlichkeit nicht eingebüßt werden! Das ist vielleicht ein Grundmotor, eine solche Welt erfinden zu wollen. Paul Scheerbart macht genau dasselbe, dieser Spinner: Er sucht sich eine materielle Idee, und von da an wird es für ihn bitterer Ernst. Von nun an probiert ein solcher Künstler, Gesetze zu schaffen. Er selbst hat sich die Unmöglichkeit als Thema gesetzt: Die Beschäftigung mit einer Maschine, die selbsttätig die Energie zu ihrem eigenen Unterhalt generiert, wird Wirklichkeit.
Standard: Inwiefern Wirklichkeit?
Häusermann: Es muss immerfort solche Leute geben, die wie ich Noten schreiben: die eine materielle Welt schaffen, die dann in den Hintergrund tritt, um einer rein geistigen zu weichen. Es gilt, Klänge zu suchen. Wenn Kinder Bausteine übereinandertürmen, dann muss der Turm doch zusammenfallen. Das ist ja das Blöde an diesen Pieps-Instrumenten: Die äußern sich selbsttätig und nehmen den Kindern damit alles weg. (DER STANDARD, Printausgabe, 27.5.2011)