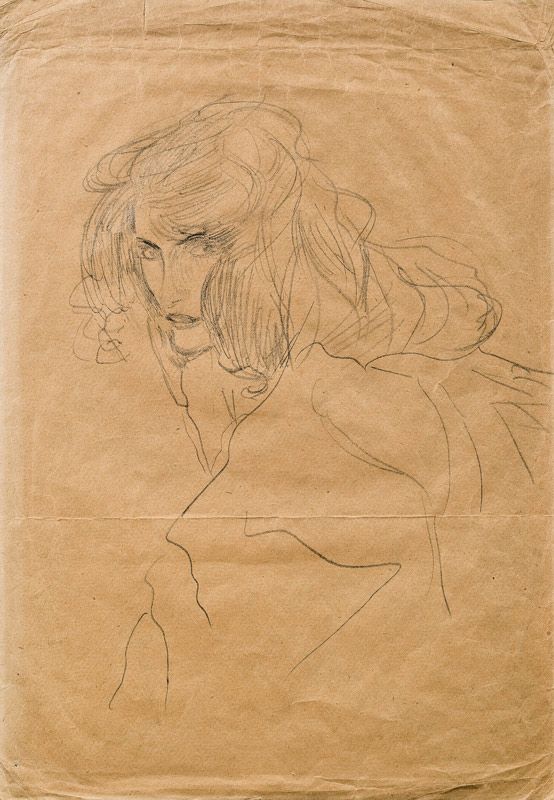Schulden waren eine charakteristische Begleitmusik. Ob Rudolf Leopold über das notwendige Budget verfügte oder nicht, er kaufte, eine Facette seiner Sammeltätigkeit, die ihn von Nebenbuhlern ganz wesentlich unterschied, die nicht jeder nachvollziehen konnte und von der nicht nur der Kunsthandel über Jahrzehnte enorm profitierte. Eine Eigenart, die seinem persönlichen Umfeld entsprechendes Verständnis abnötigte, bisweilen aber auch ein Quäntchen Bewunderung.
Die von seinem Sohn Diethard verfasste Biografie (2003, Holzhausen-Verlag) hält unzählige solcher Anekdoten bereit, etwa aus Leopolds Studentenzeit, wenn die bescheidenen Mittel, die er sich über Nachhilfestunden zuverdienen musste, nicht ausreichten. Wenn er immer wieder Bilder im Dorotheum versetzte und die, wie er sie bezeichnete, Wucherzinsen in Kauf nahm. Dazu den Schmerz, da er "viele Schiele-Bilder den größeren Teil meines Sammlerlebens nicht bei mir zuhause ansehen konnte, denn die waren immer wieder in den Depots der Banken" . Die Gier nach Qualität blieb ungeachtet lästiger Finanzierungsfragen. Für die Kunst wohlgemerkt, denn für den Hunger zwischendurch tat es ein Butterbrot, manchmal auch ein Apfel.
Maßlos bis zuletzt
Um singuläre Hauptwerke zu bekommen, beschrieb er seine Erfahrungswerte, muss man bereit sein, mehr als die aktuell geläufigen Preise zu investieren, ja, den Marktwert auch schon mal enorm zu überzahlen. Solche Chancen musste man nutzen, genau in dem Moment, in dem das Objekt der Begierde angeboten wird - nicht erst, wenn das notwendige Budget gesichert ist. Immer wieder musste sich Leopold von Bildern und Blättern trennen, um noch Bedeutenderes erwerben zu können. Auch nach dem Verkauf seiner (ersten) Sammlung und der Gründung der Leopold-Museum-Privatstiftung 1994 hamsterte er weiter. Als das Museum 2001 eröffnet wurde, drängten daheim in Grinzing die Bilderstapel, Blättermappen, Möbel und Skulpturen längst wieder in die frei gewordenen Zimmer nach. Die Sammlung Leopold II wuchs bis zuletzt. Glaubt man Gerüchten, dann bis wenige Stunden vor seinem Tod. Gesichert ist, dass er vom Krankenbett aus übers Telefon mitsteigerte und sich den einen oder anderen Kandidaten zur Ansicht ins Spital liefern ließ.
Maßlos in Liebe, Hass, Leidenschaft und Opferbereitschaft für das, was zu erleben und zu erleiden er für wert hielt, fasste es Kinsky-Chef Otto Hans Ressler (Parnass, Heft 3/2010) in seinem Nachruf auf den Künstler Leopold zusammen. Dass der Kassasturz in den Wochen nach seinem Tod kein Guthaben aufwies, war eine logische Konsequenz.
Also trennt sich Elisabeth Leopold von einem kleinen Teil, um den großen und wichtigen Kern zu erhalten. In der Leopold'schen Tradition wird zeitgleich das Sammlungsprofil geschärft. Im Zuge der 82.Kunstauktion stehen im Kinsky (30.11./1.12.) rund 70 Bilder und Jugenstil-Objekte im Angebot. Jetzt verlautbarte das Dorotheum eine Sonderauktion, in der am 7. Dezember 190 mit dem Gütesiegel "Sammlung Leopold II" ausgestattete Positionen zumindest 1,15 Millionen Euro einspielen sollen. Ein repräsentativer Querschnitt heimischer Kunstgeschichte auf den ersten Blick. Auf den zweiten freilich mehr: 190 leidenschaftliche Momente eines Sammlerlebens, in denen sein Gespür über den Kauf entschied. 190 Chancen für die Nachwelt und ehemalige Konkurrenten, die es zu nutzen gilt. (Olga Kronsteiner, DER STANDARD/ALBUM - Printausgabe, 20. November 2010)