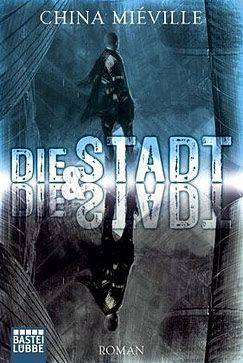
China Miéville: "Die Stadt & die Stadt"
Broschiert, 427 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2010.
Es beginnt mit etwas so Simplem wie einem Mord: Polizeiinspektor Tyador Borlú wird in eine heruntergekommene Wohnsiedlung der Stadt Besźel gerufen, wo die Leiche einer jungen Frau gefunden wurde. Doch wo liegt die Küstenstadt Besźel eigentlich - und wann? Flüchtlinge vom Balkan werden erwähnt, und Namen wie Ramira Yaszek oder BudapestStrász suggerieren Osteuropa ... eine Interpretation, die der Autor in einem Interview in Frage stellte. Verfremdungselemente erschweren die Einordnung zusätzlich: Wölfe streifen zwischen den Gebäuden umher und im Stadtgebiet werden seltsame archäologische Artefakte ausgegraben. Und doch scheinen wir uns im Hier und Heute zu befinden - das legt die Erwähnung von Handys, HipHop und spätestens einer David-Beckham-Frisur nahe. Rund um die Stadt wirkt die Welt also vertraut, doch innerhalb der Stadtgrenzen ... alles andere als das. Am Ende der Tatortbesichtigung hat Borlú kurz Blickkontakt mit einer alten Frau, die zwar auf der Straße, aber nicht in seiner Stadt steht - rasch wenden sich die beiden voneinander ab, und der Leser wird kopfüber in eine der bizarrsten Worldbuilding-Varianten der letzten Jahre geworfen. Umso bizarrer, weil sie vollständig ohne Phantastik-Elemente im herkömmlichen Sinne auskommt.
Denn es sind zwei Stadtstaaten, die sich denselben geographischen Raum teilen: Besźel und Ul Qoma. Keine Dimensionsschranke, kein Quantenzustand, keine Nebel von Avalon oder welcher Trick aus dem Genre-Hut auch immer trennt die beiden Städte, es ist alleine die Macht der Zeichen und der Konvention, wie diese zu lesen sind: Architektur, Kleidungsstil, Körperhaltung oder Verwendung von Farben sind die äußeren Anzeichen zweier sprachlich, religiös und kulturell völlig voneinander getrennter Einheiten. Sie bestimmen, was für einen zu existieren hat und was man nichtsieht. Es gibt totale Gegenden, die ausschließlich Besźel oder Ul Qoma zugeordnet sind, aber auch viele Deckungsgleichen, die geographisch beiden Städten angehören. Die Bewegung durch eine solche von beiden Seiten genutzte Zone liest sich wie folgt: Ich ging zu Fuß, an den Backstein-Arkaden entlang: Oben, wo die Gleise verliefen, waren sie extern, aber nicht bei allen reichte das Fremde bis ganz nach unten. Die, die ich sehen durfte, beherbergten kleine Läden und besetzte Wohnungen, alles mit künstlerisch wertvollen Graffiti dekoriert. In Besźel war es eine ruhige Gegend, aber die Straßen wimmelten von denen anderswo. Ich nichtsah sie, aber es kostete Zeit, sich zwischen ihnen hindurchzuschlängeln. - Es folgt eine Reihe faszinierender (Nicht-)Begegnungen und (Nicht-)Beobachtungen: Ein Zug, der an Borlús Wohnungsfenster vorbeirattert und doch nicht da ist, Gebäude, deren Stockwerke unterschiedlichen Städten angehören, und vieles mehr. Für Außenstehende ist die sozial erlernte selektive Wahrnehmung eine gewaltige Herausforderung; Asylsuchende bleiben in Lagern, bis sie das Nichtsehen beherrschen, und selbst TouristInnen müssen vor der Einreise ein Examen absolvieren.
Der Brite China Miéville ist der Schöpfer einzigartiger Welten - und hat offenbar eine Vorliebe für urbane Milieus der phantasmagorischen Art: Sei es die unvergleichliche Stadt New Crobuzon in Miévilles "Bas-Lag"-Romanen, Londons Wunderland-artige Schwesterstadt "Un Lon Dun" im gleichnamigen Roman ... oder gleich eine sehr, sehr seltsame Variante Londons selbst im heuer erschienenen Roman "Kraken" (was die einzig schlechte Nachricht für Miéville-Fans ist: auch 2010 wollte er wieder nicht nach Bas-Lag zurückkehren). Für das auf vollkommen andere Weise bizarre Konglomerat Besźel/Ul Qoma ließ sich Miéville eigenen Angaben nach von mitteleuropäischen Autoren inspirieren, etwa Franz Kafka (am stärksten verdichtet wohl in der Beschreibung der Kopula, dem bürokratischen Nabel der beiden Städte) und dem weniger bekannten Bruno Schulz. Stilistische Anleihen nahm er hingegen bei Dashiell Hammett und Raymond Chandler - immerhin handelt es sich um eine Cop-Geschichte, die einen weniger ausschweifenden Schreibstil als den von Miéville gewohnten Mutanten-Barock erforderte. Eine Cop-Geschichte mit allen Topoi, die so dazugehören, übrigens: Politische Interessen, die die Ermittlungen behindern, die nicht immer erfolgreichen Bemühungen ZeugInnen zu beschützen - und die zeitweilige Versetzung in einen anderen Bezirk, wo man sich erst den Respekt der dortigen BerufskollegInnen erarbeiten muss.
Im Zuge der Ermittlungen schälen sich langsam zwei große Geheimnisse aus dem Nebel: Zum einen die allseits gefürchtete Entität Ahndung, die stets wie aus dem Nichts auftaucht, um Grenzbrüche zwischen den beiden Städten zu bestrafen. Denn Interaktion über die "Grenzen" von Besźel und Ul Qoma hinweg ist ein noch schlimmeres Verbrechen als Mord. Die BürgerInnen bezeichnen Ahndung als es; niemand kann die Form seiner Existenz so recht wahrnehmen, doch alle fühlen sich von ihm beobachtet - zu Recht übrigens. Zum anderen Orciny, eine hypothetische dritte Stadt, die sich zwischen den beiden anderen verbergen soll - angeblich nur ein Kindermärchen, doch muss sich Borlú bald ernsthaft mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass Orciny tatsächlich existieren könnte. - Angesichts solcher Mysterien gäbe man auf die Aufklärung des Mordfalls, der immerhin das eigentliche Handlungsgerüst des Romans ausmacht, keinen feuchten Furz mehr ... wäre der Mord nicht eng mit ihnen verbunden.
Die einzigartige Parallel-Existenz der beiden Städte ließe sich auf vielerlei Weise interpretieren: Die schäbig gewordenen Gebäude Besźels baden im (natürlich "unsichtbaren") Licht der Bürotürme Ul Qomas - ein möglicher Hinweis auf strikte Trennung zwischen sozioökonomischen Schichten; andererseits werden Phasen der Geschichte erwähnt, in denen Ul Qoma der ärmere Teil war. Ein Bruch zwischen Tradition (hier: das vergleichsweise altmodische, aber demokratische Besźel) und aufgepfropfter Moderne (versinnbildlicht im wirtschaftlich geöffneten, aber diktatorisch regierten Ul Qoma der Glasnostroika) wäre eine andere Sichtweise. Und nicht nur die nebulose geographische Zuordnung der Zwillingsstädte lässt an Ex-Jugoslawien denken: Miéville schildert sie als extrem heterogenen Fleckerlteppich aus Sprachen, Religionen und Ethnien - zwei unterschiedliche Alphabete für etwas, das im Grunde zwei Varianten derselben Sprache sind, hat unverkennbare Anklänge an das einstige Serbokroatisch. Wie die meisten guten Erzählungen lässt sich auch "Die Stadt & die Stadt" (2009 als "The City & The City" erschienen und heuer mit dem Hugo ausgezeichnet) nicht auf eine einfache Interpretation herunterbrechen. Selbst wenn auf die Historie der beiden Städte eingegangen wird, bleibt letztlich offen, ob sie getrennt voneinander gegründet wurden oder ob es eine Ur-Stadt gab, die dann eine Spaltung erlebte.
Und vielleicht geht es ja auch "einfach" um das Konzept Stadt an sich - Städte als kulturelle und von Zeichen gesteuerte Konstrukte. Denn was hält einen im Stau steckenden Autofahrer - physisch! - davon ab, auf Gehsteige und Grünflächen auszuweichen? Er nichtsieht die freien Flächen, weil sie für ihn nicht da sein dürfen. Für SemiotikerInnen wäre "Die Stadt & die Stadt" ein gefundenes Fressen - und für alle, die einen wundervoll seltsamen, und doch in sich stimmigen und intelligenten Roman lesen wollen, ebenso. Als persönliches P.S. darf ich noch hinzufügen, dass er sogar für meine letzten Monat erwähnte Abneigung gegen Verfolgungsjagden eine Ausnahme gefunden hat. Die wird nämlich völlig gegenstandslos, wenn sich erst Schrödingers Fußgänger auf die Flucht begibt ...
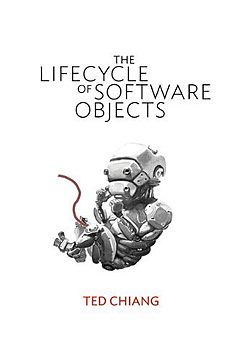
Ted Chiang: "The Lifecycle of Software Objects"
Gebundene Ausgabe, 150 Seiten, Subterranean Press 2010.
"Ohne Herz wären wir nur Maschinen." - Dieser Satz aus der Autowerbung geht mir derzeit nicht mehr aus dem Sinn. Was sich deutlich angenehmer anfühlt als beim idiotischen "Zähm die Straße!", rührt es doch an eine der Grundfragen der Science Fiction: Ab wann darf/muss etwas künstlich Geschaffenes als lebendig betrachtet werden - und ab wann gar als intelligent? Ted Chiang, der vielleicht beste Kurzgeschichten-Autor unserer Tage, zieht stets eine wissenschaftliche Theorie oder Methode als Ausgangspunkt für eine Erzählung heran, die das Thema dann in allen Details und Konsequenzen beleuchtet. In "The Lifecycle of Software Objects", Chiangs bislang längstem Werk, ist es der Turing-Test.
In Jahressprüngen und entlang einer dezent im Hintergrund bleibenden Liebesgeschichte schildert Chiang das Aufwachsen einer neuen Spezies, der im virtuellen Raum von "Data Earth" existierenden digients. Ana Alvarado wollte als Kind Dian Fossey und Jane Goodall nacheifern - bis zur Zoowärterin hat sie es immerhin gebracht. Über den zweiten Bildungsweg gelangt sie in die Software-Industrie und zum Unternehmen Blue Gamma, das digients entwickelt. Für deren Design ist Derek Brooks zuständig - seiner Kreativität entspringen unter anderem die Panda-Zwillinge Marco und Polo, das Löwenbaby Lolly und der Steampunk-Roboter Jay (das Buch enthält übrigens eine Reihe sehr hübscher Illustrationen). Sie alle lernen wir als virtuelle Babies kennen und verfolgen über die Jahre hinweg ihre Reifung zu eigenständigen Persönlichkeiten. Ein zentrales Element der Novelle ist, dass diese Entwicklung nicht in einem hermetisch abschlossenen Labor stattfindet, sondern in der Öffentlichkeit. Schließlich geht es von Anfang an um kommerzielle Verwertbarkeit: KundInnen sollen die digients kaufen und sich an ihrer "Elternrolle" erfreuen - die gemeinsame Online-Erziehung wiederum nimmt Einfluss auf den Fortgang des Projekts. Man tauscht sich in Diskussionsforen aus - und bildet eine Selbsthilfegruppe, als dem langsam veralternden "Data Earth" die NutzerInnen davonlaufen. Für das neue Ding "Real Space" aber sind Jay & Co nicht kompatibel - die schnelle Abfolge von Moden und Technologien im IT-Bereich droht für sie buchstäblich zum Ende der Welt zu werden.
"The Lifecycle of Software Objects" ist beileibe kein Action-lastiges Werk. Was es so faszinierend macht, ist der Entwicklungsprozess der virtuellen Wesen, der manchmal frappant dem menschlicher Kinder ähnelt, dann aber wieder krass davon abweicht. Als Lolly zur allgemeinen Verblüffung zum ersten Mal das Wort "Fuck!" äußert, gibt das 1:1 die Erfahrung zahlloser Elternpaare mit ihren Sprösslingen wieder. Die Reaktion darauf sieht freilich anders aus: Per roll back werden Lollys Erfahrungen bis zum Aufschnappen des F-Worts gelöscht ... leider geht dadurch auch einiges Neuerlerntes verloren, an dem sich die menschlichen ZuschauerInnen zuvor noch entzückt hatten. Chiang wertet niemals, sondern schildert in sachlicher und ein wenig melancholischer Weise, was technisch möglich ist und was die Folgen sind, wenn man es anwendet. Was kurz darauf eine rührende Szene noch deutlicher macht, wenn Marco und Polo von einem geschwisterlichen Streit so mitgenommen sind, dass sie selbst um einen roll back bitten, um wieder unbeschwert miteinander umgehen zu können. Am Ende werden wie bei jedem anderen Erziehungsprozess auch die "Eltern" akzeptieren müssen, dass ihre "Kinder" eigene Entscheidungen treffen dürfen. Selbst wenn sie mit diesen nicht einverstanden sind. Selbst wenn es um das Angebot eines Unternehmens geht, das den digients den Datentransfer in den "Real Space" finanziert, wenn sie Kopien ihrer selbst für virtuellen Kuschelsex zur Verfügung stellen. "How else are you going to raise the money you need?" - How many women have asked themselves the same question, Ana wonders. "So it's the oldest profession." Doch muss sie zur Kenntnis nehmen, dass ihre Schützlinge anders gewichten.
In der Kurzgeschichte "Liking What You See: A Documentary" wog Ted Chiang das Für und Wider einer Gehirnoperation, durch die man andere Menschen nicht mehr als "schön" oder "hässlich" bewerten kann, anhand fiktiver Interview-Aussagen von BefürworterInnen und GegnerInnen des Eingriffs ab. In "Lifecycle" fließt diese stilistische Taktik in abgemilderter Version in Form der E-mail-Diskussionen der digient-Eltern ein. Die Erzählform wird dadurch nicht gestört: Chiangs Kurzgeschichten hatten ohnehin stets den Charakter einer gelungenen Illustration eines Postulats - ob es sich nun um das Selbstkonsistenzprinzip bei Zeitreisen handelt ("The Merchant and the Alchemist's Gate") oder die Konsequenzen eines Lebens in einem geschlossenen Universum ("Exhalation", "Tower of Babylon"). Der Mann würde einen guten Lehrer abgeben!
Ted Chiang erteilt in "Lifecycle" der naiven SF-Vorstellung eine Absage, dass man eine KI einfach einschalten kann. Wirkliche Intelligenz muss über einen langen Zeitraum erworben werden. Wenn natürliche und künstliche Intelligenzwesen einander so grundlegend ähneln, muss sich dies aber auch im Umgang mit ihnen niederschlagen. Obwohl die Hälfte der Hauptfiguren Software-Geschöpfe sind, entspinnt sich hier also eine zutiefst menschliche Geschichte ... womit die eingangs aufgeworfene Frage zu einer Antwort findet: Formuliert von Ana, als sie ein weiteres "unmoralisches Angebot" für ihre digients erhält: They want something that responds like a person, but isn't owed the same obligations as a person, and that's something she can't give them. No one can give it to them, because it's an impossibility.
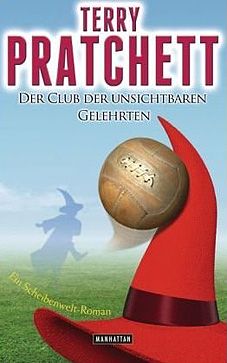
Terry Pratchett: "Der Club der unsichtbaren Gelehrten"
Kartoniert, 507 Seiten, € 18,50, Manhattan 2010.
In der inoffiziellen Gruppierung nach Hauptfiguren würde der aktuelle Scheibenwelt-Roman (2009 als "Unseen Academicals" erschienen) wohl als "Zauberer-Geschichte" geführt werden. Zumindest sind aus dem über die Jahrzehnte hinweg kontinuierlich angewachsenen Ensemble wiederkehrender Charaktere diesmal Mustrum Ridcully, polternder Erzkanzler der Unsichtbaren Universität, und seine rechte Hand Ponder Stibbons diejenigen, die den größten Erzählraum bekommen. Stibbons ist wie gehabt die Stimme der Vernunft an der Universität - einem Ort, wo diese naturgemäß in der Regel ungehört verhallt. Im aktuellen Roman setzt Stibbons allerdings ein Thema auf die Agenda, das sich nicht ignorieren lässt: Ein altes Dokument zeigt, dass ein Teil der Stiftungsgelder, aus denen sich die UU finanziert, nicht mehr ausbezahlt wird, wenn die Zauberer nicht in regelmäßigen Abständen ein Fußballspiel austragen. Eine kurze Kalkulation ergibt Grauenhaftes: Die tägliche Käseplatte würde dann nur mehr drei Sorten umfassen - das schreckt die robentragenden Couch Potatoes effektiver hoch als jeder drohende Weltuntergang.
Doch sind die eigentlichen Hauptfiguren von "Der Club der unsichtbaren Gelehrten" andere, neue - und damit wechseln wir, wortwörtlich, vom Ober- ins Untergeschoss Ankh-Morporks. Da wäre zum Beispiel Glenda Zuckerbohne, Nachtköchin an der UU - drall, patent und nie um einen helfenden Ratschlag verlegen; nur in Liebesdingen beruht ihr ganzer Erfahrungsschatz auf den Romanschnulzen, die sich unter ihrem Bett stapeln. Glendas Helferin Juliet Stollop ist das exakte Gegenteil: So hinreißend schön, dass sie selbst als gefälschtes Zwergen-Model - mit Bart! - Aufsehen erregt; bedauerlicherweise aber auch ein ausgemachter Airhead. Straßenkicker Trev Likely, selbst keine Säule der Gesellschaft, stört Juliets schlichtes Gemüt nicht - problematischer scheint es da schon, dass die Likelys und die Stollops verfeindeten Fußball-Clubs angehören: Romeo und Julia im Trikot. Trev und sein Kumpel Nutt stehen als diejenigen, die die Kerzen der Zauberer mit schöner Tropfenbildung versehen, auf der zweituntersten Stufe der beruflichen Hierarchie (darunter gibt es wirklich nur noch die Dochttaucher ...) - nicht von ungefähr werden Wege zum sozialen Aufstieg zu einem der Kernthemen des Romans. Wofür der kleine (manchmal aber seltsam groß wirkende) Nutt, der mangels greifbarer Spezieszuordnung von allen als "Goblin" betrachtet wird, zumindest geistig gerüstet scheint: Er saugt Wissen auf wie ein Schwamm, verarbeitet es und verblüfft seine Umgebung mit akademischer Ausdrucksweise. Die steht übrigens in starkem Kontrast zur überraschend derben, oft auch zotigen Sprache des Romans - ob diese nun eher am neuen Übersetzer liegt oder daran, dass wir endlich mal ausführlich die morporkische Unterschicht kennenlernen, bleibt offen.
"Der Club der unsichtbaren Gelehrten" enthält viele ernsthafte Züge. Da kommt Glenda, die "Karriere" nur als etwas für Leute, die an keiner Arbeit festhalten können, sieht, ins Grübeln darüber, ob ihre Ratschläge in Sachen vernünftiger Berufswahl Juliet die Zukunft verbauen. Und schlimmer noch: Ob ihre ständige Bereitschaft für Juliet einzuspringen dazu beigetragen hat, Juliet dumm zu halten. Endgültig einen Kloß im Hals verspürt man, wenn Nutt anderen unverblümt die bange Frage seines Lebens stellt: "Bin ich etwas wert?" - Die Scheibenwelt hat seit dem 1983 erschienenen "The Colour of Magic" in der Tat einen weiten Weg zurückgelegt. Musste sie auch, sonst wäre sie nicht zur erfolgreichsten Fantasy-Serie der Welt aufgestiegen, sondern binnen kurzem in ihrer eigenen Selbstverarschung implodiert.
Auch im gewohnten Pratchett'schen Aphorismen-Ausstoß scheint sich ein wachsendes Bedürfnis auszudrücken, etwas Wahres, Dauerhaftes zu sagen. Was in ironischen Formulierungen natürlich immer noch am besten kommt - etwa wenn es um reißerische Presseberichterstattung geht: "Ich glaube wirklich, dass sie es für ihre Aufgabe halten, die Leute zu beruhigen, indem sie sie zuerst einmal darüber informieren, weshalb sie völlig aus dem Häuschen geraten und sich schrecklich Sorgen machen sollten." - Und all denen zum Trotz, die mit leichtem Snobismus darauf verweisen, dass sie die Bücher natürlich nur im Original lesen, keeeein Vergleeeeeich und so - manches Wortspiel funktioniert auch in der Übersetzung: Diese Frage ging über Stollops Verstand, ohne auch nur das Bein heben zu müssen.
Für humoristische Highlights sorgen neben einem chaotischen ersten Fußball-Training der Zauberer unter anderem der Nekromant Hix - "Totenbeschwörer machen's die ganze Nacht!" - mit dem vertraglich garantierten Recht auf Regelbruch und eine Zwergen-Modenschau, welche die branchenübliche Hysterie noch mit Spitzhacken, Presslufthämmern und loderndem Schmiedefeuer kombiniert. Nicht zu vergessen der Chor der Universität, der eine Händel-artige Lobpreisung auf den Star-Kicker des UU-Teams einstudiert, ehe sich während des Spiels dann doch "Ein Makaronah, es gibt nur ein Makaronah, ein Makarooo-naaah!" durchsetzt. Dass der Besungene auf vollständige Nennung aller seiner Titel besteht, was im Endeffekt eine ganze Seite einnimmt, bremst den Stadionjubel allerdings erheblich.
Womit wir beim eigentlichen Thema des Romans wären: Fußball. Dass Tritt-den-Ball, ein blutiges Massen-Gerangel, in den Straßen Ankh-Morporks allgegenwärtig ist, erfahren wir zwar erst aus diesem Roman. Im Sachbuch "The Folklore of Discworld" ist Terry Pratchett jedoch schon einmal auf die wüsten Vorläufervarianten des Fußballspiels in unserer Welt eingegangen. Dass dies im aktuellen Roman auf eine Art Kulturkampf zwischen dem Straßenfußball und der neuen - angeblich aber auf uralten göttlichen Gesetzen beruhenden - Elf-gegen-Elf-Variante hinausläuft, wird niemanden überraschen. Pratchett, der immer wieder den "Fluss der Meme" zwischen Rund- und Scheibenwelt betont, greift damit ein aktuelles Thema auf. Ob FC Liverpool oder Schalke 04, der grundlegende Konflikt zwischen denen, die an den "Wurzeln" des Fußballs festhalten wollen, und der fortschreitenden Kommerzialisierung des Sports und seiner Entwicklung hin zum lukrativen Massen-Entertainment ist überall derselbe. Der Fußball befindet sich im Umbruch - erst recht, wenn die Politik ins Spiel kommt (wie hier, wo ein Lord Vetinari wieder mal ganz eigene Pläne hegt). Das Erstaunliche an "Der Club der unsichtbaren Gelehrten" ist, dass der Roman dabei zu keiner klaren Conclusio kommt - wie er, man muss es leider sagen, insgesamt etwas zerfasert. Von der Grundidee her mag sich mancher an die früheren Romane "Voll im Bilde" ("Moving Pictures") und "Rollende Steine" ("Soul Music") erinnert fühlen. Bei diesen war Pratchetts Linie aber klar: Moderne Mythologien - Hollywood und Rock-Musik - sind mit den alten inkompatibel, gefährden die Fundamente der Fantasywelt - und werden entsorgt. Und der Fußball? Das entscheide jeder nach dem Lesen selbst.
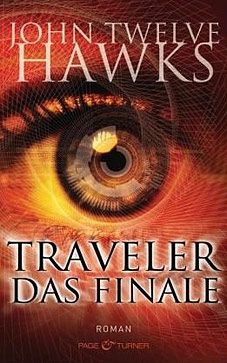
John Twelve Hawks: "Traveler. Das Finale"
Gebundene Ausgabe, 413 Seiten, € 20,00, Page&Turner 2010.
Hand auf's Herz: Wer fühlt sich durch das inflationäre Auftreten von Sicherheitskameras wirklich sicherer? Immerhin: Wer Opfer eines Happy Slappings in der U-Bahn wird, kann sich jetzt nachträglich seine Misere in der TV-Berichterstattung ansehen ... aber ist das gleichbedeutend mit Sicherheit? 2005 startete der angeblich allen Netzen abholde Autor mit dem Pseudonym "John Twelve Hawks" seine "Traveler"-Trilogie, deren Abschlussband nun erschienen ist. Der richtige Lesestoff für alle, die die jährliche Vergabe der Big Brother Awards mit Interesse und die Wege der Einsatzkommandos von Google Street View mit Argwohn betrachten - und die zu den aktuellen Querelen um Facebook sagen: "Ich hab's ja schon immer gewusst." Alleine schon wie die RomanprotagonistInnen in den Vorgängerbänden (hier der Rückblick) einen ausgeklügelten Parcours laufen, um den omnipräsenten CCTV-Cams zu entgehen, wird den einen oder die andere dazu verleiten, künftig etwas genauer zu schauen, wo man im öffentlichen Raum überall beobachtet wird. - Wir reden hier nicht von Paranoia, schließlich sind wachsende Überwachung, Datenweitergabe und die schleichende Erosion der Privatsphäre prägende Entwicklungen unserer Zeit. Der verschwörungstheoretische Aspekt kommt erst da ins Spiel, wo der Autor mit erlaubter dichterischer Freiheit sämtliche Phänomene auf eine einzige lenkende Macht im Hintergrund zurückführt.
Diese Macht ist die Bruderschaft der Tabula, die seit Anbeginn der Zivilisation eine total kontrollierte Gesellschaft anstrebt. Ihr Ideal ist das Panopticon, ein vom britischen Philosophen Jeremy Bentham entwickeltes gefängnisartiges Gebäudeprinzip, das umfassende Überwachung aller BewohnerInnen (bzw. Insassen) ermöglicht. Die Technik des 21. Jahrhunderts rückt dieses Konzept erstmals in den Bereich des Verwirklichbaren, und zwar auf globaler Ebene. Natürlich regt sich dagegen Widerstand - in dessen Kern die Traveler stehen: Visionäre, die Kraft ihres Geistes andere Welten bereisen und somit alternative Lebensweisen aufzeigen können. John Twelve Hawks spitzt diesen fundamentalen Konflikt sogar noch weiter zu, auf einen Bruderkrieg: Michael und Gabriel Corrigan sind Söhne eines Travelers und beide ebenfalls mit der Gabe ausgestattet. Doch während Gabriel den Widerstand leitet, ist Michael in die Tabula eingesickert, übernimmt nun sogar deren Führung und gleitet nach und nach in einen Machtwahn ab: Skrupellos "beendet er die Geschichten" lästig gewordener MitarbeiterInnen und fördert eine Politik der Angst: Inszenierte Terroranschläge und Kindesentführungen sollen die Bevölkerung weichklopfen und für die Produkte der Tabula empfänglich machen: Vom Norm-All-Programm, das biometrisch den Gemütszustand misst, bis zum Schutzengel-Chip für Kinder.
Die gegensätzlichen Weltentwürfe der beiden Brüder äußern sich in zwei Kapitel-langen Manifesten: Eine Ansprache von Michael an seine Firmenbelegschaft und eine von Gabriel an die Öffentlichkeit. Rein stilistisch ist es immer etwas problematisch, wenn ein Romanautor vorübergehend die Romanform verlässt, um sich aus dem Munde einer Hauptfigur direkt an die LeserInnenschaft zu wenden (so liest sich die Videobotschaft Gabriels an die Welt zwar ehrenwert ... doch darf bezweifelt werden, dass sie in der geschilderten Form als Video wirklich von Computer-NutzerInnen weltweit zur Kenntnis genommen würde). Die Absicht stört hier etwas die Ausführung - dass Twelve Hawks auch sehr gelungene Passagen schreiben kann, zeigt er da, wo es um Lokalkolorit geht. Etwa im Satz "Alte Renaults kommen zum Sterben nach Kairo" oder in der Beschreibung von Zokus (subkulturellen "Stämmen" von Jugendlichen) in einem japanischen Park, wo sich Rockabillys dicht an dicht neben Goths, "Zombies" und Faschisten zur Schau stellen. Geradezu rührend ist es, wenn der Kampfsportler Hollis Wilson auf seine ganz persönliche Queste geschickt wird und in einem abgelegenen japanischen Dorf landet, in dem nur noch die Alten geblieben sind: Immer wenn er für sie eine Arbeit verrichtet, die Muskeleinsatz erfordert, geht ehrfürchtiges Raunen und Klatschen durch die Mummelgreise.
Diejenigen, die die vorangegangenen Teile gelesen haben, wird es interessieren zu erfahren, dass in Teil 3 (im Original: "The Golden City") einige zuvor nur erwähnte Sphären besucht werden - Parallelwelten, die mit der unseren verbunden sind; darunter auch eine, die sich als totalitäre Weiterdenkung des platonischen Staats aus der "Politeia" erweist. Dass ein Traveler per Astralleib reist, in der neuen Welt aber offenbar wieder einen feststofflichen Körper besitzt (während sein "alter" noch daheim liegt), ist ein Widerspruch, der nicht geklärt wird. Überhaupt wird im "Finale" der Trilogie mehr denn je mit esoterischen Elementen gespielt: Zwischen den Welten liegen Barrieren aus den Elementen Erde, Feuer, Wasser und Luft, mehrfach wird in recht platter Weise gesagt, dass man in der Antike noch das Wissen hatte, wie man in andere Sphären reist, und alle Hoffnung im Kampf gegen das Überwachungssystem beruht auf dem Licht, das in jedem lebendigen Wesen leuchtet. Eine ungewollt ironische Metapher, denkt man an einen anderen Technologiekritiker: Paul Virilio bezeichnete Überwachungskameras als Teil des "indirekten Lichts", weil sie zuvor Ungesehenes sichtbar machen.
So vage eine der Hauptfiguren den Begriff "Spiritualität" findet, so unklar bleibt auch die Rolle der Religion. Teilweise wird darüber geätzt - Moses' brennender Dornbusch als "verkokelte Pflanze" -, gleichzeitig ist aber auch eine eindeutige Häufung von Geistlichen im Widerstand festzustellen. Und wenn Gabriel sich von der Runde seiner AnhängerInnen verabschiedet, dann erinnert er nicht zu knapp an einen Guru, der seine Gemeinde segnet. Insgesamt haben die "Traveler"-Romane eine ähnliche Entwicklung wie eine andere Trilogie genommen, nämlich "Matrix". Wenn es dann an die zentrale Botschaft geht, nämlich Eigenverantwortung zu übernehmen, stellt sich letztlich allerdings die Frage, wozu überhaupt die Eso-Schiene befahren werden musste. - An dieser Stelle sei aber noch eingeflochten, dass Band 3 zwar der schwächste Teil der Trilogie ist, dabei aber immer noch spannend - dafür sorgen alleine schon die diversen Kampfsporteinlagen der Harlequins, der resoluten BeschützerInnen der Traveler. Die dürften auch nicht unwesentlich dazu beigetragen haben, dass sich 20th Century Fox bereits die Filmrechte an der Trilogie gesichert hat.
Obwohl der Roman "Finale" heißt, tun sich in ebendiesem einige unerwartete Leerstellen auf. Wer weiß, vielleicht stützt der Eindruck, dass hier etwas unvollständig geblieben ist, ja die Meinung derjenigen, die glauben, dass sich hinter "John Twelve Hawks" die Autorin Kage Baker verbarg, die im Jänner dieses Jahres verstorben ist. - Das hieße aber wirklich nur einen Namen aus den zahllosen, die im Netz kursieren, herauszugreifen. Drei Möglichkeiten gibt es im wesentlichen: a) es handelt sich um einen Autor, der es mit der Botschaft seiner Romane wirklich ernst nimmt und eine totale Offline-Existenz führt. b) es ist ein wirksamer Marketing-Trick - oder c), durchaus mit b) kompatibel, es handelt sich um eine/n Autor/in, der/die nicht mit dem für die Trilogie gewählten Genre in Verbindung gebracht werden will, weil er/sie sonst ganz andere Bücher schreibt. Wer die Antwort weiß: Pst, verraten Sie's nicht dem System!
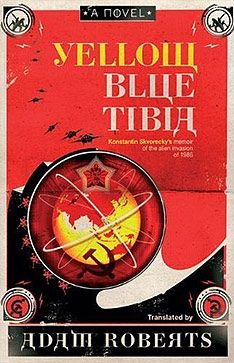
Adam Roberts: "Yellow Blue Tibia. Konstantin Skvorecky's Memoir of the Alien Invasion of 1986"
Broschiert, 488 Seiten, Gollancz 2010.
Werfen wir ausnahmsweise zu Beginn einen Blick darauf, was der Autor mit seinem Buch beabsichtigt hat - soweit man dieser im Nachwort geäußerten Absicht trauen kann, schließlich ist der Brite Adam Roberts ein Spezialist für ausgefallene Ideen ebenso wie für Parodistisches. In "Yellow Blue Tibia" (der Titel ist ein Wortspiel; so ähnlich klingt "Ich liebe dich" auf Russisch) ging es ihm seinen Worten nach darum, zwei scheinbar unvereinbare Phänomene unter einen Hut zu bringen: Erstens dass es keine UFOs gibt und zweitens dass diese dennoch im Leben unzähliger Menschen eine große Rolle spiel(t)en. Die Lösungsvarianten für dieses Problem scheinen begrenzt zu sein - ich wage aber zu bezweifeln, dass irgendjemand auf dieselbe gekommen wäre wie Roberts. Ich bin auch immer noch nicht hundertpro sicher, ob ich sie verstanden habe.
Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs bestellt Stalin ein halbes Dutzend sowjetischer Science-Fiction-Autoren auf seine Datscha, darunter auch den Ich-Erzähler des Romans, Konstantin Skvorecky. Hier unterbreitet er ihnen seinen genialen Plan für die Zeit nach dem unweigerlich bevorstehenden Triumph über den US-Kapitalismus. Ganz im Sinne der Politik der Angst (siehe John Twelve Hawks) braucht es schließlich auch danach irgendeinen Bedrohungsfaktor, mit dem sich die dann schon globale kommunistische Gesellschaft zusammenhalten lässt - nehmen wir doch außerirdische Invasoren. "A fully peaceful world that is simultaneously united in a great patriotic war!" - was für eine Vision. Und denkt man an die zeitgeschichtliche Aufarbeitung des Zusammenhangs von UFO-Hysterie und Kaltem Krieg, klingt die Wahl durchaus plausibel. - Den armen Autoren stellen sich da plötzlich ganz verzwickte Probleme: Laut zeitgenössischer Sowjet-Propaganda sind Kapitalisten gar nicht in der Lage, Raumfahrt zu entwickeln - aber Kommunisten dürfen die feindlichen Aliens wohl auch keine sein. Ohne viele Worte zeichnet Roberts eine Atmosphäre, die von skurrilem Humor ebenso geprägt ist wie von schmerzlichen Erinnerungen an den gerade erst überstandenen Krieg und von purer Angst. Kein Wunder, dass eine Sturmwolke über ihren Köpfen die Form eines riesigen Walross-Schnauzbarts anzunehmen scheint ...
So nach und nach einigt man sich auf die Plot-Details: Idealer Ort der "Invasion" wäre die Ukraine (nah, aber von der Weltöffentlichkeit nicht so leicht einsehbar), und weil über die Form der Aliens so gar kein Konsens zustande kommen will, bleiben sie eben körperlos und bestehen aus tödlicher Strahlung. Ein netter Auftakt der Geschichte wäre überdies, wenn ein Raumfahrzeug der verhassten Amerikaner von den Aliens abgeschossen würde. - 40 Jahre später denkt sich Konstantin zunächst gar nichts, als die "Challenger" explodiert. Schließlich wurde das Romanprojekt damals ohne Angabe von Gründen kurzfristig abgewürgt, und seitdem hat er nicht mehr daran gedacht. Dann jedoch läuft ihm mit Ivan Frenkel scheinbar zufällig ein längst totgeglaubter Leidensgenosse von damals über den Weg und nervt ihn mit der Behauptung, dass ihre gemeinsam gesponnene Geschichte nun Realität werde. Für die LeserInnen ist damit klar, dass einer der kommenden Handlungsschauplätze Tschernobyl heißen wird. Für Konstantin hingegen wird alles immer unklarer - nicht zuletzt die Frage, worum sich die große Verschwörung, von der Frenkel ständig faselt, nun wirklich dreht: Geht es darum, den Menschen die Existenz von UFOs vorzugaukeln - oder ganz im Gegenteil darum, ihnen deren reale Existenz zu verschweigen?
Was als leicht nachvollziehbare Satire begann, wechselt spätestens dann auf ein anderes Gleis, wenn Konstantin von Frenkel zum Gespräch in ein Restaurant gebeten wird: Ist dieses nun voller Menschen oder leer - und hat Konstantin da gerade etwas in den Nacken gestochen, oder war da doch nichts? Hier beginnt ein sehr seltsamer Zug des Romans, der in weiterer Folge immer stärker in Erscheinung treten wird: Ständig scheint etwas zu passieren und doch auch wieder nicht ... or there was a third option. Roberts legt eine Menge verwirrender Fährten aus und scheut sich auch nicht, die zunehmend in Zweifel zu ziehende Wahrnehmungsfähigkeit seines Protagonisten zusätzlich mit Alkoholeinfluss oder einer kleinen Lobotomie zu zerrütten. Da darf es dann auch nicht verwundern, wenn dieser im Rückblick einander widersprechende Aussagen über seinen eigenen Tod trifft ... unter anderem lernen wir daraus auch, dass es einem das Leben retten kann, wenn man stirbt. - Nicht umsonst wird später auf die Kopenhagen-Interpretation der Quantenmechanik eingegangen: "Yellow Blue Tibia" ist ein Roman, dem die Quantentheorie weniger den Gegenstand als die Struktur der Handlung verliehen hat.
Wie raffiniert der Roman konstruiert ist, zeigt am besten ein Kapitel, das sich um die Redewendung elephant in the room dreht, welche im Englischen eine offensichtliche, aber allseits ignorierte Wahrheit bezeichnet. Roberts bezieht sich damit gleichermaßen auf die große Rahmenhandlung der Erzählung wie auf eine surreale Traumbegegnung Konstantins mit Stalin, in der dieser behauptet, er wäre all the time there in plain sight gewesen ... und auch, zugegebenermaßen etwas platt, auf einen durchschlagenden Auftritt von Konstantins Weggefährtin Dora Norman: Die ist nämlich nicht nur eine Scientology-Gesandte, sondern auch reichlich voluminös - und hat zumindest in der aktuellen Situation nichts gegen die Beleidigung einzuwenden.
"Yellow Blue Tibia" ist kein rein humoristisches Werk - dafür enthält es zu viele tragische und bedrohliche Momente; von den verwirrenden mal ganz abgesehen. Trotzdem sprüht es an vielen Stellen vor absurdem Witz: Etwa wenn Konstantin kläglich daran scheitert, einer Versammlung von UFO-Gläubigen zu erklären, dass er nicht an Außerirdische glaubt. Oder im Auftritt des Taxifahrers (und Nuklearphysikers) Saltykov, der am Asperger-Syndrom leidet, die Emotionen anderer Menschen nur schwer einschätzen kann und dadurch mit dem ständig ironische Kommentare von sich gebenden Konstantin ein Duo abgibt, das in der Hölle geschmiedet wurde. Dass es Saltykov überdies hasst wie die Pest, wenn jemand beim Fahren auf ihn einquatscht, wird zu einem der absurdesten Überraschungseffekte bei einer Flucht im Auto führen, den man je gelesen hat. So langsam muss ich meine Vorbehalte gegenüber Verfolgungsjagden wohl überdenken ...
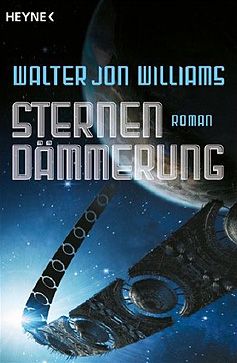
Walter Jon Williams: "Sternendämmerung"
Broschiert, 655 Seiten, € 16,50, Heyne 2010.
Eines der Dinge, die von Walter Jon Williams' "Dread Empire's Fall"-Reihe in Erinnerung bleiben werden, ist sicherlich die - wenn man das überhaupt so sagen kann - realistische, auf jeden Fall aber unromantische Beschreibung der Raumfahrt. Ereilt eine Kampfflotte die Nachricht, dass sie an einem anderen Zielort als dem geplanten gebraucht wird, kann sie nicht einfach so umkehren. Monatelange Brems- und Beschleunigungsmanöver sind für die Umlenkung notwendig. Währenddessen werden die in ihren Stützkäfigen aufgehängten RaumfahrerInnen nicht nur in ihren Körperausdünstungen mariniert, sondern auch vom andauernden Beschleunigungsdruck zermürbt; Kreislaufprobleme und Todesfälle lassen sich nicht vermeiden.
Zugleich erhält diese Langsamkeit eine fast schon metaphorische Bedeutung für die Trägheit des Systems, das den Handlungshintergrund der Romanreihe bildet. Williams hat im Verlauf seiner mittlerweile 30-jährigen Schriftstellerkarriere verschiedenste Varianten einer Herrscherklasse entworfen, die - durchaus auch buchstäblich - hoch über den Köpfen der einfachen UntertanInnen agiert; seien es Konzerne mit Firmensitz im Orbit wie in "Hardwired" (1986) oder die fast schon übermenschlichen "Aristoi" im gleichnamigen Roman von 1992. Gleiches gilt für die selbstgefälligen Adeligen in "Dread Empire's Fall" - doch hat ihr vermeintlich für die Ewigkeit gedachtes Herrschaftssystem in Teil 1 der Reihe (hier der Rückblick) einen tiefen Bruch erlitten. Die Shaa sind endgültig von uns gegangen: Jenes technologisch überlegene Volk, das einst die Menschheit und ein halbes Dutzend andere Spezies in ein rigid gelenktes Imperium getrieben hat. Dessen Zerfall in Diadochenreiche scheint unvermeidlich - das insektoide Volk der Naxiden hat als erstes die Zeichen der Zeit erkannt und startet einen Putsch.
Der imperiumstreue Adel reagiert zunächst eher indigniert als erschrocken - viel zu langsam setzt man Gegenmaßnahmen in Gang, Taktik und Strategie sind überdies veraltet. Nach über 3.000 Jahren (gewaltsam herbeigeführten) Friedens gelten eben "soziale Tugenden" - zum Beispiel das Schiff auf Hochglanz polieren - mehr als Kampfkraft. In der Hand von zwei Flottenoffizieren liegt es, die unflexible Kriegsflotte auf Vordermann zu bringen: der von Kommandant Gareth Martinez und der begnadeten Pilotin Caroline Sula. Wer den vorangegangenen Band "Der Fall des Imperiums" nicht gelesen hat, wird hier zwei weitestgehend positiv besetzte Heldenfiguren vorfinden - doch eingeführt wurden sie als gebrochene Charaktere, die in Teil 1 erst ihre Schattenseiten überwinden mussten, um in der Krise über sich hinauswachsen zu können: Martinez seine Karrieregeilheit und Sula den Umstand ... dass sie in Wirklichkeit die Unterschichtangehörige Gredel ist, die die wahre Sula - ein selbstsüchtiges Drogenwrack - tötete und in deren Rolle schlüpfte. In der aktuellen Situation zählt aber nur, dass die beiden als einzige im sklerotisch erstarrten Imperium in neuen Bahnen denken und pragmatisch agieren können. Was unter anderem zu einem Plan zur (Nicht-)Verteidigung der Zentralwelt Zanshaa führen wird, der an ein Sakrileg grenzt.
Die "Dread Empire's Fall"-Reihe ist, wie schon zu Band 1 gesagt, gleichermaßen Space Opera wie Gesellschaftsroman. "Der Fall des Imperiums" beschrieb zunächst ausführlich das imperiale System, ehe es zu den ersten Kampfhandlungen kam. "Sternendämmerung" ("The Sundering") schließt hier unmittelbar an, kehrt dann für eine lange Zeit auf die gesellschaftliche Ebene zurück, ehe gegen Ende hin wieder Raum- und Partisanenkämpfe aufflammen. Action-LeserInnen mögen diesen ungewöhnlich langwelligen Aufbau als "Talsohle" zwischen Handlungsgipfeln wahrnehmen, wenn es plötzlich über viele Seiten hinweg um Hochzeiten, Konzerte, Empfänge und die Schönheit von Vasen geht. Doch legt Williams nicht ohne Grund Wert auf die Beschreibung des Systems, in dem der schöne Schein alles gilt: Der ultrahöfliche Umgang der adeligen Peers untereinander ist ebenso falsch wie Sulas Identität. Ehen werden aus rein wirtschaftlichen Erwägungen eingegangen (ironischerweise wird nun Martinez selbst von seinem Bruder "verkauft", wie er es seinerseits in Teil 1 mit seinen Schwestern vorangetrieben hatte). Und wenn sich Martinez aufmunternde Worte zurechtlegt, mit denen er seine Schiffsbesatzung auf den Kampf vorbereiten kann, ist er sich dessen bewusst, wie hohl seine Phrasen sind.
Während sich im wahrsten Sinne des Wortes über ihren Köpfen das Unglück zusammenbraut, taumeln die Adeligen von Zanshaa durch eine schön beschriebene Fin-de-siècle-Stimmung. Vor diesem Hintergrund wirkt auch die verhinderte Liebesgeschichte zwischen Martinez und "Sula" stimmig - immerhin wäre es die schlimmste vorstellbare Amour fou, sollte "Sulas" wahre Identität, die sie zu ihrer persönlichen Tragödie auch vor Martinez selbst verbergen muss, jemals auffliegen. Das kann (vorerst zumindest) für ihn nur in einer Zweckehe mit einer anderen enden ... und in der Romanmitte folgt eine hart am Kitsch kratzende Passage, die direkt dem 19. Jahrhundert entsprungen sein könnte: Leicht drückte ihre Hand auf seinen Arm - nicht die Hand der Frau, die er liebte, sondern die Hand einer Fremden. Martinez drehte sich um und ging mit Terza dem Schicksal entgegen, das sie beide erwartete. Na bumsti.
"Sternendämmerung" ist doch etwas lang geraten, auch wenn der selbst mit hoher Dioptrien-Zahl sehr gut lesbare Drucksatz einen größeren Umfang vorgaukelt, als der Roman tatsächlich hat. Eine Taschenbuch-Version der Trilogie wäre daher schön, sonst hat man mit dem Abschlussband drei Riesenziegel im Regal stehen. Das Paradoxe daran ist: Trotz der Länge hätte man aus so manchem mehr herausholen können. Zum Beispiel aus der Demontage des Orbitalrings von Zanshaa - das gewaltige, eine Ära beendende Panorama wird von den Menschen auf der Planetenoberfläche mitverfolgt ... drei Absätze lang, dann ist es auch schon wieder vorbei. Aber Williams setzt seine Schwerpunkte eben lieber im persönlichen Bereich - dementsprechend stellt das Romanende auch nur für eine Person einen wirklichen Wendepunkt dar. Wie es für sie und alle anderen weitergeht, wird sich aber bereits im November zeigen, wenn der dritte Band ("Die letzte Galaxis") erscheint.
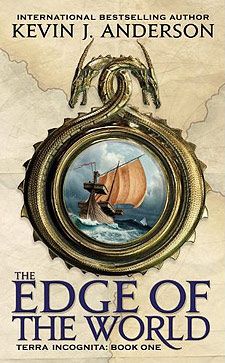
Kevin J. Anderson: "The Edge of the World"
Broschiert, 672 Seiten, Orbit 2010.
"Terra Incognita" heißt das aktuelle Epos von Kevin J. Anderson, für das der durch seine Mitwirkung an den "Dune"- und "Star Wars"-Universen sowie seine eigene "Saga der Sieben Sonnen" bekannte US-Autor in die Fantasy gewechselt ist (nicht dass der Sprung von den beiden ersteren so gewaltig gewesen wäre). Dass er von außerhalb gekommen ist, scheint sich unter anderem im Verzicht auf einige vermeintlich unvermeidliche Klischees niederzuschlagen: Magie spielt weitestgehend keine Rolle - sieht man von diskret platzierten Einzelphänomenen wie einem Kompass, der immer nach Hause zeigt, und einer "sympathetischen" Verbindung zwischen Schiffen und nach ihrem Vorbild angefertigten Holzmodellen ab. Statt Drachen gibt es hier zwar Seeschlangen - doch sind diese nicht mystischer als Pferde, Mammuts und andere Bestandteile der Fauna der "Terra Incognita". Vor allem aber ist weit und breit nichts in Sicht, was einem "Dunklen Lord" entspräche. Kein umfassender Plan einer monolithic evil force, wie Anderson es formuliert, bricht den Krieg vom Zaun, der sich hier langsam in Gang setzen wird - sondern eine Anhäufung von Zufällen, Missverständnissen und eskalationsträchtigen Taten einzelner Radikaler (hier kommt der Faktor Religion ins Spiel). Und schließlich, nachdem die Stimmen der Vernunft verstummt sind, ist der Krieg nichts anderes mehr als ein System, das sich verselbstständigt hat.
Anderson orientierte sich an der Phase der europäischen Geschichte, die am Übergang vom Spätmittelalter zur Neuzeit lag: Das "Zeitalter der Entdeckungen" einerseits (im Roman wird sich dies sowohl in Expeditionen zur See als auch solchen per Ballon widerspiegeln), zugleich aber, verknappt gesagt, das eines fundamentalen kulturellen Konflikts zwischen Orient und Okzident. Anderson verdichtet dies und transferiert es in geografische Bedingungen, die eher an die beiden Amerikas erinnern: Einen sich von Norden nach Süden erstreckenden Doppelkontinent, der durch einen Isthmus verbunden ist. Im Süden liegt das orientalisch gezeichnete Uraba, im Norden das eher abendländische Tierra. Die beiden sind Heimat zweier Religionen, die einen gemeinsamen Ursprung haben und gerade dadurch völlig unvereinbar zu sein scheinen. Das auf dem Isthmus gelegene Ishalem (man beachte den Namen ...) betrachten beide Religionen als heilige Stadt. Denn dort befinden sich auch die Überreste einer gigantischen Arche, mit der der Prophet und Stammvater der Tierraner einst hier gelandet sein soll - oder der der Urabaner; welcher von beiden es war, darüber herrschen im Norden wie Süden naturgemäß entgegengesetzte Meinungen. Als zu Beginn des Romans Ishalem durch einen saublöden Zufall bis auf die Grundmauern niederbrennt, ist das letzte verbindende Element zwischen Nord und Süd vergangen und der Bruch zwischen den Kulturen endgültig.
Wie schon in der "Saga der Sieben Sonnen" arbeitet Anderson mit umfangreichem Personal und entsprechend vielen Handlungssträngen. Rund ein Dutzend Figuren werden kapiteltragend; die Zahl steigt auch deshalb, weil sich bereits Teil 1 der Saga über mehrere Jahre erstreckt und so langsam auch die zweite Generation ins Spiel kommt. Dafür macht's der Autor den LeserInnen bei der Vorstellung seiner ProtagonistInnen einfach: Wenn wir aus einem zynischen Kommentar des urabanischen Herrschers auf seine kritische Haltung gegenüber Religion und in weiterer Folge auf seine allgemeine Weltsicht und seine Politik schließen dürfen, dann bleibt das eher die Ausnahme. In der Regel wird alles und jeder kurz explizit erklärt (Herkunft, Charakter, Verbindung mit anderen Figuren) - wie bei einem Einführungstext. Doch werden sich die ProtagonistInnen im Verlauf der Erzählung weiterentwickeln; und allesamt werden sie durch den Krieg immer härter.
Eine der zentralen Figuren ist der Fischerssohn Criston Vora: Er nimmt an einer der ersten Entdeckungsfahrten Tierras teil - diese bestätigt zwar, dass altes Seemannsgarn durchaus der Wahrheit entsprechen kann, doch ist sie nur ein erster Vorgeschmack auf die Expeditionen, die im Verlauf der weiteren Romane noch zum Haupt-Plot ausgebaut werden sollen (dass Criston auf seiner Fahrt nach Westen unbekannte Sternbilder sieht, ist allerdings entweder auf einen Fehler des Autors zurückzuführen ... oder Hinweis auf einen wilden Twist in Sachen Worldbuilding). Cristons junge Frau Adrea wird indessen von einem urabanischen Überfallskommando in den Süden verschleppt, wo sie sich langsam mit der Kultur ihrer neuen "Heimat" und ihrer zweifelhaften Stellung als Favoritin des Thronerben arrangieren muss. Der heißt Omra und wird von Anderson ambivalenter gezeichnet als sein Pendant in Tierra, Prinzessin Anjine. Die zunächst noch kindliche Anjine muss sich auf die Herrschaft vorbereiten und vollzieht einen Reifungsprozess hin zu einer potenziell positiven Figur. Omra ist vielschichtiger: Vernünftig einerseits und Adrea gegenüber sogar liebevoll - andererseits aber auch rücksichtslos, wenn es um den Krieg gegen Tierra geht. Und zuletzt ist da noch der tierranische Prester Hannes: Die kirchliche Obrigkeit hat ihn als Spion in den Süden geschickt - im Exil schlägt sein psychotisches Wesen in religiösen Fanatismus um; er wird zum massenmörderischen Monster, das seinen Teil zur Eskalation des Krieges beiträgt.
Spannend ist der Blick auf die Fundamente der Religionen, die Anderson für "Terra Incognita" entworfen hat: Schöpfergott Ondun hat die Welt vor langer Zeit verlassen, um andere zu erschaffen. Er hinterließ seine Söhne Aiden und Urec, die später zu den Begründern der beiden verfeindeten Religionen gemacht wurden, und gab ihnen den Auftrag die Welt zu erkunden. Ein dritter Sohn, Joron, verblieb in "God's Own Country" Terravitae - und es ist dieses verlorene Land, nicht ein metaphysisches Jenseits, auf das die Religionen ausgerichtet sind. Das Motiv wiederholt sich in Gottes Stiefkindern, den Saedranern: Auch das reale Vorbild für diese kleine Religionsgemeinschaft, die zwischen ihren beiden mächtigen Geschwistern lebt und nach Möglichkeit unter sich bleibt, ist nicht schwer zu erraten. Die Saedraner haben ihrer Überlieferung nach ihre Heimat verloren und träumen davon, sie einstmals wiederzusehen. Sie glauben, dass ihnen diese Gnade erst dann gewährt wird, wenn sie die Mappa Mundi, die Karte der gesamten Welt, vervollständigt haben.
Somit ist die Entdeckungs- und Abenteuerlust in allen drei Religionen tief verankert - mit Auswirkungen auf das Denken und Handeln der Hauptfiguren wie auch auf das Lesen des Romans. Denn trotz Kriegsgräueln und privater Tragödien (Anderson beschert seinen Charakteren einige wirklich schwere Schicksalsschläge) glimmt stets der Funke von Aufbruchsstimmung und Optimismus, der sich auf die LeserInnen überträgt. Wie spannend kann doch das Erkunden unbekannter Länder - eigentlich ein Plot, der dem Genre Fantasy inhärent sein müsste - werden, ganz ohne metaphysischen Finsterling. Auf Deutsch ist die "Terra Incognita"-Reihe bislang nicht erschienen. Dafür können alle, die sich vom Romaninhalt angesprochen fühlen, gleich die Fortsetzung mitbestellen: Zeitgleich zur Taschenbuch-Version von "The Edge of the World" ist heuer auch die Erstausgabe des Nachfolgers "The Map of All Things" erschienen.

David Wellington: "Welt der Untoten"
Broschiert, 398 Seiten, € 10,30, Piper 2010.
"28 Days Later" wird allgemein als Zombie-Film wahrgenommen, was er streng genommen nicht ist. David Wellingtons "Monster Trilogy" hingegen dreht sich ganz eindeutig um Zombies, auch wenn sich der Autor konsequent um das Z-Wort herumdrückt und stets von "Untoten" oder gar "Ghouls" die Rede ist. Das klingt nach Eiertanz, erfährt aber spätestens im Abschlussband der Trilogie seine Berechtigung. Denn die Bandbreite der Existenzformen zwischen Leben und Tod weitet sich hier in frappierender Weise aus - bis mit der Zeit jede Sicherheit verschwimmt, wer lebendig und wer auf die eine oder andere Art untot ist ... und ob das überhaupt noch eine Rolle spielt. Im Grunde ist das der größte denkbare Gegensatz zum herkömmlichen Zombie-Szenario. Die Handlung treibt so absonderliche Blüten - vorzugsweise hässliche, stinkende Blüten -, dass man sich bald auch nicht mehr über Sätze wie diesen wundert: Alle jubelten, außer Ayaan, der Mumie und dem Gehirn.
Es beginnt schon mit der Einleitung des Romans, der 12 Jahre nach den vorangegangenen Bänden handelt (hier die Rückblicke auf Teil 1 und 2). Denn dem gemischten Heer, das auf die letzte Nation der Lebenden an der ägyptischen Küste zumarschiert, gehören sowohl Lebende als auch Untote an - geführt wird es von den Toten, die nicht ganz so ohne Verstand waren. Aus den vorangegangenen Teilen wissen wir: Das sind Menschen, deren Gehirn während der Wandlung zum Zombie entweder zufällig oder absichtlich mit Sauerstoff überversorgt wurde, was sie zu sogenannten Leichenherren mit übernatürlichen Kräften macht. Letzteres spielt in Teil 3, 2007 als "Monster Planet" erschienen, eine noch größere Rolle als zuvor. - Ich will mich nicht zu der These versteigen (und wie jeder, der so etwas sagt, tue ich genau das), dass die klassische Zombie-Thematik meist nur für harte, dreckige, kleine Romane in Novellenlänge ausreicht - peilt man ein umfangreicheres Werk an, braucht man zusätzliche Elemente. Die "Monster Trilogy" könnte man dafür aber gut als Beleg heranziehen, und den Zusatz liefert die Welt des Übernatürlichen. Da wogt die goldene Lebensenergie im Gegensatz zur schwarz-purpurnen des Untotseins. Die Leichenherren glänzen mit einer Vielzahl unterschiedlichster Fähigkeiten wie eine verfaulende Version der Legion der Superhelden - unerreicht dabei eine "Pilzfrau", in deren Nähe alles von Myzel überzogen wird. Es wird mit Geistern kommuniziert, und ein magischer Skarabäus übersetzt die telepathischen Worte einer ptolemäischen Mumie (die nichtsdestotrotz unter schlimmeren Grammatikproblemen leidet als Yoda).
"Welt der Untoten" wandert damit nicht zu knapp in den Fantasy-Bereich hinüber - auch was die Handlungsstrukturen anbelangt. Das gemischtlebendige Heer ist im Auftrag des schon in Teil 1 kurz erwähnten "Zarewitsch" unterwegs, um magische Gegenstände und vielversprechende ... Wesen aufzusammeln. Und auch der in Teil 1 stark vertretene Mael Mag Och, der Druide von den Orkneys, spinnt wieder seine undurchsichtigen Pläne. Wenn das wechselseitige Kräftesammeln im neuen Pilzdschungel von New York zu ersten Schlagabtäuschen führt, hat das mehr von einem Magier-Wettstreit (oder eben auch einem Kampf Superhelden vs. Superschurken) als von einer Zombie-Geschichte. Die Rahmenbedingungen bleiben horrormäßig ekelerregend: Sei es der Seitenblick auf eine seit Ausbruch der Epidemie eingesperrte Untote, die ihren zermatschten Kopf seit zwölf Jahren gegen die Fensterscheibe ihres Gefängnisses schlägt. Sei es das Fließbandverfahren, mit dem im Heer des Zarewitsch Zombies die Hände abgehackt werden (Feinmotoriker sind sie ohnedies keine ...), um ihre Unterarmknochen zu Waffen zuzuspitzen. Andererseits nutzt sich der Schrecken etwas ab, wenn Hauptfigur Sarah - eine Lebende - mit einer ägyptischen Mumie auf Aufklärungsmission geht.
Stichwort Hauptfiguren: Was Milla Jovovich alias Alice in "Resident Evil" im Alleingang packen muss, verteilt Wellington in seiner Trilogie auf ein paar weibliche Schulterpaare mehr. Die ehemalige äthiopische Kindersoldatin Ayaan gibt die famose Kämpferin, die unerschrocken durch Blut und Kot watet - nichts kann sie brechen; auch nicht dass sie vom Heerzug des Zarewitsch gefangen genommen und in einem Hühnerkäfig durch die Lande gekarrt wird. Sarah wiederum, Tochter des UN-Waffeninspekteurs Dekalb aus Teil 1, ist diejenige, die die Fähigkeit zu übersinnlicher Wahrnehmung erlernt - dafür ist sie sonst nicht die Verwegenste. Und in der Untoten Nilla, die hier erneut auftauchen wird, kam schon in Teil 2 das Element der Selbstbestimmung besonders deutlich zum Tragen: Nilla wurde zwar zum (denkfähigen) Zombie und weckte damit die Begehrlichkeiten derer, die nach der postapokalyptischen Macht greifen wollen - für fremde Zwecke ließ sie sich jedoch nicht rekrutieren.
Großer Schwachpunkt des Romans ist, dass eine seit Teil 1 sorgsam aufgebaute Storyline in einer totalen Antiklimax einfach verpufft. Das dürfte denen einen oder die andere frustrieren - ist aber bezeichnend für eine Handlung, die ihre Mitte verloren hat. Statt einem befriedigenden Abschluss wartet "Welt der Untoten" eher mit einzelnen erinnerungswürdigen Episoden auf - etwa einer gleichermaßen rührenden wie schwarzhumorigen Familienzusammenführung, die ebenso skurril ist wie die Szene in "Hairspray" (das Original!), in der sich die mit ihrem Lover schmusende Tracy während des Ausrufs "This is so romantic!" eine Ratte vom Fuß schüttelt. - Alles in allem ist es ein ziemlich merkwürdiges Ding, das Wellington da vom Stapel gelassen hat. Um den Dauersatz des Romans zu zitieren: Es war eben so eine Welt.
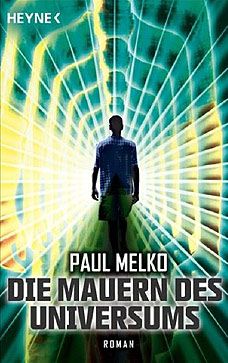
Paul Melko: "Die Mauern des Universums"
Broschiert, 450 Seiten, € 9,20, Heyne 2010.
In einem Kaff in Ohio erhält Farmerssohn John Rayburn Besuch von dem Menschen, den er am allerwenigsten erwartet hätte: sich selbst. Oder genauer gesagt seinem Ebenbild aus einer Parallelwelt. Highschool-Schüler John ist durch die Begegnung verständlicherweise wie vom Donner gerührt; es fällt ihm zunächst also gar nicht auf, dass sich der andere John - in der Folge zwecks Unterscheidung "Prime" genannt - als ebenso umtriebig wie besitzergreifend erweist. Primer holt ohne große Umschweife eine Stricherlliste mit potenziell verwertbaren Ideen hervor, auf die in dieser Welt vielleicht noch niemand gekommen ist, von Post-Its über den Rubik-Würfel bis hin zu Diamantminen in Südafrika. Eine bestechende Idee, die auch die plausibelste des ganzen Romans bleiben wird - der Themenkreis interdimensionaler Handel wird sich folgerichtig wie ein roter Faden durch die Handlung ziehen (nebenbei erfahren wir dabei übrigens auch, dass Johns Erde nur fast die unsere ist).
Prime reist mit einer schlicht das Gerät genannten mysteriösen Maschine, die er um den Hals trägt, durch die Welten - bekommen will er sie von einem weiteren John haben. Als er "unserem" John das Gerät für einen Probesprung leiht, ahnen leider nur die LeserInnen Böses; John probiert es aus und es kommt, wie es kommen muss: John stellt fest, dass er immer nur weiterreisen, aber nicht mehr zurückkehren kann - während Prime in seine Rolle schlüpft. An dieser Stelle zeichnet sich ein Persönlichkeitstausch im doppelten Sinne ab: John dämmert, dass er in Zukunft gewitzter - also womöglich auch betrügerischer - agieren muss, wenn er in unbekannten Welten bestehen will. Und der von zahlreichen gefährlichen Reisen abgebrühte Prime sinkt heulend "seiner" Familie in die Arme, endlich wieder in einer Art Zuhause angekommen. Wäre "Die Mauern des Universums" an dieser Stelle abgeschlossen worden, hätte es eine ausgezeichnete Kurzgeschichte abgegeben. Doch geht die Erzählung weiter und der Mehrwert flöten.
Paul Melko, ebenfalls aus Ohio stammend, wird im Klappentext als "einer der renommiertesten SF-Autoren der USA" bezeichnet, was reichlich aus der Luft gegriffen ist. Sein bisheriges Werk umfasst gerade einmal zwei Romane und eine Reihe kürzerer Erzählungen. Eine davon, die Novelle "The Walls of the Universe", machte Melko 2009 zum ersten Teil des gleichnamigen Romans. Diese Erzählung geht etwas über den oben beschriebenen Punkt hinaus und nimmt noch den Handlungsstrang um Casey Nicholson - ein Highschool-Mädchen, das John nie anzusprechen wagte, das Prime aber bald schwängern und heiraten wird - mit auf. Die Novelle vermied aber einige der größeren Schwächen des Romans, die alle unter dem Stichwort "Unglaubwürdigkeit" zusammenzufassen wären. Wie etwa die Verbissenheit, mit der sich Johns KommilitonInnen an der Physik-Uni einer beruhigend vertrauten Erd-Version darauf stürzen, einen Flipper zu bauen ... nur weil John das Wort mal beiläufig erwähnt hat. Aus Bau und Vermarktung des Flippers wird sich übrigens der längste Handlungsstrang des Romans entspinnen.
Die zwischendurch per Tastendruck auf den "Universumzähler" des Geräts aufgesuchten Erd-Versionen von geringerem Ähnlichkeitsgrad wirken holzschnittartig: Sei es eine postatomare Kulisse oder eine der sogenannten Pleistozän-Welten mit eher nebuloser Tierwelt (dass es Melko nicht immer allzu genau nimmt, zeigen auch andere Details: etwa wenn eine Schusswunde vom Bauch zur Schulter und wieder zurück zum Bauch wandert); von den später erwähnten gotischen Universen ganz zu schweigen. Das wahre Universum war ein weitläufiges Herrenhaus voller einzelner, voneinander abgetrennter Kammern. Und die Bewohner wussten nicht, dass sie sich immer nur in einem dieser winzigen Zimmer befanden, heißt es an einer Stelle. Ordnungssystem zwischen den Kammern - in dem Sinne, dass aneinander grenzende "Kammern" einander ähnlicher wären als weiter entfernt liegende - ist keines erkennbar. Im Gegenteil: Jede ganzzahlige Anzeige auf dem Universumzähler steht für eine Welt, die sich von ihrer unmittelbaren Nachbarin entweder nur in trivialen Details oder auch ganz gewaltig unterscheiden kann. John führt zwar mit einem Physikprofessor ein Gespräch über die Viele-Welten-Interpretation der Quantenmechanik und die Grundidee, dass jede Entscheidung auf minimaler Ebene ein neues Universum erschafft - die chaotische Struktur des Parallelwelten-"Baums" in "Die Mauern des Universums" spiegelt dies jedoch nicht wider. Und noch viel weniger tut dies der Umstand, dass der Universumzähler mit recht wenigen Stellen auskommt: Irgendein kosmischer Effekt schränkt die Zahl der Universen offenbar gehörig ein. Möglicherweise ist es die mangelnde Fantasie des Autors.
Noch ein Wort zum Gerät selbst: John vergleicht das hauptsächlich aus einer Ziffernanzeige und ein paar Knöpfen bestehende Ding anfangs scherzhaft mit einem einarmigen Banditen. Und allzu ernst darf man es wirklich nicht nehmen. Seine Wirkungsweise wird nur recht vage umrissen; sein Ursprung bleibt völlig offen und sein Innenleben ein Kabelsalat. Das alles sei dahingestellt - aber dass Physik-Erstsemester John es später mit den Mitteln einer technisch weniger weit entwickelten Welt nicht nur nachbaut, sondern sogar verbessert, das wird zur größten Unglaubwürdigkeit des Romans.
Nirgendwo wird "Die Mauern des Universums" als Jugendroman geführt, doch spräche vieles für eine solche Einordnung: Alle ProtagonistInnen sind Jugendliche, ihre Interessensschwerpunkte - von den Liebesnöten bis zur ausführlich geschilderten Flippermanie - entsprechend. Brauchen sie für ihr Vermarktungsprojekt Rechtsberatung, fragen sie einen Jus-Studenten, bei Finanzproblemen hilft eine Wirtschaftsstudentin aus ... man bleibt also fast ausschließlich in der eigenen Alterskohorte. Dass das Ganze dann nach all den Alltagsproblemen noch in eine Art heldischen Kampf mündet, wirkt ziemlich aufgesetzt, dürfte aber geplante Fortsetzungen andeuten. - Insgesamt ist "Die Mauern des Universums" ein nettes, naives Abenteuer in etwa auf dem Level der TV-Serie "Sliders" - und zwar am Übergang zu der Staffel, in der die Kromaggs auftauchen. Wer einen aktuellen Roman zum Thema Parallelwelten lesen will, wird in Iain Banks' "Welten" (kürzlich ebenfalls bei Heyne erschienen) den wesentlich besseren finden.
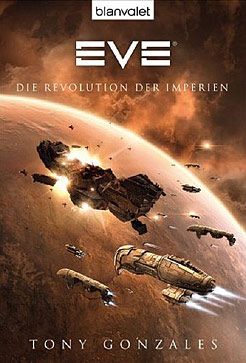
Tony Gonzales: "EVE. Die Revolution der Imperien"
Broschiert, 700 Seiten, € 10,30, Blanvalet 2010.
Ein selbsternannter Märtyrer, dem der Tod verwehrt bleibt. Eine für tot gehaltene Gottkaiserin, die geklont und beängstigend verändert zurückkehrt. Und die Crew eines Bergungsschiffs, das einen weiteren Klon aufliest, hinter dem die halbe Galaxis herjagt. - Überraschung, Überraschung: Das war ein Buch, von dem ich mir im Vorfeld rein gar nichts erwartet hatte, das sich dann aber doch zum Pageturner gemausert hat; letztlich dann einem mit Einschränkungen. Gründe für die vorauseilende Skepsis gab's zwei: Zum einen ist es keine von Grund auf eigenständige literarische Schöpfung, sondern ein Roman, der zum Multiplayer-Rollenspiel "EVE Online" gewissermaßen nachgereicht wurde. Solche Ergänzungen auf einem Zusatz-Markt müssen aber auch für alle diejenigen funktionieren, die das Originalprodukt nicht kennen - und oft genug tun sie's nicht. Der zweite Grund ist, dass der für den Roman verpflichtete US-Amerikaner Tony Gonzales zwar schon für die isländischen Entwickler von "EVE Online" als Autor gearbeitet - aber noch nie einen Roman geschrieben hat. Und dann gleich 700 Seiten!
Die Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. Hier werden zwar keine neuen stilistischen Kontinente aus dem Magma gezogen - aber das Schlimmste, was man an Gonzales' Schreibe bemäkeln kann, ist, dass sich einige Passagen zu Romanbeginn wie das Tutorial eines Spiels lesen: Historie, Kosmographie, gesellschaftlicher Aufbau, ein Hauptsatz nach dem anderen, zackzack, und wir sind im Bilde. Diese Skizzenhaftigkeit verliert sich in weiterer Folge und mündet in eine straighte Erzählweise, die vor allem auf Spannung setzt. Die Übersetzerin weist ehrenwerterweise darauf hin, dass klobige Ausdrücke wie Chimera Supercarrier oder Heavy Assault Cruiser absichtlich englisch belassen blieben, weil dies auch in der deutschsprachigen Version des Spiels so ist - den öfters vorkommenden trillions hätte eine Übersetzung in Billionen allerdings ganz gut getan, und Algorhythmen gibt's auch eher in der Disco als in der Mathematik. Letzte Anmerkung: Der Roman ist im Original 2008 unter dem Titel "EVE - The Empyrean Age" erschienen; der deutsche Untertitel "Die Revolution der Imperien" glänzt mit dadaistischer Sinnlosigkeit.
Den Handlungshintergrund bildet eine "New Eden" benannte Raumregion. Hierhin haben sich vor einigen zehntausend Jahren die letzten Menschen durch das Wurmloch EVE geflüchtet; sie durchlebten einen zivilisatorischen Niedergang, aus dem sich in jüngerer Vergangenheit schließlich fünf Sternenimperien herausschälten. Eines davon, Jove, bleibt ebenso wie im Spiel ein mysteriöser weißer Fleck auf der Weltraumkarte - die übrigen vier repräsentieren stark voneinander abweichende Gesellschaftssysteme; jeweils zwei davon sind auf unselige historische Weise miteinander verbunden. Caldari gliedert sich in die Einflusssphären von Megakonzernen, von denen jeder über hunderte Millionen Menschen gebietet, und führte einst Krieg gegen die demokratische Föderation Gallente. Von diesem Krieg haben sich die beiden Reiche unterschiedlich gut erholt und leben nun in einem Nachbarschaftsverhältnis, das von alten Ressentiments geprägt ist. Das Reich Amarr wiederum ist eine Theokratie - auch wenn der aktuelle Thronwächter Religion für "die lukrativste Farce der Geschichte" hält und eifrig darauf bedacht ist, ThronerbInnen auszuschalten, um seine De-Facto-Herrschaft zu prolongieren. Amarr versklavte einst die benachbarten Minmatar: Auch wenn diese eine eigenständige Republik haben, lebt immer noch ein Drittel des Volks als SklavInnen im Raum der Amarr. Und die Republik selbst wird vom Großteil der freien Minmatar ohnehin abgelehnt, weil sie nicht mit ihrem traditionellen Stammessystem kompatibel ist. - New Eden präsentiert sich also als kompliziertes Mosaik aus Untergruppierungen und Konflikten - konstruiert, aber gut konstruiert.
Die Handlungspersonen geraten gegenüber dem taktischen Spiel der diversen Machtblöcke etwas ins Hintertreffen - Gonzales führt so viele ein, dass man fast sagen könnte, er verzichtet auf Hauptfiguren (Stichwort: Multiplayer ...). Für die LeserInnen bleibt die Orientierung dadurch gewahrt, dass sich das gesamte Personal rasch um drei zentrale Handlungsstränge gruppiert. Die Figuren wiederum wahren nur dadurch den Überblick, dass im "EVE"-Universum alle Bemühungen zeitgenössischer SF-AutorInnen, den Weltraum als etwas GROSSES darzustellen, in den Wind geschlagen werden. Hier bewegt man sich nicht auf jahre- oder gar jahrhundertelangen Bahnen durchs All oder muss über Generationen hinweg auf das Eintreffen lichtschneller Botschaften warten. Statt dessen sorgt gute alte Überlicht-Technik für ein Gefühl der Simultanität. Die Figuren des einen Handlungsstrangs können die Taten derer aus einem anderen in den Nachrichten mitverfolgen - die Nationen von New Eden scheinen weniger in kosmischen Dimensionen als in planetaren angesiedelt zu sein.
Gonzales geht zwar nicht in die Tiefe, aber die Breite hat auch etwas zu bieten: "EVE" entwickelt sich zu einem Panorama des kriegerischen Niedergangs, neben dem Walter Jon Williams' zuvor beschriebener Roman fast wie ein Kammerspiel vor sparsamer Kulisse wirkt. Angesichts der unaufhaltsamen Eskalation gerät es ungewollt zum Super-Gag, wenn eine Nebenfigur den naiven Gedanken hegt: Sie hoffte, dass an diesem Tag nichts Außergewöhnliches geschehen würde. - Vom Handlungsablauf her erinnert der Roman an jene "Babylon 5"-Staffel, in der erst mal alles komplett den Bach runtergeht, bis ... ja, bis was eigentlich? Leider müssen wir uns mit einer Momentaufnahme begnügen. Wie es jemand im Netz formulierte: That book doesn't so much end, but stop. Und das als nächster Roman im Februar erscheinende "Das brennende Leben" ist leider kein wirkliches Sequel, sondern wird den Fokus auf andere Regionen des "EVE"-Universums richten. Ob so auf Dauer Lesepublikum abseits der Online-SpielerInnen gebunden werden kann, sei dahingestellt.

Jeff Somers: "Die digitale Seuche"
Broschiert, 461 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2010.
Alles zerfällt, wie in gottverdammter Zeitlupe, immer weiter. Zwölf Jahre sind seit der Handlung des ersten Romans um "Copkiller" Avery Cates (hier der Rückblick) vergangen, und die darin beschriebene No-Future-Welt ist seitdem nicht besser geworden. Im Gegenteil: Im Verlauf von "Die digitale Seuche" ("The Digital Plague", 2008) trüben sich die ohnehin schon düsteren Aussichten für den Fortbestand der Menschheit in einer zwangsvereinigten Welt immer weiter ein. Auch der Protagonist - mittlerweile immerhin reich, biblische 36 Jahre alt und nach Band 1 mit der Löschung seiner Polizeiakten belohnt - sieht keinen Anlass für Optimismus: Zugegeben, bei Dick Marin, oberster Chef der weltweit agierenden Polizei und durch Averys Beihilfe an die heimliche Alleinherrschaft gekommen, hat er einen Stein im Brett. Doch auf den Straßen des verwahrlosten New York laufen immer noch genug Leute herum, die sich an ihn auch ohne Blick in die Akten erinnern können und ihm nach dem Leben trachten.
Der Roman beginnt mit einer für Avery leider typischen Situation: Die Augen verbunden und von Bewaffneten umringt wartet er auf den Tod - wird zu seiner Verblüffung aber nicht erschossen, sondern erhält eine Injektion verpasst. Diese macht ihn zum Indexpatienten (besser bekannt als "Patient Zero") einer Nano-Seuche ... und bald beginnt um Avery herum das große Sterben. Wie schon bei Jeff Carlsons "Nano"-Trilogie bieten die tödlichen Maschinchen so ganz nebenbei die Gelegenheit, ein bisschen angesagte Zombie-Motivik einfließen zu lassen. Die Rückkehr der Toten zieht sich wie ein roter Faden durch den Roman, wird sich aber in unterschiedlichsten Varianten ereignen - Überraschungseffekte inklusive, denn nicht bei allen losen Enden aus dem Vorgängerroman "Der elektronische Mönch" hätte man gedacht, dass sie überhaupt lose wären. Und immerhin: die meisten Infizierten bleiben nach ihrem Ableben eh liegen, die Zombie-Anleihen halten sich also zum Glück in Grenzen.
Weil die Nanos überdies eine Signatur ausstrahlen, die auf einen ehemaligen Weggefährten Averys hinweist, wird Avery auf eine Reise zu dessen letztem bekannten Aufenthaltsort gezwungen. Seine Begleitung: Colonel Janet Hense - klein, dünn und tödlich wie ein Stilett - und der hünenhafte Captain Nathan Happling, so gefährlich und wahnsinnig wie ein über Jahrzehnte gegängelter Tanzbär. Ob Jeff Somers Cyberpunk schreibt, sei dahingestellt - Punk ist es allemal. Nichts beschreibt den hinter der Erzählung steckenden Nihilismus besser als dieses in wechselseitigem Hass verbundene "Team": Das einzige, was sie eng zusammenschweißt, ist die Tatsache, dass in einem Radius von drei Metern um Avery herum die Nanos inaktiv bleiben und der unvermeidliche Tod vorerst hinausgeschoben wird (eine besonders perfide Idee dessen, der Avery infiziert hat - so kann dieser die Seuche umso länger verbreiten). Keinem der drei fällt aber jemals ein Passanten zu warnen, dass sie auf Abstand bleiben sollen. "Warum sollte ich mich selbst belügen? Natürlich ging es hier um mein nacktes Überleben. Der Rest der Welt war nur ein Bonus." Das ist die zentrale Aussage der Story - geäußert zwar von Avery, doch scheint sie für alle ProtagonistInnen zu gelten.
Im Gegensatz zum Vorgängerroman hat Avery diesmal kaum Handlungsspielraum: Die Ereignisse schleudern ihn wie eine Flipperkugel von einer Situation in die nächste - erst im letzten Viertel wird er mal selbstständig agieren können. Er wirkt zwar tougher als sein jüngeres Selbst und kann dem harten Image, auf das er immer noch bedacht ist, jederzeit mit der Waffe in der Hand gerecht werden. Zugleich plagen ihn aber immer wieder Schuldattacken angesichts all der Menschen, die er auf dem Gewissen hat ... und das schon bevor er mit der Seuche einen erklecklichen Teil zumindest der US-amerikanischen Bevölkerung ausrottet (sieht aus, als hätte Somers da im Strudel der Ereignisse ein wenig die Relation in Sachen Body Count verloren). Wie schon in "Der elektronische Mönch" fügt sich in der Charakterisierung des Protagonisten nicht alles zu einem runden Ganzen zusammen - und erst recht gilt das für die Sprache. Schnieke-Nummer, aus welcher Mottenkiste kam das denn? Zugegeben, Deutsch ist keine so dynamische und variantenreiche Sprache wie das Englische, aber besser gemacht hat die Übersetzung den Roman sicher nicht.
Aber auch Somers selbst gibt stilistisch nicht alles, zumindest nicht im Haupttext. Das Indiz: Wie schon das vorige Buch enthält auch dieses wieder als spezielles Gimmick einen Appendix. Bei "Der elektronische Mönch" war es eine Wiedergabe des "Mulquer Codex" der Cyberkirche, ein wirres Erweckungselaborat samt textkritischem Apparat - ebenso lächerlich wie gruselig. In "Die digitale Seuche" besteht der Anhang aus dem abgedruckten Audio-Tagebuch einer Infizierten: Über 16 Seiten hinweg entfaltet sich hier das Drama eines Verfalls: Dolce Vita, Geld, Gesundheit, Infrastruktur und schließlich das Selbstverständnis der Betroffenen ... alles löst sich einfach auf. Somers zeigt damit, dass er durchaus ein Händchen für unterschiedliche Tonfälle und stilistische Experimente im Kurzformat hat. Schade, dass sowas nicht stärker in den vergleichsweise eindimensionalen Haupttext eingeflossen ist, wo wir nur die Ich-Perspektive eines Erzählers und dessen durchgängig "hartgesottenen" Ganovenslang serviert bekommen. Den dritten Gang des giftigen Menüs gibt's im Februar, wenn "Das Ewige Gefängnis" erscheint.
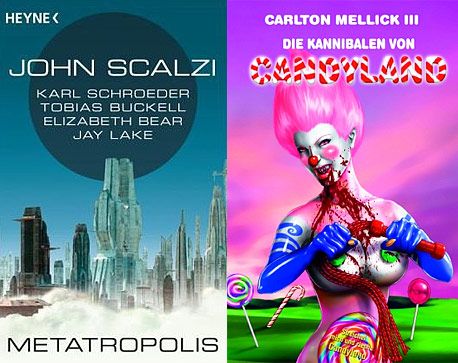
John Scalzi et al: "Metatropolis", 450 Seiten, € 9,30, Heyne 2010, und Carlton Mellick III: "Die Kannibalen von Candyland", 160 Seiten, € 17,30, Festa 2010.
Frisch übersetzt liegen nun auch zwei Titel vor, die hier bereits anhand ihrer Originalversionen besprochen wurden. Zum einen wäre da "Metatropolis", das offenbar von der Erfolgswelle der "Krieg der Klone"-Reihe John Scalzis in die Regale gespült wurde. Ein absolut erfreulicher Umstand, auch wenn sich Scalzis Military-SF-Fans verdutzt die Augen reiben werden, denn dieser Titel hat damit absolut gar nichts zu tun. Statt dessen ist "Metatropolis" eine Anthologie, für die Scalzi als Herausgeber und Co-Autor fungierte; Thema: die Stadt der Zukunft. Von der HighTech-Kommune im Wald bis zu einer rein virtuellen Gemeinschaft reichen die faszinierenden Ideen dieser Anthologie über die nahe und nächste Zukunft (die ausführliche Besprechung finden Sie hier). Eine Empfehlung!
Erfreuliches gibt es auch von der Bizarro-Front zu berichten: So langsam kommen nämlich auch die deutschsprachigen Verlage auf den Geschmack und beginnen das derzeit vielleicht geilste Subgenre der Phantastik zu übersetzen. Im Dezember bringt der österreichische Verlag Voodoo Press "Rotten Little Animals" von Kevin Shamel heraus (mehr dazu, sobald es erschienen ist). Währenddessen hat der deutsche Festa-Verlag seinen neuen Schwerpunkt zu Bizarro-Großmeister Carlton Mellick III bereits mit dem ersten Titel gestartet: "Die Kannibalen von Candyland" - kein anderes Buch, das je auf meinem Redaktionstisch gelegen hat, hat Vorübergehende derart magnetisch angezogen wie dieses (zur seinerzeitigen Besprechung geht es hier). Die Festa-Ausgabe prunkt mit rosa Papier und einem Duftcover: Rubbelt man der Titelfigur über den Bauch (in dem gerade ein paar ... Kinderportionen verdaut werden), verströmt sie die Erdbeernote, die sie in der Erzählung so unvergleichlich verführerisch macht. Manche Themen schreien eben einfach nach liebevoller Aufmachung.
Und im November geht's dann unter anderem ins Innere des größten Ballons aller Zeiten und ab ans Lagerfeuer, wo uns ein wandernder Androide erzählt, warum es mit der Menschheit bergab ging. (Josefson)