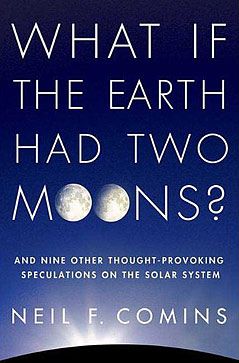
Neil F. Comins: "What If The Earth Had Two Moons?"
Gebundene Ausgabe, 304 Seiten, St Martins Press 2010.
Bäng! So sieht also die neue Hintergrundfarbe der SF-Rubrik aus. Zu Ehren des neuen Mutterressorts Wissenschaft beginnen wir mit einem Sachbuch ... nur dass es die Sache ist, in der die Fiktion liegt. Es handelt sich dabei um eine Sonderform spekulativer Literatur, die zwar von Anfang an als Bestandteil dieser Seite geplant war - bloß kommt nicht mordsmäßig viel raus in dem Bereich. Ein Paradebeispiel wäre Dougal Dixon: Der schottische Geologe und Paläontologe ist vor mittlerweile 30 Jahren auf die Idee gekommen, verallgemeinerbare Mechanismen der Evolution auch auf hypothetische Welten zu übertragen. Das Ergebnis waren einige wunderschön im Stil von "Brehms Tierleben" illustrierte Werke: Das 50 Millionen Jahre in der Zukunft angesiedelte "After Man" (Prämisse: der Mensch ist ausgestorben), "The New Dinosaurs" (Prämisse: der Chicxulub-Asteroid ist an der Erde vorbeigerauscht und die Dinos bevölkern in weiterentwickelter Formenvielfalt die Gegenwart) und schließlich "Man after Man". In letzterem, mit dem Subtitel "An Anthropology of the Future" versehen, wird die ökologisch verwüstete Erde mit dem letzten vorhandenen Gen-Material wiederbesiedelt: dem des Menschen. Als die Projektbetreiber mitsamt den letzten Resten der Zivilisation verschwinden, bleiben die künstlich geschaffenen Halbmenschen-Spezies sich selbst bzw. der Evolution überlassen und besiedeln als neue Fauna nach und nach sämtliche ökologischen Nischen. Dieses Buch lappt stärker als die anderen in die Belletristik, da Dixon es anhand der individuellen Schicksale von Vertretern der halb- bis gar nicht mehr intelligenten Spezies aufzieht. Das grenzt unmittelbar an den Aufbau, den beispielsweise Stephen Baxter seinem Roman "Ursprung" aus dem "Multiversum"-Zyklus gegeben hat: Ein Kreis innerhalb der Phantastik schließt sich.
Neil F. Comins hat eine ähnliche Geschichte: Der Astrophysiker aus Maine hat sich nicht nur mit populären Irrtümern zum Thema Raumfahrt befasst, in den 90ern hat er auch mit "What If The Moon Didn't Exist?" einen kleinen Bestseller veröffentlicht. Fast 20 Jahre später gibt es dazu nun eine "Fortsetzung" - Thema der zehn neuen thought-provoking speculations on the solar system ist einmal mehr die Frage, wie es auf der Erde aussähe, wenn ihre astronomischen Rahmenbedingungen andere wären. Ganz wie bei Alternativweltgeschichten im engeren Sinne betont Comins im Vorwort die Bedeutung der "Was wäre, wenn ..."-Frage. Für alle, die in Genre-Begriffen denken, handelt es sich also gewissermaßen um Worldbuilding ohne Handlung. Fast zumindest, denn der astronomischen Analyse der zehn jeweils mit einem Fantasienamen versehenen Alternativ-Erden stellt Comins stets eine kleine belletristische Vignette voran. Durchaus mit Humor: In der Titelepisode etwa hat sich die Erd-Version Dimaan einen zweiten Mond eingefangen - ein System, das zwangsläufig zur Instabilität neigt. Galileo Galilei freut's - immerhin sind unter den Meteoriten, die das lunare Spannungsverhältnis am laufenden Band produziert, auch welche dabei, die die Häscher der Inquisition erschlagen.
Insgesamt gehört Dimaan aber zu den weniger interessanten Episoden; für den an das Vorläuferbuch erinnernden Titel wurde sie wohl eher zwecks Corporate Identity gewählt. Spannender ist da schon Dichron, eine Erde, deren Kruste etwas dicker ist als die der unseren. Tektonik und Vulkanismus im uns bekannten Stil kann es hier nicht geben - da sich die Hitze des Planeteninneren dennoch irgendwie Bahn brechen muss, schmilzt jede Region der Planetenoberfläche in Abständen von einigen Millionen Jahren einmal komplett ab. In der zugehörigen Vignette ist dies zum romanreifen Katastrophenszenario einer Arktis-Expedition verdichtet. Leben könnte sich laut Comins auch hier problemlos zu den verschiedensten Formen entwickeln - they would all, however, have one thing in common: somehow they would all know when the land under their feet was about to melt. Goldig. Zum Ausgleich für rein faktenbezogene Passagen zeigt sich Comins immer wieder von der launigen Seite, spricht etwa von the olden days der Astronomie und meint damit die Zeit vor 1996. Interessanterweise verbleibt er aber ausschließlich im Standardmodell der Kosmologie, geht weder auf Strings noch Branen ein - allerdings sind die im Buch behandelten Themen auch locker innerhalb der klassischen Gravitationsphysik abzuhandeln. Zwischen anspruchsvolleren Passagen fällt Comins auch immer wieder mal auf kindgerechte Einschübe - Never look at the Sun without approved eye protection. Doing so causes blindness. - zurück. Ganz so, als riefe er sich selbst in Erinnerung, dass er zu einem Allgemein-Publikum spricht. Einem US-amerikanischen übrigens: Sämtliche Einheiten werden in Fahrenheit, miles, yards und dergleichen angegeben.
Ein weiteres zentrales Kapitel heißt Mynoa/Tyran, aufbauend auf jüngsten astronomischen Erkenntnissen über extrasolare Planeten, nämlich dass Gasriesen keineswegs so weit von ihrem Mutterstern entfernt sein müssen wie in unserem System. Hier kreist die Erd-Version Mynoa als Mond um den Neptun-großen Tyran. Ganz wie der Erdmond ist Mynoa dabei längst in eine gebundene Rotation eingetreten, wendet Tyran also stets dieselbe Seite zu. Die sich daraus ergebenden Unterschiede zwischen den beiden Hemisphären sind spektakulär: Auf der Tyran abgewandten Seite ähnelt der Tag-Nacht-Rhythmus dem uns vertrauten, ist lediglich etwas länger. Auf der "Vorderseite" hingegen schiebt sich täglich Tyran zwischen Mynoa und die Sonne - das Ergebnis sind Tage, deren hellste Phase stets von einer mächtigen Eklipse unterbrochen wird, und Nächte, die wegen des "Mega-Vollmonds" am Himmel nahezu taghell leuchten. In der zugehörigen Vignette erlebt Kolumbus auf seiner Fahrt nach Westen als erster Europäer einen vollständigen Tyran-Untergang und die Pracht des Sternenhimmels. Bald darauf plagt ihn aber ein heftiger "Jetlag" wegen des ungewohnten Tag-Nacht-Rhythmus auf der Rückseite. Comins spekuliert, dass sich unter diesen astronomischen Bedingungen zwei völlig voneinander getrennte Ökosysteme mit jeweils unterschiedlicher circadianer Rhythmik auf Mynoa entwickeln müssten. Generell lehnt er sich aber mit seinen Spekulationen zu Auswirkungen auf Biologie oder gar Psychologie der BewohnerInnen alternativer Erden nicht zu weit aus dem Fenster, sondern bleibt in seinem Metier. Er könnte aber mit Dixon ein dynamisches Duo bilden und AutorInnen fundiertes Rohmaterial beim Entwerfen von Welten liefern.
While exploring these alternative versions of Earth I came to really appreciate how making one change leads to myriad others, schreibt Comins den zentralen Satz des Buchs. Denn beim Ersinnen fiktiver Welten kann man zwar durchaus die Fantasie spielen lassen, muss sich aber dessen bewusst sein, dass man es stets mit einer Paketlösung zu tun hat. Wenn sich beispielsweise wie im Fall Futura eine Doppelgängerin der Erde 15 Milliarden Jahre in der Zukunft bilden würde, dann wäre das stellare Baumaterial nicht mehr dasselbe. Eine höhere Rate schwerer Elemente aber würde zu einer Welt mit stärkerer Tektonik, einem stärkeren Magnetfeld und einer anderen Zusammensetzung des Meerwassers führen - und so weiter und so weiter. Und manche Modelle gehen eben gar nicht: In nüchterner Weise zerpflückt Comins die alte SF-Idee von einer "Gegenerde" auf der anderen Seite der Sonne. Ist nicht möglich, weil nicht stabil. An den Lagrange-Punkten "vor" bzw. "hinter" der Erde ließe sich im selben Orbit ein Planet platzieren - doch wäre der am Himmel sichtbar, und niemals könnten AstronautInnen verblüfft auf eine verborgene Welt oder gar ihre "Spiegelbilder" treffen.
Im Nachwort wehrt sich Comins dann noch ausdrücklich gegen anthropische Missdeutungen seiner Bücher, sprich: Auslegungen, dass unsere kosmischen Rahmenbedingungen so passgenau darauf zugeschnitten scheinen, unsere Existenz zu ermöglichen, dass sie nicht zufällig diese Form angenommen haben können. - Eben nicht, sagt Comins: Wir haben uns zufällig unter diesen Bedingungen entwickelt - und es wäre eine ganze Reihe anderer Kombinationen denkbar, unter denen zumindest etwas Ähnliches wie wir entstehen könnte. Was in einen Satz mündet, der sich religiös geprägten Menschen nur schwerlich in seiner vollen Schönheit erschließen dürfte: Life exists because it can.
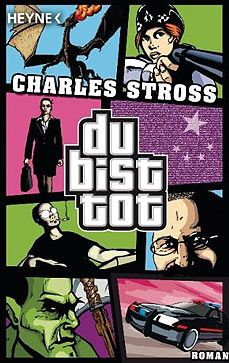
Charles Stross: "Du bist tot"
Broschiert, 544 Seiten, € 10,30, Heyne 2010.
Zwei Romane - "Accelerando" und "Singularity Sky", beide überdies mit Fortsetzungen - haben den Wahlschotten Charles Stross in der Wahrnehmung vieler LeserInnen zu so etwas wie Sankt Singularität gemacht. Was ein wenig den Umstand überdeckt, dass sein literarisches Schaffen von Anfang an eher breit angelegt war - Alternativweltgeschichten finden sich darin ebenso wie Grenzgänge zu Horror und Fantasy. Und vor allem pflegt Stross einen skurrilen Sinn für Humor. Das wird sich in "Du bist tot" (im Original 2007 als "Halting State" und ohne die durchaus passende "Grand Theft Auto"-Optik erschienen) alles wiederfinden. Es handelt sich dabei um einen abgeschlossenen Roman abseits der bisherigen Mini-Serien, soll aber im nächsten Jahr ebenfalls ein Sequel bekommen.
Dass hier fröhlich Grenzen übersprungen werden, macht schon das Ausgangsszenario klar: Die Edinburgher Polizistin Sue Smith wird zum Sitz des Unternehmens Hayek Associates gerufen, wo sich ein Banküberfall ereignet haben soll. Kein gewöhnlicher allerdings - die Bank war eine virtuelle, ihr Standort das Online-Game AVALON VIER (eine Art aufgemotztes "Dungeons & Dragons"), wo sich Hayek um die Datenverwaltung kümmert. Geraubt wurden sämtliche darin deponierten magischen Gegenstände - und die Bankräuber waren eine Horde Orks mit Unterstützung eines Drachen. Da steht Sue erst mal wie der Ochs vorm Tor. "Ich verstehe die Sprache dieser Leute einfach nicht. Das sind Aliens vom Planeten IT", stöhnt sie, während man ihr mühsam erklärt, worin der Unterschied zwischen der Wirtschaft der Spielwelt und unserer realen (bzw. einen Tick realeren) Welt besteht: im Spaßfaktor. Der bedingt zwar, dass laufend Schätze gehoben und Reichtümer erobert werden müssen - bloß führt das auch im virtuellen Raum zu Inflation. Also werden die SpielerInnen dazu angehalten, aktuell nicht Gebrauchtes in einer Zentralbank zu deponieren; natürlich gegen eine kleine, aber höchst reale Gebühr. So nach und nach versteht Sue, dass auch ein virtueller Überfall durchaus echten wirtschaftlichen Schaden anrichten kann. Die Ökonomien überlappen einander ohnehin schon lange - wer sein neues Schwert nicht auf heroische Weise zu erobern vermag, kann jederzeit auf eBay & Co fündig werden.
Zwei weitere Charaktere müssen an den Schauplatz: Die Wirtschaftsprüferin Elaine Barnaby, die immerhin Erfahrung mit Liveaction-Rollenspielen hat, und Jack Reed, seines Zeichens ein ehemaliger Spiele-Entwickler, der nach einer Entlassung aus undurchsichtigen Gründen erst einmal ordentlich versackt ist und nun zu seiner Überraschung als Experte hinzugezogen wird. Stross wählt die seltene Variante, seinen Roman abwechselnd aus der Sicht der drei Hauptfiguren, aber stets in der zweiten Person zu erzählen. Die innere Distanz, die sich daraus unwillkürlich ergibt, passt recht gut zum Charakter der drei, die alle zur Selbstironie neigen - Jack hat sogar ein mütterliches Über-Ich internalisiert, das bei kleinen Regelverstößen rügend aktiv wird. Darüberhinaus hat diese Erzählweise aber auch den Effekt, dass die Figuren wie Avatare ihrer selbst zu agieren scheinen - was besonders deutlich wird, wenn sie zwischen Spiel- und Realwelt zu switchen beginnen, deren Grenzen im Verlauf des Romans ohnehin zunehmend erodieren. Ein kleines Manko bleibt allerdings, dass die drei ErzählerInnen einander sehr ähneln; vor allem die Sue- und Elaine-Kapitel sind vom Ton her praktisch nicht zu unterscheiden.
Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass alle drei deutlich anklingen lassen, wie sehr die Freizeit in ihrem Leben gegenüber der Arbeit an Boden verloren hat. "Du bist tot", mag es auch in einem von Großbritannien unabhängig gewordenen Schottland des Jahres 2018 angesiedelt sein und teilweise in virtuellen Räumen ablaufen, ist deshalb auch kein Cyberpunk. Eher schon ein Wirtschaftsthriller mit satirischem Blick auf die - nur geringfügig weitergesponnene - Welt der Gegenwart (Parallelen zu William Gibson gibt es deshalb schon - aber zu seinen jüngeren Werken wie etwa "Quellcode"). Stross führt so einiges an, das uns nur allzu vertraut vorkommen muss: Web-basierte Unternehmen, die tollen Service bieten, solange alles gut läuft, die aber ihre Telefonnummern und Firmenadressen geschickt hinter dem zwanzigsten Link verbergen. Outsourcing von Dienstleistungen (im Roman nicht nach Indien, sondern gleich nach Nigeria, von wo aus uns seit Jahren die beliebten Scam-419-Mails ("Guten Tag, Sie kennen mich nicht, aber Sie können mir helfen, ein Konto mit XXX Dollar nach Europa zu transferieren ...") beglücken. Oder Public Private Partnerships, mit denen sich besonders in Großbritannien staatliche Einrichtungen aus der infrastrukturellen Verantwortung stehlen wollen. Alles in allem also das Kafka 2.0, in dem wir längst leben.
Vor diesem Hintergrund geraten Sue, Elaine und Jack in Ereignisse, die immer absurder und zugleich immer bedrohlicher werden. Ein hochrangiger Mitarbeiter von Hayek verschwindet spurlos; wie es scheint, hat er seit langem eine von allen Netzen abgekoppelte Phantom-Existenz geführt. Die Europol rauscht ein und spricht von einem anstehenden "Infowar", bei dem gar die ganze EU auf dem Spiel stünde. Jack erhält Morddrohungen gegen seine Nichten und Elaine stellt fest, dass ihr Liveaction-Agentenspiel SPOOKS stärker in ihr Leben eingreift, als sie jemals vermutet hätte. "Die Spiele sind in die Realität eingebrochen", konstatiert Jack - ein Szenario, das spätestens seit dem Film "WarGames" von 1983 bekannt ist, doch läuft es bei Stross in einigen Schichten mehr ab. Denn hier ist keineswegs gesagt, dass Gefahr für Leib und Leben nur in der feststofflichen Welt liegen kann. Und das vielleicht größte Risiko besteht darin, dass es den ProtagonistInnen auch dann noch schwer fällt, die Situation ernst zu nehmen, als sie schon mehrfach in Lebensgefahr geraten sind. - Natürlich trägt auch der Autor dazu bei, dass alles recht locker daherkommt: Launiger Humor und blumige Vergleiche prägen den Ton. Überdies macht sich Stross ausgiebig über Architektur, Wetter, den gesprochenen Akzent und die Fahrgewohnheiten in seiner Wahlheimat lustig.
Gamer, die mit Begriffen wie NPCs oder Griefer vertraut sind, mögen in "Du bist tot" kurzfristig im Vorteil sein - für alle anderen gibt es ein ausführliches Glossar am Romanende. Neben einigen wenigen nur in der Romanwelt existierenden Phänomenen wie dem CopSpace - einer Augmented Reality, die die Polizei für interne Kommunikation nützt - listet Stross darin vor allem IT-Begriffe und Wissenswertes zu Schottland auf. Und lässt beruhigenderweise auch ein bisschen sein Alter durchschimmern, nachdem er sich mit seinen 45 Jahren zuvor gar so sehr auf der Höhe der Zeit gab. Am Musikgeschmack erkennt man die Generation dann doch - von XTC über New Model Army bis zu Laurie Anderson reichen hier die 80er-Jahre-lastigen Verweise. - Daher: Schwellenangst ist nicht angebracht. "Du bist tot" ist mit all seinen überraschenden Wendungen sehr unterhaltsam. Und nach anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten werden auch hoffnungslose Noobs daran schnell ihr Vergnügen finden.

Sergej Snegow: "Menschen wie Götter"
Broschiert, 991 Seiten, € 10,30, Heyne 2010.
Zu Recht wiederveröffentlicht - und zu Recht nicht in der verlagseigenen Reihe "Meisterwerke der Science Fiction" - wurde nun Sergej Snegows bombastische russische Space Opera "Menschen wie Götter". Ursprünglich als Trilogie in den Jahren 1966 bis 1977 erschienen, ergibt sie in der Gesamtausgabe einen fast 1.000 Seiten langen Wälzer, der alles enthält, was man sich nur wünschen kann. Und auch das eine oder andere ... andere. Neue Naturgesetze, metallene Planeten, Raumgefechte, die mit Gravitationswellen ausgetragen werden, planetares Schlachtengetümmel mit gentechnisch gezüchteten Drachen und Pegasussen, Aliens, die wie der "Muppet Show" entfleucht wirken, und Göttern gleichende uralte Wesen, die den Aufbau der Milchstraße umgestalten - hier findet sich alles.
Stürzen wir uns in ein vergnügtes und nur manchmal von all den Erfindungen und Entdeckungen leicht übersättigtes Utopia des 26. Jahrhunderts, gut 500 Jahre nach dem weltweiten Triumph des Kommunismus. Die Erde ähnelt der (schriftstellerisch um einiges ergiebigeren) Welt des Mittags von Snegows berühmten Landsmännern, den Gebrüdern Strugatzki - ohne allerdings deren melancholische Züge zu teilen. Hier weht allenthalben der Wind des Optimismus, veranschaulicht an einer Clique ehemaliger SchuldfreundInnen, die zu den durchgängigen ProtagonistInnen des Mammutwerks werden: Gleich zu Beginn schwebt Lussin auf einem von ihm gezüchteten Drachen über dem Kilimandscharo ein, André führt ein multinsensorisches Konzert zu Ehren des Universums auf - und Ich-Erzähler Eli, der von Berufs wegen künstliche Sonnen über dem Pluto montiert, freut sich darauf, mit seiner Flugmaschine durch die Blitze eines künstlich in die Hauptstadt geschleppten Feiertagsgewitters zu sausen. Menschen wie Götter, in der Tat. Und sie leben in einem bestens organisierten Paradies: Das Erdachsenkontrollzentrum sorgt für genehmes Wetter, die Computer der Staatsmaschinenadministration lenken die Infrastruktur. Snegow entwarf sogar - immerhin schon Mitte der 60er - so etwas wie vernetzte Kommunikation; auch wenn die nur mit der Zentralen Personendatenmaschine und den von ihr projizierten "Beschützerinnen" möglich ist, nicht direkt zwischen einzelnen Menschen. - Alles in allem ist es ein sorgloses Zeitalter ohne Unfälle oder Konflikte. Dazu passt der sympathische Umgang der Romanfiguren miteinander - man herzt und küsst sich in nahezu kindlicher Unbeschwertheit am laufenden Band.
Der Abgrund beginnt dann aufzuklaffen, wenn's zur Begegnung mit Außerirdischen kommt. Etwa auf der Scheibenwelt Ora, die man extra deshalb weitab der Erde künstlich angelegt hat, weil sie ein Ort der Begegnung für alle Spezies sein soll. Allerdings leuchtet die Kunstsonne über ihr in einem 24-Stunden-Rhythmus inklusive Mondphase ("damit die Menschen nicht auf Gewohnheiten verzichten müssen, die ihnen seit Anbeginn ihre Existenz selbstverständlich sind"), und die Atmosphäre entspricht natürlich der irdischen - die anderen Völker wurden in hermetisch abgeschlossene "Herbergen" gestopft. So ist sie, die Ora! schwärmt Eli. Wenn die Alien-Delegationen dann der Reihe nach in ihren künstlichen Biotopen von Eli & Co besucht werden, erinnert das im Ablauf nicht zu knapp an einen Ausflug in den Zoo - und beflissen versichern die Aufgesuchten: "Uns geht es hier ausgezeichnet. Wir werden unserem Volk berichten, wie gut und mächtig die Menschen sind." - Das ist der Anfang, aber bei weitem nicht das Ende einer gedankenlosen Gönnerhaftigkeit, die den Ton des Romans prägen wird und streckenweise a-t-e-m-b-e-r-a-u-b-e-n-d-e Ausmaße annimmt. Dass die osteuropäische Science Fiction insgesamt weniger geil auf Sternenkriege war als die westliche, ist im Prinzip ein begrüßenswerter Gegenentwurf. Wenn der Harmoniegedanke aber Formen wie hier annimmt, muss man umgekehrt auch feststellen, dass ein Konfliktszenario - wenngleich allzuoft simplifiziert dargestellt - dem Anderen wenigstens eigene Zielsetzungen einräumt. Bei Snegow, der den Aliens und ihren Planeten nicht mal eigene Namen gibt, sind die Außerirdischen nichts anderes als Claqueure, die die Entwicklungshilfe vom Großen Bruder Erde beklatschen. Offenbar ist ihnen seit ihrer evolutionären Entwicklung nichts Besseres eingefallen, als doof auf ihren Planeten herumzuhocken, bis die Menschen eingeflogen sind und ihnen das Leben leichter gemacht haben (Schutzräume gegen starke - natürliche! - Strahlung zu bauen, wie hätten sie da auch selbst drauf kommen können ...). Mit der Spezies der Zerstörer, die Snegow für den Spannungsbogen in Teil 1 und 2 als Gegner der Menschheit aufbaut, legt sich doch noch jemand quer - aber keine Angst, die werden früher oder später schon noch auf Linie gebracht werden.
Elis Freund, der Hardliner Pawel Romero, argumentiert unverblümt, dass "hässliche" und "ästhetische" Formen vernunftbegabten Lebens nicht gleichberechtigt sind - der Widerspruch des "toleranten" Eli fällt verhalten aus ... und ist nicht unwesentlich davon beeinflusst, dass er sich gerade in das Schlangenmädchen Viola von der Wega verguckt hat (menschlicher Oberkörper auf reptilischem Unterkörper - sie werden nicht lange genug zusammen sein, dass er sich wünschte, es wäre umgekehrt). Apropos Schlangen: Ähnlich wie Ivan Efremov ("Das Herz der Schlange") lässt Snegow seine Charaktere amüsiert-angeekelt auf Zeiten und Welten herabblicken, in denen man noch handgreiflich wurde/wird - auf der Erde gilt Gewalt schließlich schon lange nicht mehr als Argument. Unmittelbar nachdem das gesagt wurde, schütteln die Erdlinge einen unhöflich auftretenden außerirdischen Botschafter mal eben kräftig durch - worauf der sich umgehend unterwirft und sich ihnen für den Rest des Buchs als treuer Gefährte anschließt. Und als er sich verächtlich über eine Drittspezies äußert, fährt man ihm über den Mund: "Und wir erlauben auch nicht, sie als niedere Rasse zu betrachten." - Einige Zeit zuvor wurde nüchtern konstatiert: "Unsere Sternennachbarn sind primitiver als wir, das ist eine Tatsache."
Diese permanenten Widersprüche kommen manchmal in so unmittelbarer Folge aufeinander, dass sich mit der Zeit die Frage aufdrängt, ob man es mit einer Satire zu tun hat. Als ob Snegow, der unter Stalin wegen angeblicher politischer Verfehlungen zehn Jahre im Arbeitslager verbracht hatte, austesten wollte, wie weit man gehen kann, wenn man das System karikiert. Dafür sprechen harmlose kleine Spitzen gegen die vermeintliche Unfehlbarkeit der Staatsmaschinen oder der Wetterkontrolle, mehr noch aber Szenen, die einfach nicht ernst gemeint sein können: Etwa wenn Eli sich fern der Heimat nach den Delikatessen der Erde sehnt ("der butterzarte rosa Schinken aus kondensierten Brenngasen oder saftige Sahnetorten aus den Erdölraffininerien"), nachdem sich die selbstverständlich längst vegetarisch lebenden ErdenbürgerInnen zuvor unter dem Rinderdenkmal mit der Aufschrift "Dem Ernährer des Menschen in ewiger Dankbarkeit!" versammelt hatten. Der Roman quillt nämlich geradezu über vor Pathos, etwa wenn die Menschheit von der großen interplanetaren Solidaritätseuphorie ergriffen wird und sich komplett in den Dienst der neuen Sache stellt: "Wir bauen Planeten für jede Lebensform!" - Nach dieser gerafften Darstellung würde wohl jeder sagen: Na logo ist das 'ne Satire auf Polit-Propaganda. Dagegen spricht aber auch einiges. Die menschliche Besserwisserei wird sich nämlich in Teil 2 und 3, runtergebrochen auf die individuelle Ebene, 1:1 in den flammenden Ansprachen Elis fortsetzen, mit denen er noch den verbissensten Kontrahenten schneller überzeugt als durch eine Gehirnwäsche.
Die Handlung selbst ist wie gesagt prall und spielt sich streng genommen nicht immer innerhalb der Grenzen der Science Fiction ab. Da liefern einander unsichtbare Knochenmänner und fliegende Pferde Schlachtengetümmel, wie sie Philip José Framer nicht bunter hätte schildern können. Die riesigen Sternenpflüge der Menschheit reisen, indem sie - coole Idee! - Raum in Materie umwandeln und auf ihrem Weg durch die Galaxis gleichsam Kondensstreifen hinterlassen, aus denen man ganze Welten bauen kann. Noch fantastischer die von Eli bzw. Snegow entdeckten Raumwellen (nicht gleichbedeutend mit dem entsprechenden Begriff aus dem Elektromagnetismus), die die Lichtgrenze weit hinter sich lassen: Im Goldenen Zeitalter der Science Fiction ließen sich Naturgesetze eben nicht nur ignorieren, sondern auch ganz neue erfinden - auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs ersann beispielsweise Jack Williamson den "Rhodomagnetismus" als verbesserte Variante des Elektromagnetismus. Im dritten Teil von Snegows Roman wird dann noch ähnlich wie zuvor mit dem Raum fröhlich Schindluder mit der Zeit betrieben.
Wer gerne auf Amazon nachschaut, wie ein Buch bei den LeserInnen ankommt, wird hier auf ein überwältigend positives Feedback stoßen. Allerdings heißt's auch genau lesen. Viele, die für "Menschen wie Götter" schwärmen, führen ihre Jugenderinnerungen als Grund an - denn das seinerzeit in der DDR veröffentlichte Buch befand sich mangels Konkurrenz durch andere Space Operas in der privilegierten Lage, ein offenbar überall populäres Thema nahezu alleine abzudecken. - Für LeserInnen aus einer jüngeren Generation, die jetzt in eine Buchhandlung gehen und einfach nur nach einer neuen Space Opera suchen, ist dies eher nicht der optimale Griff. Doch bleibt "Menschen wie Götter" aus einer Vielzahl anderer - unter anderem historischer - Gründe ein lohnenswertes Leseerlebnis. Und sogar eines, das Vergnügen machen kann, wenn man den ProtagonistInnen nur mit ein wenig Distanz ins Gewühl folgt: "Wir durften die Schreie der Unterdrückten und Verfolgten nicht einfach ignorieren! Unsere revolutionären Vorfahren hätten niemals so egoistisch gehandelt. Warum sollten wir schlechter sein als sie?"
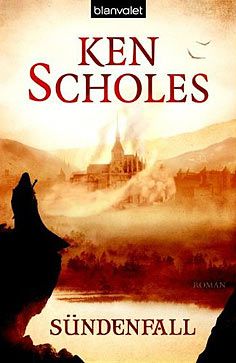
Ken Scholes: "Sündenfall"
Broschiert, 540 Seiten, € 15,50, Blanvalet 2010.
Bei Fantasy tue ich mir wesentlich seltener als bei anderen Genres den Aufwand an, ein Buch zwecks Auffettung der Rubrik aus dem Ausland zu bestellen (Eulen nach Athen tragen usw ...). Ken Scholes' "Lamentation" wurde allerdings - vorneweg: völlig zu Recht - derart mit Lob überschüttet, dass es einfach sein musste. Dummerweise ist's dann ein Jahr lang liegen geblieben und zack! ist auch schon die deutsche Übersetzung da. - Allzu viele AutorInnen werden von ihren Verlagen zu früh ins verkaufsträchtige Langformat getrieben und scheitern. Ken Scholes hingegen hat den Sprung von Kurzgeschichten und Novellen zum großen Epos mit Bravour vollzogen. Vielleicht hat's geholfen, dass der Autor aus Oregon schreiberisch insgesamt eher ein Spätzünder war. Vielleicht ist er auch einfach nur gut.
Im Kurzformat hat Scholes bewiesen, dass er selbst in einem Science-Fiction-Kontext märchenhaften Glanz verbreiten kann. Der durchzieht auch "Sündenfall", das auf der drei Jahre älteren Erzählung "Of Metal Men and Scarlet Thread and Dancing with the Sunrise" basiert und Auftakt des Fantasy-Zyklus "Psalms of Isaak" ist, von Anfang an: Windwir ist eine Stadt aus Papier und Talaren und Stein, lautet der wunderschöne erste Satz. Unmittelbar darauf wird die Gelehrten-Stadt, Sitz des Androfranziner-Ordens und Bastion der Vernunft, von etwas vernichtet, das in seinen Ausmaßen einem Atomschlag gleichkommt. Große Wehklage über den unermesslichen Verlust erhebt sich in den Benannten Landen (weshalb der Originaltitel auch wesentlich besser gewählt ist als der deutsche), und schon bald schlägt diese in Wut um. Heere sammeln sich rings um die Stätte der Verwüstung, und mit diesen treffen nach und nach auch die Hauptfiguren des Romans ein. Wie Petronus, vermeintlich ein einfacher Fischer - in Wahrheit jedoch ein früherer Papst des Ordens, der amtsmüde geworden war und seinen Tod vortäuschte, um in die Anonymität abzutauchen. Jetzt plagen ihn Schuldgefühle - fast so sehr wie den jungen Novizen Neb, der Windwir kurz vor dessen Zerstörung verließ. Sein Vater wollte mit ihm auf Reisen gehen; doch weil Neb etwas in der Stadt vergessen hatte, kehrte er um und starb im Feuerregen.
Einer, den keinerlei schlechtes Gewissen plagt, ist Sethbert, Aufseher eines Stadtstaaten-Bundes im Süden - im Gegenteil: Er brüstet sich damit die Zerstörung veranlasst zu haben und will sich an seinem "Erfolg" weiden. Zunächst als irrer Fresssack, der über zigtausende Leichen geht, gezeichnet, wird er später noch für die eine oder andere Überraschung sorgen. Zu Sethberts Gefolge gehört indessen auch seine Gespielin Jin Li Tam - und die ist keineswegs das Betthäschen, für das er sie hält. Als 42. von 53 Töchtern eines mächtigen Handelsherrn von der Smaragdküste (der auch über einige Dutzend Söhne verfügt und alle seine Kinder als AgentInnen einsetzt) erfüllt sie lediglich - kampf- und sexerfahren wie sie ist bzw. gemacht wurde - die aktuelle ihr zugewiesene Mission. Und trifft in Rudolfo, Herr der Neun Häuser der Neun Wälder oder einfach nur kurz der Zigeunerkönig, auf ihr männliches Pendant. Petronus beschreibt ihn treffend als wild und flink und skrupellos. "Sündenfall" zeichnet sich dadurch aus, dass es sich bei allen Hauptfiguren - mit Ausnahme des noch zu unerfahrenen Neb - um durch und durch politisch denkende Charaktere handelt. Rudolfo erweist sich dabei als besonders facettenreich: Er macht ungerührt mit den Spähern eines gegnerischen Heeres kurzen Prozess, zeigt aber auch staatsmännische Voraussicht, indem er Bündnisse schmiedet und einen Neuaufbau der Bibliothek von Windwir plant.
In den Trümmern der alten stoßen sie schließlich auf die letzte zentrale Figur der Saga, und spätestens hier beginnen sich die "Psalms of Isaak" von herkömmlicher High Fantasy zu verabschieden. Isaak ist einer von 14 Mechoservitoren, künstlichen Menschen, die die archäologisch aktiven Androfranziner nach Plänen aus einem vergangenen Zeitalter nachgebaut haben. Isaak trägt von allen die schwerste Last - denn er befürchtet die Zerstörung ausgelöst zu haben, indem seine Register zur Rezitation eines verheerenden Bannspruchs manipuliert wurden. Er mag eine dampfbetriebene Maschine sein, doch geht seine Fähigkeit Gefühle zu empfinden weit darüber hinaus. Der abgebrühte Rudolfo wird sich an einer Stelle wünschen, er hätte irgendwann einmal in seinem Leben dieselbe Unschuld besessen wie Isaak ... und wird erst sehr viel später merken, dass sein Lebensweg dem von Isaak gar nicht so unähnlich war.
Isaak und seine "Brüder", mechanische Vögel und Schiffe aus Metall ... es tauchen allerlei in einem Fantasy-Roman nicht erwartete Versatzstücke auf. Bezeichnend auch die recht nüchterne Philosophie der Androfranziner, die auf altes Wissen zurückzugehen scheint: Träume betrachtet man nicht als Botschaften oder Visionen, sondern schlicht als Verarbeitung von Signalen des Tages. Und der androfranzinische Fünffache Pfad der Trauer erinnert doch irgendwie verdächtig an Elisabeth Kübler-Ross ... Spätestens wenn Petronus den blaugrünen Mond betrachtet und sich daran erinnert, dass dieser in einem lange zurückliegenden Zeitalter, ehe er von den Jüngeren Göttern betreten wurde, ein lebloser grauer Stein war, zeichnet sich ab, dass die Benannten Lande in der Zukunft unserer oder einer sehr ähnlichen Welt liegen könnten. Fantasy-Autoren wie James Kahn oder "Shannara"-Schöpfer Terry Brooks haben dergleichen bereits entworfen, ohne allerdings Scholes in schreiberischer Qualität oder Ausgestaltung das Wasser reichen zu können. Ein besserer Vergleich wäre wohl Sean McMullens "Greatwinter"-Trilogie: In dessen postapokalyptischem Australien gibt es zwar keine Magie, doch finden wir hier wie dort Informationsgesellschaften vor. Gestützt von religiös organisierter Wissensspeicherung, am Laufen gehalten durch zeitverlustarme Langstrecken-Kommunikation (hier Botenvögel, dort Signalfeuertürme).
Wie zum Beweis, dass es keine primitiven Kulturen gibt, sondern nur solche, die unterschiedliche Mittel einsetzen, zeigen alle ProtagonistInnen eine beeindruckende Ausbildung in körperlichen und geistigen Techniken - bestes Beispiel dafür sind die ausgeklügelten Zeichen- und Pochsprachen und die Knotenschrift, in der Botschaften in Botschaften codiert werden, um Pläne in Plänen zu verstecken. Ein "Dune"-Zitat, und das kommt nicht von ungefähr: Denn alle Romanfiguren zappeln unwissentlich in einem Netz, das jemand ganz im Stil der Bene Gesserit - stets für das Licht arbeitend, doch ohne Kompromisse einzugehen - schon vor Generationen zu weben begonnen hat. Das alles gehörte in eine Geschichte, denkt Neb - und es ist eine richtig, richtig gute geworden. "Sündenfall" ist faszinierende Fantasy für Erwachsene; Teil 2 ("Lobgesang") erscheint nächsten März.
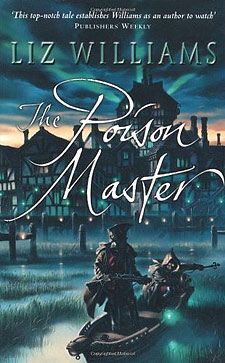
Liz Williams: "The Poison Master"
Broschiert, 480 Seiten, Tor Books 2004.
Danksagungen in Büchern sind immer auch eine Art versteckter Deklaration. Im vorliegenden Fall gehen sie an Jane Austen, William Burroughs und Jack Vance - die drei werden wohl eher selten in einem Atemzug genannt. Und sie lassen sich tatsächlich allesamt in "The Poison Master" wiederfinden, denn die Britin Liz Williams ist eine Autorin, die von starren Subgenre-Grenzen eher wenig hält (vielleicht ist auch deshalb noch nichts von ihr auf Deutsch erschienen). Am bekanntesten und erfolgreichsten sind ihre "Detective Inspector Chen"-Romane um den gleichnamigen Ermittler auf einer Erde, die sowohl zum Himmel als auch zur Hölle Kontakte pflegt. Aber Williams hat auch Einzelromane wie diesen geschrieben, der zwei getrennte Handlungsstränge im Reißverschlusssystem ablaufen lässt.
Der kürzere, im 16. Jahrhundert angesiedelte, dreht sich um den jungen Gelehrten John Dee aus Cambridge. Zu Beginn hat er gerade Copernicus' frisch veröffentlichte Thesen "De Revolutionibus Orbium Coelestium" auf dem Tisch liegen, sein eigentliches Interesse gilt aber seinem Lieblingsprojekt, nämlich eine Flugmaschine zu bauen. Mit einer metallischen Biene ist ihm das schon geglückt - durch Zahlentheorie & Zaubersprüche, Physik & Kabbala, aber no black art ... -, aber John träumt von mehr. Während er in der Folge eine Alchemisten-Karriere mit sämtlichen Erfolgen und Rückschlägen durchlebt und wir auf einer kurzen Rundreise durch die Frühe Neuzeit die Welt von Gerhard Mercator, Johannes Trithemius und anderen herausragenden Köpfen dieser Epoche kennenlernen, arbeitet John an der praktischen Umsetzung seiner Vision, zu den Sternen zu fliegen und den Kosmos zu kartographieren. Ein übernatürliches Wesen, das für einen Engel einen recht düsteren Eindruck macht, bestärkt ihn in seinen Plänen.
Im Anschluss an jedes John-Kapitel folgt ein deutlich längeres, in dessen Mittelpunkt die junge Alivet steht; Nachname ebenfalls Dee. Profession: alchemical apothecary. Adress: some slum somewhere. Dieses somewhere liegt in der ausgedehnten Stadt Levanah auf einem sumpfigen Planeten mit dem ominösen Namen Latent Emanation. Eine Welt in ewigem Dämmerlicht, die von den Lords of Night beherrscht wird - insektenhaften Riesen, die aus purer Dunkelheit zu bestehen scheinen. Nicht dass man sie grausam nennen müsste, eher schon bleiben die zurückgezogen "lebenden" Herrscher in ihrer Fremdartigkeit den menschlichen BewohnerInnen von Latent Emanation unverständlich und gelten als launenhaft. Gelegentlich holen sie sich Menschen als Leibeigene in ihre dunklen Türme - wie auch Alivets Zwillingsschwester Inkirietta. Alivet setzt ihr gesamtes fachliches Können ein, um das Geld zusammenzukratzen, mit dem sie Inki auslösen kann. Eine dieser Geldbeschaffungsaktionen geht jedoch schief, und Alivet findet sich plötzlich schuldlos unter Mordverdacht und auf der Flucht wieder. Hilfe erhält sie vom undurchsichtigen Arieth Ghairen, der Alivet mit zwei unerwarteten Fakten konfrontiert: Erstens stammt er von einem anderem Planeten. Und zweitens verlangt er im Gegenzug für seine Fluchthilfe Unterstützung bei einem geplanten Anschlag auf die Lords.
Wie gesagt: Liz Williams ist nicht an Genre-Grenzen interessiert. Das zentrale Handlungsmotiv Alchemie ist zugleich eine schöne Metapher für das gelungene Genre-Gebräu, das mit "Poison Master" serviert wird: Science Fiction, Steampunk, Gothic und sogar etwas Romantasy. Letztere kommt nicht nur im SM-Light-Szenario des Clubs zum Tragen, in dem Alivet dekadenten Adeligen in Korsett und dornenbewehrtem Schmuck neue sinnliche Genüsse beschert. Vor allem äußert sie sich in dem von Misstrauen und doch Anziehung geprägten Verhältnis zwischen Alivet und Arieth - doch keine Angst: Alivets sachliche Einstellung, die sich in botanischen Metaphern für ihr Verhalten wie auch für die brisante Zweierchemie zwischen den beiden ProtagonistInnen ausdrückt, beugt etwaigem Kitsch vor. - Anlehnungen an klassische Schauerliteratur finden sich, wenn Alivet im Wohnturm von Arieths Familie einquartiert wird, wo verschlossene Türen, wispernde Stimmen und nächtlich auf den Gängen herumhuschende Clan-Mitglieder das Exildasein würzen. Steampunk schließlich beschreibt - trotz diverser Weltraumflüge - den technischen Stand besser als Science Fiction: Es wimmelt nur so vor zahnradbetriebenen Kehlkopf-Implantaten, Flug-Skarabäen und anderen prächtig ohne Elektrizität funktionierenden Gerätschaften aus Holz, Messing und Bronze.
In den 90ern wurde eine derartige Mischung, die stark surreale Züge trägt, als New Weird definiert. Tatsächlich teilt Williams mit dessen herausragenden VertreterInnen, ihren Landsleuten China Miéville und Steph Swainston, einige Gemeinsamkeiten. Irreale Elemente tauchen auf - etwa eine Memory Hall, die aus parasitären Bäumen besteht, welche von den Erinnerungen derer zehren, die sie zu lange betrachten. Auf Latent Emanation leben anubisköpfige Einheimische, die sich in einem Zustand "vor dem Sündenfall" befinden und im Sumpf errichtete Pfähle verehren, auf denen räuberische Larven lauern. Begriffe wie Unpriests oder Moderated Wives werden den LeserInnen vor die Füße geworfen - Namen, die vage Andeutungen bleiben und es der Fantasie der LeserInnen überlassen, wie es um ihren Ursprung und ihre Bedeutung steht. Und wenn sich Alivet eine Droge injiziert, mit der sie nicht nur andere Welten bereist, sondern mit der sie auch Zwiegespräche führt, dann erinnert das stark an das, was "Komet" Jant Shira in Steph Swainstons "The Year of Our War" tut.
Ein Jahr vor "The Poison Master" verwendete Liz Williams die Plot-Idee versuchsweise in der Kurzgeschichte "Banquet of the Lords of Night". Schauplatz war da noch die Stadt Paris auf einer Erde, die von den Lords durch eine Schale verhüllt wurde - ein tapferer Pastetenbäcker machte sich hier daran, in die zu Sorbets geronnene Dunkelheit, an der sich die Lords delektieren, tödliche Lichtsplitter einzuschmuggeln. Williams gefiel die Erzählung offenbar so gut, dass sie sie über weite Strecken wortgleich - nur mit geänderten Namen - für "The Poison Master" übernahm. Die Verdichtung der Kurzgeschichte erreicht der Roman jedoch nicht. Größtes Manko bleibt, dass die Verknüpfung zwischen den beiden Handlungsfäden nicht gelingt - nicht nur dass der Zusammenhang schon früh klar wird und keine Überraschungen mehr bieten kann, die Storyline um John Dee versickert gegen Ende hin einfach. - Dem gegenüber steht das, was den Roman letztlich doch eindeutig lesenswert macht, nämlich seine dunkle, traumartige Atmosphäre.
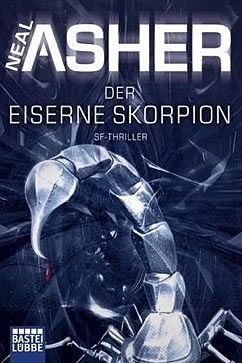
Neal Asher: "Der eiserne Skorpion"
Broschiert, 366 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2010.
Ja, auch Ian Cormac, Protagonist von Neal Ashers populären "Polis"-Romanen, war mal ein Kind. Kein sehr typisches, wie dieses 2008 als "Shadow of the Scorpion" veröffentlichte Prequel zu den bisherigen Romanen zeigt. Zu Beginn erleben wir, wie der achtjährige Ian seine Mutter bei paläontologischen Ausgrabungen in der Hell-Creek-Formation im Nordwesten der (ehemaligen) USA begleitet. Die altersgemäße Dino-Begeisterung hat ihn jedoch nicht gepackt - stattdessen zeigt er sich indigniert darüber, dass etwas so Nebensächliches weiterläuft, während der Krieg gegen die außerirdischen Prador tobt. Immerhin steht sein Vater an der Front. - Am Hell Creek sieht Ian auch zum ersten Mal den eisernen Skorpion, eine Kriegsdrohne mit künstlicher Intelligenz. Wie der Schwarze Mann wird sie in der Folge immer wieder in seinem Blickfeld auftauchen, sei es im Urlaub oder vor der Schule.
Schule ist zugleich die passende Metapher für das Gesellschaftssystem, das Asher für die zahlreiche Sternensysteme umfassende Polis entworfen hat. Regiert wird sie von Künstlichen Intelligenzen, die sowohl innerhalb ihrer Netzwerke residieren als auch mit Golem-Körpern unter den Menschen wandeln. "Der eiserne Skorpion" gibt Einblicke in die subtile Steuerung des Alltagslebens durch die KIs: Bei Raufereien auf Ians Schulhof schreiten sie ein, durchaus mit dem Laser - nicht jedoch bei kleinen Unfällen, Schmerzen sind schließlich Teil des Lernprozesses. Das gilt erst recht für Soldaten - nicht nur dass Medizin-Drohnen absichtlich die Form gruseliger Arthropoden gegeben wurde, um den Lazarett-Aufenthalt nicht allzu heimelig zu gestalten. Während einer Operation schildert eine KI dem Patienten auch penibelst, was gerade mit seinem zertrümmerten Bein geschieht; Soldaten sollten sich eben stets bewusst machen, was ihnen alles widerfahren kann. Zum Schlüsselerlebnis wird für Ian auch, als ihn die KI seines Tauchanzugs daran hindert, seinem in Not geratenen Bruder zu helfen, und kurzerhand mit dem bewegungslos gemachten Anzugträger davonschwimmt - natürlich nur zu seinem Besten. Begebenheiten wie diese sind es, die den Grundstein für Ians aus vorangegangenen Romanen bekanntes Misstrauen gegenüber den KIs legen. Dass er als kluger Kopf das ebenso wohlwollende wie unerbittliche System der Bevormundung früh durchschaut, macht ihn aber ironischerweise auch für ebendiese KIs zum geeigneten Kandidaten für eine fördernswerte Karriere.
Parallel zu den Kindheitspassagen schildert der Roman, wie Cormac in späteren Jahren - aber noch vor seiner Zeit als Spitzenagent der Earth Central Security - an Ausgrabungen anderer Art teilnimmt: Als einfacher Rekrut verdient er sich seine ersten Sporen bei Aufräumarbeiten und der Erkundung eines havarierten Prador-Schiffs. Auch hier fließen Informationen über den Hintergrund der Polis ein - eine große Rolle spielt offenbar stets die Ressourcenfrage: Lohnt es sich das feindliche Wrack vorsorglich mit Gas zu fluten? Soll man eine KI in der Operation einsetzen oder doch nur Menschen schicken? Man gewinnt dabei nicht unbedingt den Eindruck, dass der Homo sapiens im Kalkül der KIs die kostbarste Ressource darstellt. - Abgesehen von solchen Einblicken geht es in diesen Kapiteln aber im wesentlichen um Action um der Action willen. Es sieht ein bisschen danach aus, als ob Neal Asher davor zurückgeschreckt wäre, einen reinen Coming-of-Age-Roman zu schreiben, und statt dessen auf Nummer sicher gehen wollte. Spannender als die für den Gesamtkontext mäßig bedeutsame (Kampf-)Handlung ist der Umstand, dass Cormac auch jetzt wieder den eisernen Skorpion sichtet - und daraus folgend die Frage, was die seltsame Kriegsdrohne über Jahre und Lichtjahre hinweg mit ihm verbindet. Nicht nur die LeserInnen erfahren in dem Roman also etwas über Cormacs Vergangenheit, sondern auch er selbst.
Was zuvor schon zwischen den Zeilen angeklungen ist: Neal Asher ist ein Autor, der sein Publikum nicht gerne langweilt. Die Action ist gewohnt brutal; dazwischen lockern humorige Details aus dem Polis-Alltag das Ganze auf - etwa wenn Loyalty Luggage ihrem Besitzer hinterhertrippelt wie Rincewinds Truhe auf der Scheibenwelt. Oder wenn das Unterwasser-Hotel, in dem Ians Familie urlaubt, Watts heißt - eine Verbeugung vor Peter Watts, dem Autor der "Rifters"-Trilogie, die ebenfalls in den Tiefen der Ozeane angesiedelt ist. Die Verweise sind subtiler geworden und organischer eingebaut. Das gilt auch für die Wissenschaftsbezüge - sei es auf "Die Kunst des Krieges" des chinesischen Feldherrn Sūnzǐ (Sun Tzu), das im angloamerikanischen Raum wesentlich populärer zu sein scheint als im deutschsprachigen. Oder sei es auf die Gefahr von Bio-Invasionen durch interplanetaren Verkehr, ein Thema, das die meisten AutorInnen von Space Operas komplett ignorieren. Das kam nicht immer so flüssig rüber - im einige Jahre älteren "Cowl" ("Die Zeitbestie") beispielsweise konnte man an den Fingern einer Hand abzählen, welche Folge der BBC-Paläontologie-Doku "Walking with Beasts" Asher vor dem Schreiben gesehen haben musste.
"Der eiserne Skorpion" ist zwar der handlungschronologisch früheste Band aus Ashers "Polis"-Reihe. Trotzdem würde ich den Roman weniger als Einstieg in den Zyklus denn als willkommene Ergänzung für diejenigen sehen, die bereits Cormac-Fans sind und hier einige Antworten auf die Frage geliefert bekommen, wie Ian Cormac zu der zwiespältigen Persönlichkeit werden konnte, als die er sich in späterer Zeit präsentiert.

Dirk van den Boom: "Kaiserkrieger: Die Ankunft"
Broschiert, 220 Seiten, € 13,30, Atlantis 2010.
Kaum hat Dirk van den Boom seine "Tentakelkrieg"-Trilogie zu einem gelungenen Abschluss gebracht (hier der Rückblick), da startet der deutsche Politikwissenschafter mit Faible für militärisch geprägte Science Fiction schon die nächste Reihe - diesmal mit Zeitreise-Thematik. 1914 startet der Kleine Kreuzer "Saarbrücken" von Wilhelmshaven mit 300 Mann Besatzung und einer ganzen Infanterie-Kompanie an Bord zu seiner letzten Mission, ehe er eingemottet werden soll. Hinter sich lässt die "Saarbrücken" ein Deutschland, das dem unmittelbar bevorstehenden Krieg großteils eifrig entgegenfiebert, zugleich aber von zunehmenden Spannungen zwischen Adel und Militär auf der einen und der erstarkenden Arbeiterbewegung auf der anderen Seite geprägt ist. Das Ziel ist die Kolonie in Kamerun, doch die "Saarbrücken" wird es nie erreichen. Vor Portugal gerät das Schiff in einen seltsamen Nebel, und als die Besatzung aus einer vorübergehenden Bewusstlosigkeit erwacht, findet sie sich doppelt versetzt wieder: Räumlich ins östliche Mittelmeer und zeitlich - wie der Kontakt mit den ersten Einheimischen bald zeigt - ins Römische Reich während der Herrschaft Kaiser Gratians, kurz vor Beginn der Völkerwanderung.
Dem Clash of Cultures wird van den Boom später noch komische Seiten abgewinnen - etwa wenn deutsche Flottenoffiziere das gesellige Beisammensein beim gemeinsamen Ausscheiden auf gemischtgeschlechtlichen römischen Toiletten kennenlernen. Die erste Konfrontation mit einem zeitgenössischen Kriegsschiff - einer Trireme - ist aber nur zu Beginn humorig: "Herr Kapitän, wir müssen feuern!" - "Feuern? Es ist ein Ruderboot!" Van den Boom treibt die Konfrontation in der vielleicht gelungensten Passage des Romans auf die Spitze, indem er die beiden Schiffe gleichsam zu Spiegelbildern macht: Vom Kapitän bzw. Trierarchen an bis zu den wichtigsten Mannschaftsmitgliedern ähneln die beiden einander verblüffend - sogar ihr historischer Hintergrund ist nahezu derselbe, denn beide entstammen einer Epoche, in der sich massive Umwälzungen im europäischen Machtgefüge ereignen werden. Nur in Sachen Technik endet die Vergleichbarkeit: Nach einem gloriosen Rammversuch gegen die metallene "Saarbrücken" zerbricht die Trireme wie ein Zweig und versinkt mit Gefühl und Wellenschlag in der Adria. Zum einzigen Opfer auf deutscher Seite wird durch einen verirrten Pfeil der wohlmeinende Kapitän - der Erste Offizier Jan Rheinberg, den der Roman schon zuvor zur eigentlichen Hauptfigur aufgebaut hat, übernimmt nun auch offiziell die Führungsrolle.
Die Idee von (vergleichsweise) hochtechnologischen Kriegsschiffen, die in eine vergangene Epoche zurückversetzt werden, ist in der Science Fiction nicht neu - siehe etwa John Birminghams "Axis of Time"-Trilogie oder auch den Film "Der letzte Countdown". Die weitere Handlungsentwicklung rückt "Kaiserkrieger" aber noch in eine ganz andere Verwandtschaft: Denn Rheinberg erkennt schnell, dass die kurzfristig überlegene "Saarbrücken" auf lange Sicht keine Chance hat, wenn ihr erst einmal Kohle, Stahl und Ersatzteile ausgehen. Es gilt also, sich mit Rom zu arrangieren - sich in den Dienst des Kaisers zu stellen, seine Ziele zu akzeptieren ... aber auch zu versuchen sie behutsam in die gewünschte Richtung zu lenken. Das ähnelt im Aufbau stark der "Nimue Alban"-Reihe David Webers, denn auch dort macht sich ein Abkömmling einer avancierteren Zivilisation daran, unter den im unfreiwilligen Exil vorgefundenen Machtgebilden das mit der besten Infrastruktur zu wählen und sich zunutze zu machen. Mit der Kirche - in "Kaiserkriege" ist sie gerade dabei, ihre eigenen Schismen zu überwinden, den römischen Vielgötterglauben zu verdrängen und zur Machtinstanz aufzusteigen - wird sogar in beiden Werken derselbe Gegner aufgebaut. - Drücken wir van den Boom die Daumen, dass seine Reihe nicht ebenso in Langatmigkeit versinkt, wie es die von Weber getan hat!
Vorerst sind wir noch weit davon entfernt, weil mitten im Aufbau begriffen: Nach dem ersten Konflikt wechselt der Roman die Gangart und van den Boom entfaltet ein Panorama des römischen Niedergangs, das von Britannien über das Polit-Karussell der Hauptstadt bis zum Goteneinfall im Osten reicht. Es werden soviele Nebenfiguren eingeführt, dass es der Big-Budget-Soap "Rome" von HBO zur Ehre gereichen würde. Mit Gratian, Senator Symmachus oder Kirchenvater Ambrosius treten reale historische Figuren auf - interessant dabei die Tendenz des Autors, deren Rolle umzudeuten. Immerhin wird Geschichte stets von den Siegern geschrieben, und das war in diesem Falle die Katholische Kirche - zur Romanzeit ist aber noch alles im Fluss, und das gedenkt Rheinberg auszunutzen. Van den Boom hat eine Menge Recherchen betrieben - auch in Bereichen, die weniger geläufig sind als Kaisertabellen; etwa wenn es um Befehlsstrukturen in der römischen Marine geht. Der eine oder andere Anachronismus rutscht dann doch durch, etwa wenn die römischen ProtagonistInnen ohne erkennbare Linie mal deutsche, mal lateinische Ortsnamen verwenden - und Begriffe wie "Meter" oder "Cäsarenwahn" dürften ihnen auch noch nicht geläufig sein. Auch ist der Bildungsgrad sämtlicher Figuren - vom Latein-Fan Rheinberg bis zum ambitionierten Fischer - bemerkenswert hoch: Kleiner Griff in die Trickkiste, um Verständigungsschwierigkeiten zu überbrücken. Der junge Fähnrich Volkert versteht es nach ein paar Sprachstunden an Bord sogar, dass ihn eine junge Römerin "Schnösel" nennt (wenn dafür jemand die Vokabel kennt: bitte posten).
Im defensiver als nötig geratenen Nachwort argumentiert der Autor, dass die Figuren nicht wie Personen ihrer jeweiligen Zeit agieren. (Beiseit': Dann müsste aber auch nicht der Kaiser zu seinem Leibdiener - zumal eh auf Latein - sagen: "Ich werde mich früh zur Ruhe legen." - "Ihr bedürft der Ruhe." Terry Pratchett, der von künstlich auf altertümelnd getrimmter Sprache gar nichts hält, würde sich darüber zerkugeln ...) Es versteht sich ohnehin von selbst, dass es sich nur um Projektionen handeln kann. Man denke nur an die Unmenge von "historischen Romanen", die - sorry, ist aber so - mehrheitlich von Autorinnen geschrieben werden und weibliche Hauptfiguren haben. In ihrer Gesamtheit vermitteln sie den Eindruck, vom Hochmittelalter bis zum 17. Jahrhundert hätte die weibliche Hälfte der Bevölkerung primär aus Apothekers- und Kaufmannstöchtern bestanden, die über eine heimlich aber gründlich erworbene Universalbildung verfügten und in souveräner Selbstständigkeit Mordfälle lösten, Kriege verhinderten und die Welt bereisten. - Im Vergleich dazu wirkt Rheinbergs Verhalten wieder durchaus plausibel: Dass er mit seinen politischen Plänen den Verlauf der Geschichte komplett verändern wird, scheint ihm keine schlaflosen Nächte zu bereiten. Warum auch, der Begriff "Zeitparadoxon" war in seiner Ära noch nicht erfunden - und der im Grunde ökologische Gedanke, nur ja keine unauslöschlichen Spuren zu hinterlassen, dürfte einem wilhelminischen Marineoffizier auch nicht gerade in Fleisch und Blut gesteckt haben.
Eine abschließende Bewertung ist noch nicht möglich: "Die Ankunft" enthält einiges, das den Roman ganz klar lesenswert macht. Doch schafft er in erster Linie eine interessante Ausgangslage - weitere Bände (im Jänner soll "Kaiserkrieger: Der Verrat" folgen) werden zeigen, was van den Boom - vor allem im Hinblick auf die wachsende Kluft zwischen der Zeitlinie des Romans und unserer - daraus macht.
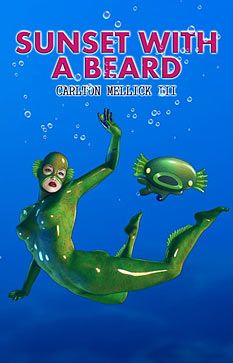
Carlton Mellick III: "Sunset With A Beard"
Broschiert, 200 Seiten, Swallowdown Press 2010.
Die Bizarro Fiction ist mittlerweile also auch alt genug geworden, ihr erstes rundes Jubiläum zu feiern: Der richtige Zeitpunkt, sich mit dem Frühwerk eines ihrer erfolgreichsten Autoren zu befassen. Carlton Mellick III präsentiert zum Zehnjährigen eine um fünf Bonus-Stories ergänzte Neuauflage der Sammlung, in der die ersten Erzählungen enthalten sind, für die er einst einen Verlag fand. Das hat fast schon eine historische Komponente, denn bevor der Begriff Bizarro zum Selbstläufer wurde, musste man als Autor noch versuchen, seine seltsamen Geschichten in etablierten Genre-Medien unterzubringen. Und wenn es um den Preis war, einer Geschichte einen späten SF-Twist zu geben, der sie zwar nicht besser machte, aber vielleicht ihre Chance auf Akzeptanz erhöhte.
... wie zum Beispiel in "City of New York", wo der Provinzler Jack im Big Apple ankommt und staunend feststellt, dass die Menschen hier keine Münder haben und die Straßen bald vor überdimensionalen Tausendfüßlern wimmeln. Was wie ein Schreib-Workshop-Versuch, das Dasein eines Außenseiters symbolisch darzustellen, beginnt und im Fortgeschrittenenkurs einen Drall Richtung William Burroughs annimmt, erhält zum Schluss dann eine "logische" Erklärung verpasst. Wie auch "Between Midnight and Tomorrow", in dem nur der Protagonist die zeitlose intermission wahrnimmt, in der Menschen mit ihren Schatten den Platz tauschen. Beide Geschichten sind nicht Fisch noch Fleisch und zeigen, wie heikel der Seiltanz war, den Mellick zwischen den von ihm so bezeichneten Kategorien "Science Fiction" und "Surreal" (das Wort "Bizarro" gab es damals noch nicht) vollführte - er nahm sie als weitgehend unvereinbar wahr. Was seinerseits literaturgeschichtlich interessant ist, denkt man beispielsweise an die psychedelischen Trips von Michael Moorcocks "Jerry Cornelius"-Romanen oder überhaupt die New Wave der Science Fiction in den späten 60er und 70er Jahren zurück. Die Ausdifferenzierung der Phantastik ist seitdem offensichtlich weit vorangeschritten - Schubladen in Schubladen in Schubladen.
Es sind sogar einige astreine SF-Erzählungen enthalten, die wieder interessanter sind als obige Zwitterwesen und gut von AutorInnen einer früheren Generation stammen könnten. In "Venus' Triangle" erfindet die todkranke Titelheldin ein Gerät, das Musik empfängt, deren Ursprung niemand kennt. "Multiple Personalities" schildert die Alltagshölle von fünf Bewusstseinen, die sich auf einer Welt der Überbevölkerung einen Körper teilen müssen, und "Drunk and King" lässt einen notorischen Säufer auf einem Planeten landen, in dem alles in Slow Motion abläuft. Allesamt gute Ausgangsideen für konventionelle SF-Geschichten - auch wenn "Kiss the Sun" mit seinen absurden Zügen den Vogel abschießt: Aliens haben den Mars kolonisiert - ein paar von deren halbintelligenten Terraformierungshelfern sind jedoch zur Erde geflüchtet und beleben hier nach Lust und Laune Objekte: it is now commonplace to see furniture marching in a parade, street signs eating rotten hamburger meat, autocars shaking water from their backs, and so on. Es entfaltet sich eine Teenager-Romanze mit Hindernissen, während die Erde zunehmend zu einem gefährlichen Erlebnispark à la "Roger Rabbits" Toon Town verkommt.
Diese Geschichten sind ein leichter Einstieg in die normalerweise sehr viel abseitigere Gedankenwelt des Carlton Mellick III. Konventionell sind sie nämlich auch in dem Sinne, dass es hier Handlungspersonen gibt, die Dialoge führen und sogar echte Beziehungen haben. Denn hier verläuft die Trennlinie zwischen den Geschichten, die Mellick als "SF" klassifiziert hat, und den "surrealen" viel klarer als rein an den Plots gemessen. In den surrealen Geschichten herrscht nämlich die große existenzialistische Einsamkeit - in "God on Televison" verschwindet überhaupt die ganze Außenwelt, während der Protagonist allein mit seinem Sex-Goldfisch und (huch, wie symbolisch!) einem Einsiedlerkrebs zu Hause verschimmelt. Fast immer drehen sich die Geschichten um einen vereinsamten Einzelgänger, der sich nach einer Frau sehnt - vorzugsweise einer mit grünen Haaren.
Körperlichkeit spielt bei Mellick stets eine große Rolle - und damit verbunden auch das Fressen und Gefressenwerden. Neben den oben genannten Tausendfüßlern tauchen mit den "Scrows" auch künstliche Mini-Wesen auf, die die Menschheit vor einer Käferplage schützen sollen - bisweilen aber auch eine Portion Homo sapiens auf dem Menü stehen haben. In "The Earwig Flesh Factory" ist menschliches Fleisch sogar als Bausubstanz in Verwendung: Ein überaus fieses Märchen, in dem Kinder ihre Großmutter um eine Geschichte anbetteln, ohne dabei zu merken, dass sie selbst zu deren Hauptfiguren werden: "Tell us how you had to start brainwashing your children to do what you wanted" ... - In "Fistworld" schließlich baut ein Farmer auf seinem Acker menschliche Hände an. Er ist hin- und hergerissen zwischen Sex-Träumen mit einer (natürlich grünhaarigen) LKW-Fahrerin und Albträumen, dass ihn der Geist von Jesus von unten aus der Kloschüssel beobachtet. Einmal mehr stellt sich dabei heraus, dass auch Paranoiker verfolgt werden können.
Auch wenn viele der Geschichten niederschmetternd traurig sind - einige Bilder bleiben doch auch wegen ihrer Schönheit im Gedächtnis. Etwa wenn aus Plastikwolken Plastikregen fällt oder der Protagonist von "An Era of Liquid Streets" hilflos mitansehen muss, wie sich seine Ehefrau langsam zu einer Flüssigkeit auflöst - bis er sie schließlich in Kübeln hinaus in den Sonnenuntergang trägt. Einen Sonnenuntergang mit Bart. - Man smiles at the plastic, and the plastic smiles back. Wer braucht da noch Supermarkt-Gothic mit Vampirzähnen? - Das ist teenage angst.

Adam-Troy Castro: "Die dritte Klaue Gottes"
Broschiert, 428 Seiten, € 14,40, Bastei Lübbe 2010.
"Jemand in diesem Raum ist ein Mörder." - Dieser Golden Oldie unter den Krimi-Sätzen fällt hier tatsächlich, und wäre "Die dritte Klaue Gottes" von Agatha Christie geschrieben worden, dann hätte es wohl "Mord im Weltraumfahrstuhl" geheißen. Es findet sich sogar eine kleine versteckte Anspielung auf "Mord im Orient-Express" im Roman ... kann man ruhig erwähnen, weil die beiden Fälle nicht das gleiche Lösungsschema haben. Und wenn wir schon bei Anspielungen sind: Der Roman eröffnet ganz im Stil von "Sunset Boulevard" mit den Worten einer Toten, die rückblickend erzählt, wie es zu ihrem Sterben kam. So sieht's zumindest aus.
"The Third Claw of God" ist der zweite abgeschlossene Fall für Ermittlerin Andrea Cort, ihres Zeichens "Sonderstaatsanwältin" des Diplomatischen Corps der Hom.Sap-Konföderation irgendwann in mittlerer Zukunft. Hinter dieser Berufsbezeichnung verbirgt sich allerdings ein langer, hässlicher Rattenschwanz von Ereignissen, denn Adam-Troy Castro - ein Autor aus Florida, der gerne zwischen den verschiedenen Subgenres der Phantastik pendelt - hat seiner 2008 ins Leben gerufenen Protagonistin eine bluttriefende Vita verpasst. Als Kind war Andrea unfreiwilliger, aber aktiver Teil eines Massakers an Außerirdischen auf einem bis dahin unwichtigen Kolonialplaneten. Dass dieses Gemetzel von außen ferngelenkt wurde, ändert nichts daran, dass sich Andrea seitdem vor allem den kosmischen Nachbarn der Menschheit als Ikone des menschlichen Blutdurstes eingeprägt hat und bei manchen Spezies als vogelfrei gilt - nur die diplomatische Immunität schützt sie. Knifflige Fälle übernimmt sie gewissermaßen als Bezahlung für diesen recht wackeligen Schutz - gleich zu Beginn stellt sie einen neuen Rekord auf, wie schnell sie an einem Ort ankommen und Ziel eines Attentats werden kann: Ich spreche von Minuten. Minuten.
Andrea gibt eine durchgehend sarkastische Ich-Erzählerin ab - von dem "Miststück", als das sie sich selbst tituliert, geschweige denn dem "Monster", als das sie am Einband beworben wird, ist sie allerdings meilenweit entfernt. Statt dessen lernen wir eine Andrea kennen, die von ihrer planetengebundenen Vergangenheit soweit traumatisiert wurde, dass sie künstliche Nahrung ebenso wie künstliche Umgebungen jedem natürlichen Pendant vorzieht. Und die heftig genervt von der Kommunikation mit den KIquellen - Künstlichen Intelligenzen außerirdischen Ursprungs - ist, mit denen sie ein Gehirn-Interface verbindet. Die KIquellen stellen der Konföderation seit langem Dienstleistungen zur Verfügung - dass sie Andrea heimlich zu ihrer Spezialbeauftragten erkoren haben, ahnt unter den Menschen niemand. Zu Andreas fortwährendem Verdruss gefallen sich die KIquellen in einem Kommunikationsstil, der aus der Religion bekannte Züge trägt: Omnipräsent, aber selten auf Wunsch erreichbar, melden sie sich gelegentlich in Andreas Kopf, machen ominöse Andeutungen zur Zukunft und fordern ihren Schützling zu richtigem Handeln auf, ohne aber nähere Hinweise zur Entscheidungsfindung zu geben - ein zwangsweiser Reifungs- und Erziehungsprozess, den Andrea nicht beeinflussen kann. Willkommene Entspannung findet sie in ihrer beruflichen wie auch sexuellen Beziehung zu den Porrinyards, einem verbundenen Paar, das einen gemeinsamen Geist auf einen männlichen und einen weiblichen Körper verteilt.
Diesmal verschlägt es die drei/zwei auf den Privatplaneten der Familie Bettelhine, die für den Großteil der Menschheit das Böse an sich verkörpert: Reich und mächtig geworden durch Waffenhandel, scheint bei der Dynastie nun ein Paradigmenwechsel anzustehen. Just in dieser entscheidenden Phase wird ein langjähriger Berater der Bettelhines ermordet ... und Andrea fühlt sich endlich wie zu Hause. Und wir mit ihr, denn damit setzt sich eine klassische Murder Mystery in Gang, mit allen Elementen, die da so dazugehören: Verdächtige aus besseren Kreisen, gegenseitige Anschuldigungen, ein begrenzter Raum (hier: der steckengebliebene Weltraumfahrstuhl der Bettelhine-Welt) und eine pittoreske Waffe mit kulturgeschichtlicher Bedeutung, nämlich obige Klaue Gottes. Auf eine recht nostalgische Weise wird's damit ebenso vergnüglich wie gemütlich, wenn man zwischendurch immer wieder mal zurückblättert, um nachträgliche Bestätigung für einen Geistesblitz zu finden, wer sich in entscheidenden Situationen verdächtig gemacht haben könnte: Science Fiction, die sich am besten mit Gebäck und einem Heißgetränk konsumieren lässt.
Dass zwischen Andrea Cort und Miss Marple bzw. Hercule Poirot einige Jahrhunderte respektive - wichtiger noch - zwischen Adam-Troy Castro und Agatha Christie einige Jahrzehnte Abstand liegen, macht sich freilich auch bemerkbar. Kurz: Es fällt alles ein wenig drastischer aus, wenn nach und nach die Geheimnisse, Doppel-Identitäten, Vorgeschichten und verborgenen Beziehungsgeflechte der Beteiligten aufgedeckt werden. Statt good old klassenspezifischer Unterdrückung stößt man da gleich auf beinharte HighTech-Sklaverei, statt wenig salonfähiger sexueller Vorlieben auf Pädophilie mit Opfern im niedrigen einstelligen Jahresbereich, statt politischer Jugendsünden auf Beihilfe für einen milliardenfachen Massenmörder. Und der Mord selbst hat auch kein schmuckes kleines Einschussloch hinterlassen, sondern dafür gesorgt, dass das Opfer von innen her in einer schwarzen Soße aus Blut, Scheiße, Galle und verflüssigten Eingeweiden ausgelaufen ist. Vielleicht war das mit dem Gebäck ja doch keine so gute Idee ...
"Die dritte Klaue Gottes" ist in konzentrischen Schalen aufgebaut: Ganz innen das Whodunnit-Kammerspiel, das sich problemlos für die Bühne adaptieren ließe. Eine Ebene weiter die Rettungskommandos von der Planetenoberfläche, die zur Verblüffung der im Fahrstuhl Eingeschlossenen einen Belagerungsring aufziehen, statt helfend einzugreifen. Und ganz außen die Hintergrundebene aller Andrea-Cort-Romane, nämlich das undurchschaubare Agieren der KIquellen (die Andrea hier mal eben das Wort "Genozid" vor die Füße werfen ... natürlich ohne den Kontext zu präzisieren). Soweit Andrea weiß, wollen die Künstlichen Intelligenzen letztlich nichts anderes als sterben - irgendwie verständlich: Sie sind älter als die Menschheit, und jede Sekunde gleicht in der Geschwindigkeit ihrer Denkprozesse Jahren. Doch eine abtrünnige Fraktion scheint andere Pläne zu hegen. Andrea verteufelt diese als die Unsichtbaren Dämonen ... aber Castro streut immer wieder kleine Zweifel daran aus, wer sich wirklich in der moralisch höheren Position befindet. - Da ist noch reichlich Stoff für weitere Romane vorhanden, um noch mehr Spuren zu legen und noch mehr Nebelkerzen zu zünden. Der dritte Cort-Roman, "Sturz der Marionetten", soll im Oktober erscheinen - erstaunlicherweise erst (und vielleicht auch: nur) auf Deutsch.

Michael McBride: "Sturm der Seelen"
Broschiert, 507 Seiten, € 10,30, Blanvalet 2010.
Leise rieselt der Schnee des nuklearen Winters auf diejenigen, die Michael McBrides ersten Roman "Reiter der Apokalypse" (hier die Nachlese) überlebt haben: Der Seher Phoenix, der Militärarzt Adam Newman, die Biologin Evelyn Hartman, das Geschwisterpaar Missy & Mave Stringer und die StudentInnenclique um die von Untergangsvisionen geplagte Jill. Die hat sie immer noch, auch wenn die Apokalypse längst über den Globus hinweggerauscht ist - denn das Grauen ist noch lange nicht vorbei. Während sich die aus dem Vorgängerband bekannten ProtagonistInnen in einer Höhle nahe dem Großen Salzsee von Utah verschanzen und nach und nach weitere traumatisierte Überlebende eintreffen, sammelt sich im nuklear verwüsteten Denver Gottes auserwählte Armee unter der Führung von Gevatter Tod und seiner apokalyptischen Reiter-Equipe. Zusätzliche Gefahr lauert in direkter Nähe, denn unter den Neuankömmlingen in der Höhle befindet sich auch der ehemalige Kongressabgeordnete Richard Robinson, der nach dem Weltuntergang seine Chance gekommen sieht, die Macht zu ergreifen. Dem Buch ist die Passage über den falschen Propheten der Endzeit aus dem Markus-Evangelium vorangestellt - man braucht nicht lange darüber zu rätseln, wer damit in "Sturm der Seelen" ("Blizzard of Souls") gemeint ist.
Wie schon zu "Reiter der Apokalypse" gesagt, sind die Ähnlichkeiten zu Stephen Kings Bestseller "The Stand" zumindest an der Oberfläche verblüffend: Nach der Katastrophe, die den größten Teil der Menschheit ausgelöscht hat, sammeln sich unter biblischen Vorzeichen die wenigen Übriggebliebenen - einem geistigen Ruf folgend - in zwei antagonistischen Lagern, die nicht allzuweit voneinander entfernt liegen (und natürlich beide in den USA). Der entscheidende Unterschied jedoch: Anders als bei King scharen sich die, die uns vom Autor als die Guten präsentiert werden, nicht um jemanden wie die weise Christenmenschin Abagail Freemantle, sondern um Phoenix, der seit seiner Kindheit von einer Sekte irrer christlicher FundamentalistInnen missbraucht wurde und dementsprechend eine etwas andere Einstellung zum Glauben hat. Er äußert sogar den phänomenalen Satz, dass man sich zum Krieg gegen Gott rüsten müsse ... es war fast zu erwarten, dass diese Aussage in Teil 2 der überaus blutigen "God's End"-Trilogie etwas relativiert werden würde. Ganz plötzlich heißt es: "Ich glaube, Gott gibt uns Hinweise, damit Er sehen kann, ob wir es wert sind zu überleben." Wie außerordentlich schade - allerdings wirft diese Volte gleich die nächste Reihe von Fragen auf, und zumindest Evelyn will mit demjenigen, der die ganze weltweite Sauerei verursacht hat, nichts mehr zu tun haben: Welcher Gott könnte seine eigenen Kinder derart hassen, dass er von ihnen verlangt, sich selbst zu vernichten?
Dergleichen Fragen stellen sich alle Romanfiguren - nicht zuletzt Tod selbst, der wie die drei anderen Reiter der Apokalypse ursprünglich ein Mensch war, ehe er von dem rekrutiert wurde, der ihn nun wieder zu verlassen scheint. Inmitten der vor Dämonen wimmelnden Ruinen Denvers, die Dantes "Inferno", in Szene gesetzt von Hieronymus Bosch, entsprungen sein könnten, philosophiert Tod über die dichotome Natur Gottes: Liebe und Vergeltung, begründet im Schöpfer, fortgesetzt in den Menschen. Es nagt an Tod, dass er sich der Unterstützung Gottes bei der endgültigen Vernichtung der Menschen nicht mehr länger sicher ist. Gott hatte sich von ihnen abgewendet und Tod auf sie losgelassen, um sie zu vernichten, und jetzt stand Er hinter dem Vorhang und sah heimlich zu. Kurz: Tod fühlt sich von Gott verarscht - und fast ist man geneigt, ein wenig sympathy for the devil zu empfinden ... bis man sich wieder daran erinnert, dass Tod der personifizierte Holocaust ist.
Auf jeden Fall mausert sich Tod durch die ungewöhnliche Zeichnung McBrides immer mehr zur interessantesten Figur der ganzen Trilogie - und zwar einer, die ihrerseits voller Widersprüche steckt. Er verachtet die Menschen für ihre Unfähigkeit, das Leben als etwas Heiliges und Unantastbares zu erkennen - um daraus im nächsten Satz den Schluss zu ziehen: Er würde das rücksichtslose Schlachten genießen. Denn das steht nun für ihn fest: Was immer Gottes Wille (gewesen) sei, er wird das Zerstörungswerk nun in Eigenregie vollenden. Etwas ungemütlich - vor allem angesichts des angedeuteten Seitenwechsels des ursprünglichen Auftraggebers der Apokalypse - ist es zu registrieren, dass Tod den Weg für "etwas Neues" frei machen will, also in Kategorien der Evolution zu argumentieren beginnt. Dabei verkennt er allerdings, dass Neues schon längst unterwegs ist und sich seit Teil 1 der Trilogie Tiere auf der Welt tummeln, die in etwas verwandelt wurden, das man sonst nur in Animes zu sehen bekommt. Und kein Vertreter der spektakulären neuen Fauna - abgesehen von den zu Dämonen verwandelten Menschen - stellt sich auf Tods Seite.
Mehr denn je stellt sich die Frage, worauf der Autor letztlich hinauswill. Der zweite Teil der Trilogie wird wegweisende Ereignisse bringen und doch LeserInnen wie auch Romanfiguren in einer spannenden Ungewissheit belassen, die im Abschlussband "Legionen des Todes" (Erscheinungstermin: Dezember) hoffentlich einer würdigen Auflösung zugeführt wird. Am Ende von "Sturm der Seelen" sähe Reich-Ranicki betroffen den Vorhang zu und alle Schädel offen: Gehirnmasse wird hier reichlich verspritzt. Das Gore-Level erreicht neue Rekordwerte!
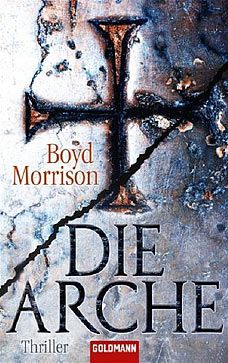
Boyd Morrison: "Die Arche"
Broschiert, 448 Seiten, € 10,30, Goldmann 2010.
Wir bleiben bei der Eventkultur nach alttestamentarischem Verständnis. Verantwortlich dafür ist die Kirche der heiligen Wasser - dabei denkt man vielleicht an steinere Schalen, in die man behutsam die Finger taucht, um sich die Stirn zu benetzen, oder auch ein versiegeltes Barock-Behältnis, in dem irgendein heiliges Körperteil dümpelt. Aber nix da! Die Kirchenmitglieder nennen sich auch Diluvianer - es geht also um die Sintflut. Unter den im Buch vorkommenden Archen befindet sich daher auch das biblische Original, das aber die eine oder andere Überraschung bereithält. "The Noah's Ark Quest" heißt der Roman, der ursprünglich als Download veröffentlicht wurde und nun nahezu synchron in deutscher und englischer Buch-Version erschienen ist. Goldmann hat einmal mehr schneller übersetzt, als Noahs Taube fliegen kann - erfreulicherweise ohne dass sich das in einer erhöhten Vertippser-Quote niedergeschlagen hätte.
Dass die Arche - die Arche - nach all den gescheiterten Expeditionen zum Berg Ararat nun tatsächlich gefunden wurde, daran lässt das Vorwort keinen Zweifel. Auch wenn ihr Entdecker, der Archäologe Hasad Arvadi, zu dem Zeitpunkt bereits im Sterben liegt und den LeserInnen keine genauere Beschreibung mehr liefern kann. - Szenenwechsel zu Arvadis Tochter Dilara Kenner, ihres Zeichens Bioarchäologin, die mit Sam Watson, einem Bekannten ihres Vaters, gleich den nächsten unmittelbar Todgeweihten trifft. Ehe Sam einem heimtückischen Mordanschlag erliegt, sprudelt er sterbend noch jede Menge ominöse Worte hervor: "Projekt Oasis ... Genesis Dawn ... die haben vor, Millionen, vielleicht Milliarden Menschen zu töten." - Fast so ominös wie der letzte Funkspruch, der bald darauf aus dem Cockpit des Privatjets eines Filmstars erklingen wird: "Ich schmelze! Wir alle schmelzen!" Die Geschehnisse setzen sich in Gang, Dilara findet sich ihrerseits im Fadenkreuz der Attentäter wieder und rettet sich fürs erste auf eine Ölplattform, wo sie der Experte für Katastrophenprävention und -management Tyler Locke in Empfang nimmt. Gemeinsam drehen sie den Spieß um und werden von Gejagten endlich zu Jägern.
Dilara scheint zunächst die Hauptfigur zu sein, doch verblasst sie bald neben der Sonne von Tyler Locke. Der rettet Schiffbrüchige, spürt Zeitbomben auf, ringt mit bewaffneten Schurken auf einem dahinrasenden Muldenkipper, macht dazu noch eine gute Figur im Smoking und ist ganz generell ein toller Hecht. Er erkennt sogar, dass eine Gestalt, die er verschwommen durch den Nebel ausmacht, nicht einfach nur eine Maschinenpistole trägt, sondern ganz klar eine Heckler&Koch-MP-5. Echte Experten sind ihre Gage eben wert! Und wenn er Dilara wieder mal gerettet hat, heißt es: Tränenüberströmt sah sie zu ihm auf. Noch nie hatte sie so schön und verletzlich ausgesehen. Er beugte sich zu ihr und küsste sie auf die salzige Wange. - Ja, das ist schon reichlich dick aufgetragen - dafür durchaus verfilmungstauglich. Boyd Morrison hat vor seinem Romandebüt offenbar viele Thriller gelesen bzw. gesehen und auch auf das Muss des Vater-Sohn-Konflikts (der unweigerlich in die lange ersehnte Anerkennung münden wird) nicht vergessen.
Vor seinem Wandel zum Autor hat der gelernte Ingenieur für die NASA und zuletzt Microsoft gearbeitet. Nicht uninteressant auch die Berufspalette seiner recht akademischen Familie - da hatte Morrison BeraterInnen von der Geologie bis zur Kunstgeschichte gleich frei Haus. So wird der Sintflut sowohl aus der mythologischen (das Gilgamesch-Epos als Inspirationsquelle für das Alte Testament) als auch der geologischen Perspektive (der Bosporus-Durchbruch des Mittelmeers ins Schwarze Meer vor geschätzt 9.000 Jahren) gedacht. Nur oberflächlich zwar, aber einige der Gedankenspiele haben durchaus Witz - etwa wenn Dilara und Tyler durchrechnen, dass Noah bei wörtlicher Bibel-Auslegung pro Sekunde 50 Tierpaare an Bord der Arche hätte bringen müssen. Natürlich wird sowohl im historischen als auch im biologischen Bereich - Stichwort: Prionen - wild spekuliert, aber da hat man im Genre Wissenschaftsthriller schon Wüsteres gelesen.
Was nicht funktioniert, ist die Zeichnung von Dilaras und Tylers Gegenspieler Sebastian Ulric, Eigentümer eines milliardenschweren Pharmakonzerns und Gründer besagter Kirche der heiligen Wasser. Einen religiösen Antrieb nimmt man weder ihm noch seinen Untergebenen ab - und auf irgendeine Beschreibung des Sektenlebens, die dem Glaubwürdigkeit verleihen könnte, vergisst Morrison auch. Vielmehr präsentiert sich Ulric als nüchtern den Weltuntergang planender Bond'scher Erzschurke - genauer gesagt: wie Hugo Drax in "Moonraker". Erinnert sich noch wer an das Ensemble junger Herrenmenschen, die an Bord von Drax' Weltraumstation wort- und bedeutungslos in der Gegend herumlungerten? Die Mitglieder von Ulrics Kirche spielen exakt die gleiche Nicht-Rolle.
Morrisons "Arche" schwimmt - mit ziemlichem Erfolg - auf der Welle der Wissenschafts- und Verschwörungsthriller, die ungebrochen ein religiös besetztes Trumm nach dem anderen aus der Kulturgeschichte hervorholen und zum Katalysator für möglicherweise welterschütternde Ereignisse machen: Schnell konsumierbares Lesefutter für Fans von Dan Brown bis Frank Schätzing, bevor dieser von der Blähsucht befallen wurde. Spannung bezieht der Roman primär aus der Frage, wie sich Arche 1 - das Bibel-Requisit - und Arche 2 - ein Millionen-Dollar-Projekt - unter einen Hut bringen lassen (die Antwort darauf wird sich übrigens in einer recht kreativen Bibel-Exegese finden), sowie aus diversen ... Verfolgungsjagden. Fällt dieses Stichwort, suchen alle, die mich kennen, augenblicklich das Weite, weil sie den anstehenden Sermon schon mitsingen können. Die Kurzfassung: Verfolgungsjagden sind nicht mein Ding. Deshalb, weil sie nur auf zwei Arten enden können: a) Verfolger holt Verfolgten ein. b) Verfolgter entkommt. Im Kino denke ich mir jedesmal, ob wir nicht bitte gleich zum Ergebnis kommen und das Gesause dazwischen einfach überspringen könnten ... ein Standpunkt, den allerdings die wenigsten zu teilen scheinen. Daher darf ich freudig verkünden: "Die Arche" enthält jede Menge rasante Verfolgungsjagden!

Sascha Mamczak & Wolfgang Jeschke: "Das Science Fiction Jahr 2010"
Broschiert, 1141 Seiten, € 30,80, Heyne 2010.
Mit einem Sachbuch hat die Rundschau begonnen und so soll sie diesmal auch enden. Das alljährliche Science-Fiction-Kompendium des Heyne-Verlags ist seit langem eine feste Größe und alleine schon wegen seines Umfangs nicht die typische Strandlektüre - also hab ich mir's für die Zeit aufgespart, wo man wieder mit kühlerem Kopf liest. In Sachen Umfang hat sich allerdings Erstaunliches getan: Es ist geschrumpft ... auf 1100 Seiten und ein paar zerquetschte. Diesmal fehlt nämlich der übliche Schwerpunkt, in dem in früheren Ausgaben ein Generalthema (im letzten Jahr: Superhelden) von verschiedenen AutorInnen und aus den verschiedensten Blickrichtungen betrachtet wurde. Im Editorial heißt es, dass die 2010er Ausgabe mit Schwerpunkt endgültig jedes Format gesprengt hätte - angesichts der bisherigen Entwicklung glaubt man das den Herausgebern gerne. Trotzdem schade.
Der in jeder Beziehung dickste Brocken kommt vom Wissenschaftsjournalisten Rüdiger Vaas, der auch in dieser Ausgabe wieder die Brücke von der Fiction zur Science schlägt: Zeitreisen lautet diesmal das Thema. Nach einer wahren Lawine an Literaturverweisen geht's dann erst richtig in die Vollen, wenn physikalische Gedankenspiele vollzogen werden, wie das Universum selbst oder besondere Regionen darin als "kosmische Zeitmaschinen" funktionieren könnten, was alles bei Zeitparadoxien zu beachten ist und wie sich das Universum durch eine Zeitschleife selbst erzeugt haben könnte. Wie üblich hat das Thema den Effekt einer Mundl-Watschen: Es wackelt einem danach 14 Tage lang der Schädel.
Zwei weitere Aufsätze gehen in der Zeit zurück: Alexander C. T. Geppert erinnert an die Pionierphase des Weltraumzeitalters während der Zwischen- und Nachkriegszeit, als begeisterte Amateure in privaten Weltraumvereinen erste praktische Experimente wagten, vor allem aber Lobby-Arbeit in Sachen Raumfahrt betrieben. Und Uwe Neuhold widmet sich in "Die Bagdad-Batterie und Hesekiels Raumschiff" in sehr vergnüglicher Weise der Pseudowissenschaft des Paläo-SETI. Also Erich von Däniken und allen Gleichgesinnten, die historische Artefakte aus deren kunst- und motivgeschichtlichem Kontext reißen und sie als vermeintliche Belege für versunkene HighTech-Zivilisationen der Öffentlichkeit präsentieren. Alleine schon wie Neuhold - unwiderlegbar - zum ironischen "Schluss" kommt, dass die alten Sumerer Einblick in unsere Supermarktregale gehabt haben müssen, ist lesenswert. Enthalten ist auch eine Auflistung der bekanntesten Objekte - vom "Abydos-Helikopter" bis zu den altägyptischen "Glühbirnen von Dendera", denen thematisch Interessierte ausführlich hinterhergoogeln können. Aber Vorsicht: Im Internet sind die seriösen Informationsquellen dazu nicht unbedingt im Vorteil!
Um und Auf des Kompendiums ist natürlich die Phantastik-Literatur. Unter anderem sind ausführliche Interviews mit herausragenden Vertretern des Genres enthalten: China Miéville, der nicht nur beweist, dass man Sozialismus und Phantasmagorien bestens miteinander kombinieren kann ("Mich interessiert beides - die Politik und die Monster!"), sondern darüberhinaus, dass ihm präzises Denken auch bei Interviewfragestellungen wichtig ist. Hard-SF-Star Stephen Baxter wiederum erklärt, warum er weniger an eine technologische als an eine biologische Singularität glaubt und wie die ferne Zukunft der Menschheit ihrer ebenso fernen Vergangenheit ähneln könnte. Und so ganz nebenbei erwähnt er noch, dass er sich einen letzten "Xeelee"-Roman vorstellen könnte, in dem wir die geheimnisvollen Wesen nach all der langen Zeit endlich zu Gesicht bekommen. - 100 Seiten Buchrezensionen und 150 Seiten Marktberichte über die nach Zahlen und Titeln gemessene Lage der Phantastik in den USA, Großbritannien und im deutschsprachigen Raum komplettieren das literaturbezogene Angebot.
... und natürlich wird auch auf die anderen Medien nicht vergessen: Seien es Computerspiele, unter anderem mit einem Schwerpunktartikel zu "Fallout", ein Beitrag über den Ursprung der vermeintlich typisch europäischen Musikform Techno in Detroit, Hörspiele (denen sehr viel mehr Raum gegeben wird als Comics - deckt sich das mit dem Medienkonsum hier im Forum?), vor allem aber Film und Fernsehen. Ersteres in Form einer näheren Betrachtung von "Avatar" (Simon Spiegels "Ein blaues Wunder"; sehr interessant zu lesen), dazu passend ein Artikel über die - mittlerweile dritte - 3-D-Revolution des Kinos; vielleicht erweist sich die gegenwärtige ja als nachhaltiger als ihre beiden Vorgängerinnen. Das Thema Science Fiction im Fernsehen umfasst einen Schwerpunkt zum Aufstieg und tiefen Fall von "Star Trek", wozu sich noch zwei - konsequent subjektive - Betrachtungen von "Battlestar Galactica" und des "Terminator"-Franchise gesellen. Kurz: Es ist wieder mal für jede(n) was dabei. Im nächsten Jahr dann hoffentlich auch wieder der so liebgewonnene große Themenschwerpunkt.
Damit verabschiede ich mich mit sofortiger Wirkung in einen mehrwöchigen Urlaub, aus dem ich im Oktober in bester Gesellschaft zurückkehren werde: Unter anderem der von Ted Chiang, China Miéville und Kevin J. Anderson. (Josefson)