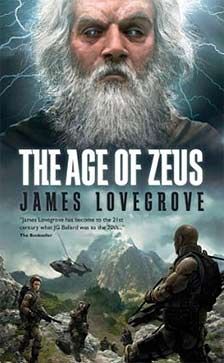
James Lovegrove: "The Age of Zeus"
Broschiert, 688 Seiten, Solaris 2010.
Wie heißt es doch so schön: Wenn die Götter uns strafen wollen, erhören sie unsere Gebete. Imagine: Eine Welt in Frieden. Kriege und Diktaturen sind ebenso passé wie Terrorismus, religiöse Fundamentalismen und der größte Teil der Kriminalität. Und all die Unsummen, die früher "Verteidigungs-" und Sicherheitsmaßnahmen verschlungen haben, fließen nun in das Schulwesen, soziale Einrichtungen und erneuerbare Energien. Der Haken an der Sache: Diejenigen, die das alles verwirklicht haben - nämlich die kürzlich wiedergekehrten Götter des alten Griechenland -, sind gekommen, um zu bleiben. Da hocken Zeus, Athene und Co also wieder auf dem Olymp und regieren mit harter Hand und übernatürlichen Kräften den Globus. Die Ruinen des ausgelöschten Hongkong bilden ein eindringliches Mahnmal, was bei Widerstand gegen die göttliche Vernunft zu erwarten ist - und hier und da mal ein kleinerer Massenmord an unbotmäßigen Menschlein frischt die Erinnerung gerne wieder auf. Die Welt sitzt wie eine Schulklasse in Anwesenheit eines strengen Lehrers aufrecht und mit den Händen auf dem Tisch da. Dass die Menschheit des 21. Jahrhunderts in Summe der Opfer bei diesem System besser fährt als beim vorangegangenen, ist eine der vielen ironischen Noten von James Lovegroves "The Age of Zeus", erinnert nicht von ungefähr an die berühmte Monty-Python-Frage "What have the Romans ever done for us?" und beschert den ProtagonistInnen des hochgradig unterhaltsamen Romans ein ordentliches Dilemma.
Denn nicht jeder ist gewillt, die New World Order hinzunehmen. Schon gar nicht ein Multimilliardär wie Regis Landesman, der sein Geld im Waffenhandel gescheffelt hat und nun seine Felle davonschwimmen sieht - zynischer könnte das Motiv für den Aufbau einer Widerstandstruppe kaum sein. "Titanen" nennt er sein zwölfköpfiges Kommando; nach den mythologischen Erzfeinden der olympischen Götter. Die HighTech-Anzüge, die jeden Kämpfer den Olympiern und deren Hilfsmonstern wie der Hydra oder den Gorgonen ebenbürtig machen sollen, heißen ebenfalls TITAN - kurz für: Total Immersion Tactical Armour ... with Nanotech; die ewig auf Akronymsuche befindliche NASA hätte das nicht besser zusammenwurschteln können. - Zu Beginn des Romans treffen also die von Landesman ausgewählten Kommandomitglieder - darunter die britische Polizistin Sam Akehurst und der Ex-Marine Rick Ramsay aus Chicago - auf einem abgelegenen Nordsee-Inselchen ein. Dass sich zwölf einander Unbekannte auf die ominöse Einladung eines geheimnisvollen Fremden hin in einem von der Außenwelt abgeschotteten Ambiente wiederfinden, erinnert nicht nur sie an Agatha Christie. Literarische und filmische Anspielungen folgen reichlich, sei es auf Dan Brown oder Arnold Schwarzeneggers Schundfilm-Debüt "Hercules in New York"; eine der Hauptfiguren heißt mit Nachnamen Harryhausen - wie der Stop-Motion-Zauberer, der für die Originalversion von "Clash of the Titans" die Tricksequenzen besorgte.
"The Age of Zeus" ist eindeutig Camp. Das Blut wird fontänenweise spritzen, wenn die "Zweite Titanomachie" - also der neuerlich nach mythologischem Vorbild geplante Kampf zwischen Titanen und Olympiern - beginnt und diesmal hoffentlich andersherum endet. Und nicht nur das, in die Metzelszenen mischen sich auch bemerkenswert ungemütliche Freud'sche Untertöne: Lovegrove geht echt in die Vollen. Im Grunde erspart er seinen ProtagonistInnen nichts: Ihre persönlichen Tragödien sind ebenso Thema wie die brisante Wechselwirkung zwischen Rachegelüsten und strategischem Vorgehen oder das klassische Terroristen-Dilemma: Kann ich mit meinen Aktionen fortfahren, wenn der Feind gegen die Zivilbevölkerung zurückschlägt? Zwischendurch wallt sogar mal Mitleid mit den Monstern auf, die der Reihe nach abzuschlachten sind. Und Zweifel an den wahren Motiven von Mastermind Landesman nagen ebenfalls an den Titanen. Denn während die ganze Welt darüber rätselt, was die Olympier nun sind - wirklich die magischen Kreaturen der Mythologie, doch eher Außerirdische in Verkleidung oder gar Avatare Gaias, mit denen sich die Ökosphäre gegen den Schädling Mensch wehren will? -, scheint Landesman mehr zu wissen. (Und der Roman-Twist wird die Wahrheit ans Licht bringen.)
Das alles kommt aber poppig-leicht daher, garniert mit schräghumorigen Szenen aller Art: Die Götter geben Pressekonferenzen und sind zu Gast in Talk-Shows. Die Angehörigen einer Titanin fahren gerade von einem Meeresfrüchte-Essen nach Hause und werden ihrerseits von der Hydra verschlungen, die in den Sümpfen Floridas auf Pensionistenjagd geht. Hephaistos verbiegt zwecks Mahnung den phallischen Eiffelturm und beschert damit der französischen Männerwelt anhaltende Erektionsprobleme. Und die Titanen verbergen ihre Kommunikation vor dem hundertäugigen Argus, der sich in der digitalen Sphäre eingenistet hat, indem sie ihre Signale in die Übertragungen eines eigens eingerichteten "Mythoporno"-Kanals einbetten, auf dem Perlen wie "Jason and the Arse-onauts" laufen.
Der thematisch recht vielseitige Brite James Lovegrove hatte unter dem Pseudonym "Jay Amory" zuletzt Romane geschrieben, die an ein jüngeres Publikum gerichtet waren ("Die Welt in den Wolken" und "Piraten der Lüfte" sind auch auf Deutsch erschienen); für seine sogenannte "Pantheon Trilogy" ist er zu seinem richtigen Namen zurückgekehrt. "The Age of Zeus" ist - nach "The Age of Ra" und vor dem noch nicht erschienenen "The Age of Odin"- der zweite Teil dieses Trios, aber keine Angst vor einem Quereinstieg: Die Teile sind inhaltlich nicht verbunden, es handelt sich nicht wirklich um eine Trilogie, sondern um drei recht stark voneinander abweichende Variationen desselben Grundthemas: Antike Götter und moderne Zivilisation treffen (mit reichlich km/h) aufeinander. Manche werden dabei automatisch an Dan Simmons' "Ilium" und "Olympos" denken. Auch Richard Bowes hat sich in seinen "Time Rangers"-Erzählungen des Themas in ernsthafter Weise angenommen. Die Götter sind hier zwar einerseits (in den Worten Lovegroves:) that bizarre dysfunctional family, aber eben auch mehr: Dionysos beispielsweise mit seinem orgiastischen Gefolge von Satyrn und Mänaden wird bei Bowes zur Verkörperung des Chaos, die das Raum-Zeit-Gefüge selbst gefährdet.
... von all dem ist Lovegrove weit entfernt. Im Kern folgt sein Roman der klassischen Logik von Superhelden-Comics (und sonst kaum einer); denn das ist es, wo "The Age of Zeus" seine eigentlichen Vorbilder hat. Ähnlich Autoren wie Daryl Gregory oder Perry Moore überträgt Lovegrove einen bekannten Plot in die bildlose Literatur: Superhelden, die Superschurken Superkeilereien liefern ... und dabei ordentlich Kollateralschäden verursachen. Den übernatürlichen Superkräften der Olympier (Blitzeschleudern, Teleportieren, Wasser durch Willenskraft formen usw.) stehen dabei die Batman-mäßig technologisch hergestellten der Titanen gegenüber. Und die haben nicht nur jeder für sich ein persönliches Motiv, das sie zu "Superhelden" werden lässt, sie nehmen auch eine entsprechende Außenidentität an: So werden aus Sam, Rick & Co fortan "Thetys", "Hyperion" und all die anderen. Bei derart grundlegenden Comic-Bezügen wird es auch niemanden wundern, dass der Roman sehr bildreich ausgefallen ist. Ob Zweikämpfe oder kreative Zerstörungsleistungen: "The Age of Zeus" schreit in jedem Kapitel mindestens einmal V!e!r!f!i!l!m!t! m!i!c!h! - Es ist anzunehmen, dass die Passage mit dem göttlichen Angriff auf Mekka dann ausgelassen würde.
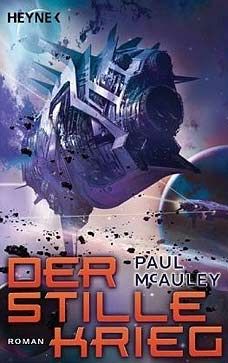
Paul McAuley: "Der stille Krieg"
Broschiert, 490 Seiten, € 10,30, Heyne 2010.
Wieder mal so ein Buch, wo schon nach wenigen Seiten klar ist, dass sich das Lesen lohnen wird - und wo einem auch bald dämmert, dass vermutlich mehr Fragen aufgeworfen werden, als sich in einem einzigen Band klären lassen werden. Paul McAuley ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt, auch wenn er hierzulande vor allem in den 90ern gehandelt wurde und trotz ungebrochener Schreibtätigkeit für ein volles Jahrzehnt vom deutschsprachigen Markt verschwunden ist. Sein 2008 veröffentlichter Hard-SF-Roman "The Quiet War" ist jedoch wieder übersetzt worden - ein willkommenes Comeback.
Alle diejenigen, die schon beim klitzekleinsten Hinweis auf umweltschädliche Folgen ihres alltäglichen Handelns den dämlichen Kampfbegriff "Ökofaschisten" in den Mund nehmen (und noch öfter posten), können sich anhand von McAuleys Großbrasilien anschauen, wie Ökofaschismus wirklich aussehen würde. Die Welt des 23. Jahrhunderts hat nicht nur einige einschneidende Umweltdesaster hinter sich, sondern auch den Umsturz, aus dem drei dominierende Machtblöcke hervorgegangen sind. Über die Europäische Union und die Pazifische Gemeinschaft erfahren wir so gut wie nichts, dafür lernen wir Großbrasilien, das sich unter anderem die ehemaligen USA einverleibt hat, en détail kennen. Zugleich illustriert McAuley die unterschiedlichen Grade, in denen die autoritäre Staatsideologie umgesetzt wird, anhand der aus verschiedenen Schichten stammenden Hauptfiguren. Am untersten Ende der Hierarchie steht der geklonte Dave #8, der in einer Art Shaolin-Kloster mit Big-Brother-artigen Zügen heranwächst und zum Elitekämpfer ausgebildet wird; weniger seine künstliche Erzeugung als seine Umgebung ist es, die ihm die Menschlichkeit nimmt. Eine Stufe höher ist Kampfpilot Cash Baker anzusiedeln, der als herkömmlicher Bürger den staatlichen Hurrapatriotismus vollständig verinnerlicht hat. Als eindimensionalste Figur von allen nimmt er nur wenig Erzählraum ein - der tragisch-sinnlose Höhepunkt seiner Karriere wird allerdings noch für eine ironische Note sorgen.
Den höchsten Rang - im aristokratischen Großbrasilien dennoch nicht mehr als eine gehobene Leibeigenschaft - nimmt Gen-Zauberin Sri Hong-Owen ein. Die begnadete Wissenschafterin muss sich der Familie, der sie dient, zwar fügen, hat aber genügend Spielraum, um auch eigene Pläne zu verfolgen. Allmählich stellt sich dabei heraus, dass die auf den ersten Blick so besonnen wirkende Sri ihre Finger in einer Menge dreckiger Angelegenheiten stecken hat - überdies ist sie extrem ich-bezogen. Bezeichnend die Szene, als sie in einen Schusswechsel gerät und es dem sie begleitenden General übel nimmt, dass seine Anwesenheit das Feuer auch auf sie zieht. - Bleibt schließlich noch die wesentlich sympathischere Macy Minnot, eine Bio-Ingenieurin von geringem Rang, die am Aufbau eines künstlichen Bioms auf dem Jupitermond Kallisto mitarbeitet. In die Beschreibung ihrer Arbeit fließt einiges an Fachwissen ein, das der gelernte Botaniker Paul McAuley aufzuweisen hat (Hard-SF ist der Roman also nicht nur in Bezug auf Technik, Navigation im Leerraum oder Kampfszenen in Neal-Asher-Manier); sehr schön auch die originelle Beschreibung diverser Ökosysteme aus künstlich hergestellten Vakuumorganismen. Allerdings bleibt nicht viel Zeit für beschauliche Pflanzungen - Macy gerät ungewollt in eine Geheimdienst-Aktion und wird sich fortan auf einer Flucht immer weiter hinaus ins Sonnensystem befinden. Sris skrupellosen Egoismus teilt sie nicht; sie will einfach nur in Frieden leben und sich von niemandem und nichts vereinnahmen lassen.
Zugleich vollzieht Macy mit ihrer Flucht den Weg nach, den ein Teil der Menschheit im Zuge des Umsturzes gegangen ist. Die Außenwelten (die Monde der großen Planeten und noch weiter draußen gelegene Kleinkolonien) bilden in der Romangegenwart den ideologischen Gegenpol zum grünen Konservatismus der irdischen Machtblöcke: Ihr Emblem ist die ansteigende Kurve als Symbol für Fortschritt - während sich das Zukunftskonzept der Erde als sich erweiternde Ebene - sprich: Konsolidierung - darstellt. Am besten lassen sich die beiden Systeme aber als unterschiedliche Informationsgesellschaften vergleichen: Die Außenwelten sind ein Sammelsurium verschiedenster Utopien und Philosophien. Individuelle Freiheit, Demokratie und offener Informationszugang stehen hier über allem: Jeder konnte jederzeit alles, was ihm beliebte, zu jedermann sagen. Eine durch die Technologie noch weiter getriebene Fortsetzung unserer Twitter- und Facebook-Kultur, an die sich die autoritär erzogene Macy nur schwer gewöhnen kann und die sie in ebenso ärgerliche wie komische Situationen treibt. - In krassem Gegensatz dazu Großbrasiliens Umgang mit Information. Es ist kein Zufall, dass es in den betreffenden Kapiteln vor geheimen Vorgängen nur so wimmelt: Etwa die Forschungsprojekte, in denen Sri mitmischt. Oder die Todesfälle unter prominenten Friedensbefürwortern; die näheren Umstände werden höchstens angedeutet. Und Dave #8 hat sich längst daran gewöhnt, dass immer wieder ein Klon-Bruder über Nacht verschwindet, ohne dass seine Ausbilder je ein Wort der Erklärung dazu abgeben würden.
Kein Wunder, dass es zwischen zwei so fundamental gegensätzlichen Kulturen zum Konflikt kommen muss - zunächst zu einem "Stillen Krieg" in Form von Spionage, Sabotage, Unterwanderung und paramilitärischen Einsätzen. Dabei fällt positiv auf, dass der Autor in kein Gut-Böse-Schema verfällt. Die Außenwelten mögen den LeserInnen auf Anhieb sympathisch erscheinen, weil sie im wesentlichen unsere Kultur widerspiegeln. Allerdings tun sie dies auch in deren Schattenseiten: Auf dem Jupitermond Europa wurde das einzige jemals gefundene Ökosystem nicht-irdischen Ursprungs nonchalant kontaminiert - und längst wirft man begehrliche Teleskop-Blicke auf einen Exoplaneten, der offenbar einheimisches Leben trägt. Es geht also immer so weiter wie vor dem Öko-Kollaps der Erde. - Großbrasilien indes ist zwar ein für unsere Begriffe unmenschliches System - allerdings ist man hier wenigstens mit größtem Einsatz bemüht den Scherbenhaufen aufzuräumen, den die Prä-Umsturz-Gesellschaft hinterlassen hat. Gut für die Natur, schlecht für die nun von ihr ausgesperrten Menschen, die in Städten zusammengepfercht bleiben - Sri nennt die Städte nicht von ungefähr Pest-Quarantänestationen. Das zeigt zugleich ein grundlegendes Problem im großbrasilianischen Gedankengebäude (wie auch dem von "tiefenökologischen" Bewegungen unserer Welt wie dem Voluntary Human Extinction Movement) auf: Die Trennung des Menschen von der Natur ist in dieser Variante genauso vollständig wie in "Macht euch die Erde untertan"; wirklich ökologisch gedacht ist das nicht. Und führt jemanden wie Sri zu faschistoiden Visionen: Von einem wilden grünen Planeten, auf dem nur zehn Millionen Menschen die Ebenen und Wälder durchstreiften und über die klaren blauen Ozeane segelten. Große, starke, intelligente Menschen ...
Und als wäre das alles noch nicht kompliziert genug, weicht McAuley die Frontlinien auch noch anderweitig auf: Kriegstreiber und aufgehetzte Mobs gibt es auf beiden Seiten, als der Stille Krieg langsam eskaliert - wie zuvor auch aus beiden Lagern versöhnliche Stimmen gekommen sind. Überdies zeichnet sich sowohl auf der Erde als auch im äußeren Sonnensystem ein Generationskonflikt ab. Die Grünen Heiligen, auf die sich die irdische Aristokratie letztlich beruft, gelten nicht mehr als unantastbar. Und die vergleichsweise konservativ eingestellte Gründergeneration der Außenwelten ringt damit, dass ihre Nachkommen immer radikaler denken und den Transhumanismus propagieren. Kurz: Paul McAuley macht hier ein Riesenfass auf. Angesichts einer so vielschichtigen Gemengelage muss so einiges skizzenhaft bleiben, und auch der Romanschluss wird nicht alle befriedigen. Denn wie vermutet kann nicht alles in einem Band zum Abschluss gebracht werden. Auf Englisch ist bereits die Fortsetzung "Gardens of the Sun" erschienen - wenn genug Leute "Der Stille Krieg" kaufen, wird's davon hoffentlich auch eine Übersetzung geben.

Kai Meyer: "Seide und Schwert"
Broschiert, 408 Seiten, € 10,30, Piper 2010.
Einmal ganz allgemein gesprochen: Ein bisschen mehr Fantasie bei Plots und Worldbuilding dürfte es für meinen Geschmack in der Fantasy - und speziell dem eingeengten Spektrum, das auf Deutsch erscheint - ruhig sein. Immerhin gibt es den mit ökologischen Aspekten versehenen "Im Zeichen des Mammuts"-Zyklus von Tobias O. Meißner. Plus jemanden, der sich über die Jahre hinweg als besonders verlässliche Größe erwiesen hat, was unterhaltsame Romane betrifft, die endlich mal nicht einen Mittelerde-Klon als Hintergrund haben: Kai Meyer. Seine "Sturmkönige"-Trilogie wurde hier ja bereits vorgestellt (hier die Nachlese). Dabei war die in mancherlei Hinsicht "nur" die nahöstliche Variation einer früheren fernöstlichen Schöpfung, nämlich der "Wolkenvolk"-Trilogie. Ursprünglich 2006 bis 2007 veröffentlicht, kommt sie nun auch im Paperback-Format heraus und macht einmal mehr Spaß zu lesen.
Zeitlich und räumlich ist die Handlung genau festgemacht - wir befinden uns im kaiserlichen China des Jahres 1760 unserer Zeitrechnung. Die Hauptfigur ist jedoch italienischer Abstammung, und das über ungewöhnliche Umwege: Niccolo Spini gehört zum Volk der Hohen Lüfte, einer Gemeinschaft, die einst den religiösen Zwängen ihrer Heimat entflohen ist und seit über 200 Jahren auf einer mehrere Quadratkilometer großen Wolkeninsel über den Globus schwebt; vom Erdboden aus sieht die Insel wie eine ganz normale Wolke aus. Klar, dass hinter einem solch genialen Mammutwerk nur einer stecken kann: Der große Leonardo da Vinci höchstselbst; längst zur Legende geworden und in Ausrufen wie "[...] sei Dank" an Gottes Stelle getreten. Aetherpumpen halten die Insel zusammen und in der Luft - bis sie mitten über China aus unbekanntem Grund den Geist aufgeben und die Insel zwischen drei Berggipfeln strandet. Der totale Zerfall droht, wenn nicht jemand schnellstens etwas Ersatz-Aether am Erdboden besorgt, womit man die Pumpen wieder anzuwerfen hofft.
Der geeignete Kandidat ist der junge Niccolo. Zum einen hat er seine Nase in allerlei verbotene Bücher gesteckt und dabei auch Chinesisch gelernt (eine zugegebenermaßen ziemlich bemühte Konstruktion), zum anderen träumt er seit langem von Freiheit und ... Bäumen. Letzteres ohne noch zu ahnen, dass sich sein erster Besuch in einem Wald zu einem wahren Horror-Trip auswachsen wird. Aether indes erweist sich als identisch mit einer anderen mythischen Substanz: Drachenatem. Schon bald trifft Niccolo daher auf jemanden, der aus ganz anderen Gründen nach Drachen sucht: Das Waisenmädchen Nugua wurde von Drachen großgezogen und fühlt sich nicht der menschlichen Spezies zugehörig. Umso größer ihre Verstörung darüber, dass ihre Zieheltern sie eines Nachts ohne Vorwarnung verlassen haben. Dem gutwilligen Niccolo wird Nugua mit ihrer pampigen Art anfangs gehörig auf die Nerven gehen, versteckt dahinter aber nur ihre tiefe Verunsicherung darüber ausgesetzt worden zu sein. Wie von Meyer gewohnt handelt es sich um recht modern denkende Charaktere, was sich vor allem in der Art äußert, wie sie miteinander sprechen und zanken. Auch wenn Nugua nicht "modern" genug ist, um den Sinn einer Landkarte zu verstehen - wie soll man wissen, wo man ist, wenn man selbst gar nicht in der Karte verzeichnet ist, und überhaupt sieht da alles viel kleiner aus als in Wirklichkeit ...
Den beiden gesellt sich im Lauf der Zeit eine bunt schillernde Reihe an Weggefährten hinzu: Die resolute Schwertkämpferin Wisperwind, der magische Meister Li und Feiqing, ein liebenswerter armer Tropf, der durch einen Fluch mit seinem albernen Drachenkostüm verwachsen ist, seine Herkunft vergessen hat und hinter ständigem Gejammer bemerkenswerte Bildung verbirgt (apropos "verbirgt": leider wird zumindest in Teil 1 nicht die Frage geklärt, wie Feiqing aufs Klo geht - die hat mich nicht mehr losgelassen). Wir erleben formidable Zweikämpfe übernatürlicher Wesen, die auf Riesenkranichen reiten und einander mit fliegenden Schwertern und tödlichen Seidenwickeln beharken, treffen auf Scharen baumwurzelartiger Walddämonen und staunen über einen Lavastrom, der sich seit undenklicher Zeit durch China wälzt und in dessen glühender Spitze bewohnte Türme schwimmen. Kurz: Meyer lässt es wieder einmal krachen. Die "Wolkenvolk"-Trilogie wartet mit einem ähnlichen Special Effects-Feuerwerk auf wie die "Sturmkönige" und teilt mit diesen auch das Auftreten eines Phänomens, das an der Substanz der Welt an sich nagt.
Wenn Wisperwind senkrecht einen Baum hinaufstürmt, sich mit holzigen Dämonen herumschlägt und federnd über Wasser läuft, erinnert das nicht zu knapp an fernöstliche Leinwand-Spektakel von "A Chinese Ghost Story" bis "Crouching Tiger, Hidden Dragon" - Meyer schürft aber noch tiefer und rührt an alte Mythen, die sich tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben haben. Was einmal das alte Märchenmotiv vom edlen Prinzen und dem Waisenmädchen war, hat sich allerdings gründlich aufgefrischt. Niccolo ist zwar buchstäblich vom Himmel herabgestiegen, stammt aber selbst aus schlichten Verhältnissen. Überhaupt führt das vermeintlich erhabene Volk der Hohen Lüfte ein recht bukolisches Leben mit Ackerbau und Viehzucht in Wolkenmulden, die man mit Erde befüllt hat. Und paradoxerweise ist die Freiheit über den Wolken auch nicht grenzenlos, im Gegenteil: Räumlich beengt und kleingeistig verwaltet, kommt die Wolkeninsel Niccolo zu Recht wie ein Gefängnis vor. - Jede Menge Stoff also für weitere Konflikte und Abenteuer. Teil 2 der Trilogie, "Lanze und Licht", erscheint im Dezember als Paperback. Wer's bis dahin nicht aushält: Die alten Ausgaben sind teilweise noch erhältlich, überdies erscheint - wie merkwürdig - parallel zur Piper-Ausgabe auch eine beim Carlsen-Verlag, der auch Meyers aktuelle "Arkadien"-Reihe herausgibt. Dann mal bloß nicht den Überblick verlieren!
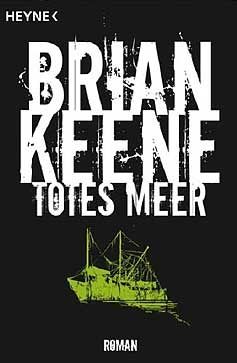
Brian Keene: "Totes Meer"
Broschiert, 383 Seiten, € 9,20, Heyne 2010.
Wer glaubt, über dem deutschsprachigen Markt schlüge gerade eine Welle von Zombie-Romanen zusammen, der braucht bloß mal einen Blick über den großen Teich zu werfen: Alleine beim kleinen Verlag Permuted Press drängeln sich entsprechende Titel sonder Zahl, und das ist bloß ein Haus von vielen - mit Cherie Priests "Boneshaker" haben es die Untoten sogar unter die heurigen Nebula-Nominierungen geschafft. Den Nebula hat Brian Keene zwar noch nicht bekommen, dafür aber gleich zweimal eine gleichermaßen renommierte Auszeichnung in Sachen Horror, den Bram Stoker Award. Unter anderem für den Zombie-Roman "The Rising", der in Kombination mit der Fortsetzung "City of the Dead" unter dem Titel "Das Reich der Siqqusim" bei Otherworld erschienen ist.
"Totes Meer" (im Original: "Dead Sea", 2007) ist eine weitere Beschäftigung mit dem Thema und zugleich eine Kehrtwende hin zur klassischen Auslegung: Hier fetzen nicht die Turbobooster-Untoten von "28 Days Later" oder Zack Snyders "Dawn of the Dead"-Remake durch die Gegend. Und sie zeigen auch keine Anzeichen von Intelligenz oder können gar sprechen und boshafte Pläne aushecken wie in den Siqqusim-Erzählungen. Warum auch: Die totale Entmenschlichung der Infizierten und die Langsamkeit, mit der der Untergangsprozess - nichtsdestotrotz unaufhaltsam - abläuft, sind schließlich zwei wesentliche Komponenten des Grauens, das das Zombie-Thema ausmacht. Einige Ergänzungen hat sich Keene dennoch einfallen lassen: So wird zum Beispiel der Geruch der schlurfenden Toten stärker denn je betont. Der Ekelfaktor ist entsprechend - und steigt mit dem Grad, in dem sich die Untoten in faulige Suppe auf zwei Beinen verwandeln. Außerdem - zugegeben: die Idee hatten auch schon andere Autoren - befällt das Zombie-Virus neben dem Menschen noch andere Spezies: erst eine recht wahllose Zusammenstellung von Säugetierarten, später immer mehr. "Totes Meer" dürfte den ersten Auftritt eines untoten Tigers in der Literatur beinhalten; und damit ist der animalischen Attraktionen noch lange kein Ende.
Die Hauptfigur des Romans, Lamar Reed, lässt sich in drei Wörtern beschreiben: Schwarz, schwul und scheißdrauf. Klischees und Rollenstereotype hat er nämlich satt, und von denen wird er gleich aus mehreren Richtungen eingedeckt. Dass Lamar trotz Ghetto-Herkunft von Gangsta-Attitüden nichts hält, hat ihm bei "seinen Leuten" den Ruf eines Onkel Tom eingebracht: Angepasstes Leben, Fabrikjob und so weiter. Nicht mal HipHop mag er. Die Fabrik ist allerdings vor einiger Zeit ins Billigausland übersiedelt, und zu den Geldbeschaffungsaktionen, zu denen Lamar in der Folge gezwungen war, gehörte auch ein dilettantisch durchgeführter Überfall. Dass er damit genau ins rassistische Bild weißer MitbürgerInnen passt, nagt so sehr an ihm, dass er die Episode noch zu einer Zeit geheim hält, als die Welt längst ganz andere Sorgen hat. Es ist einfach eine Scheißsituation - das erste Kapitel gestaltet sich daher als eine einzige Tirade Lamars gegen alles ... die Zombieseuche inklusive, deren Ausbruch parallel dazu im Schnelldurchlauf erzählt wird: Ein geschickter Schachzug des Autors, denn wirklich neue Wege dies zu schildern sind ohnehin kaum noch denkbar. Hartgesotten die Sprache, hartgesotten die Einstellung - was durchaus seine komischen Seiten hat: Einmal sehnt sich Lamar nostalgisch in die Zeit zurück, als unter seinen Schuhen noch Crack-Ampullen knirschten und nicht die Zähne, die er gerade einem Zombie aus dem Schädel getreten hat.
Lamars Selbstverständnis ändert sich, ohne dass er dies zunächst selbst bemerken würde, ab dem Zeitpunkt, da er die beiden Kinder Tasha und Malik aufgabelt. Sie schaffen es aus dem zerstörten Baltimore mit einem ausgemusterten Kahn der Küstenwache aufs Meer hinaus; mit an Bord ein zusammengewürfeltes Häuflein Überlebender, ganz ähnlich wie in Keenes Weltuntergangsroman "Die Wurmgötter". Darunter ist auch ein alter Professor, der Lamar Begriffe wie Archetyp, Monomythos oder charakterliche Neugeburt auf einer Heldenreise um die Ohren haut - gewissermaßen Keenes Verbeugung vor einem SF- und Horror-Archetyp anderer Art: Dem Gelehrten, der den theoretischen Überbau liefert. Anders als in Geschichten der 1950er Jahre erklärt der aber nicht in haarsträubender Weise das Ding an sich (in dem Fall: die Seuche), sondern theoretisiert die Erzählstruktur. Wissenschaftliche Fundierung ist ohnehin keine möglich; wie gewohnt spricht Keene durch seine Figuren peinliche Fragen aus, die sonst gerne vermieden werden, weil sie die Genre-Logik untergraben. Etwa: Warum greifen Zombies einander nicht gegenseitig an? Und woher kommt ihr Hunger, wenn sie gar keinen Stoffwechsel haben?
Von seiner Heldenrolle will Lamar jedoch nichts wissen. Gemeinsam mit dem Waffenfanatiker und Bibelverkäufer (und trotz beider Gründe sympathischen) Mitch Bollinger grübelt er eher über die Frage nach, was ihn in einer so vollkommen aussichtslosen Lage überhaupt weitermachen lässt. Antworten findet Lamar einige: Der Überlebensinstinkt ist ein Arschloch lautet die wichtigste. Und dass Gott nicht nur tot, sondern ein Zombie sein muss, klingt auch plausibel - immerhin ist sein Sohn von den Toten zurückgekehrt ... vielleicht war er hungrig gewesen. Zeit zum Philosophieren bleibt allerdings nur in den kurzen Verschnaufpausen, ehe die ProtagonistInnen wieder um ihr Leben laufen, hauen und stechen müssen. Und dabei die vielleicht wichtigste Frage ausblenden, die als strategisch geschickt platzierter Kaufanreiz bereits am Buchrücken aufgeworfen wird. Da prangen nämlich "Die drei wichtigsten Überlebensregeln im Falle einer Zombie-Epidemie". Zwei davon erwartbar, die dritte aber: Versuche auf keinen Fall - auf gar keinen Fall! - dich mit einem Schiff aufs offene Meer zu retten ... Hat ja schon im "Dawn of the Dead"-Remake nichts gebracht, und Keene denkt noch einen Schritt weiter. - Dem Zombie-Thema eine grundsätzlich neue Dimension hinzuzufügen schafft freilich auch ein so kluger Autor wie Brian Keene nicht. Für kühlende Gänsehaut beim Lesen am Strand sorgt der Roman aber allemal.
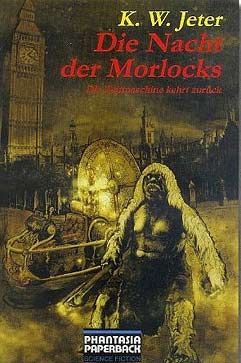
K. W. Jeter: "Die Nacht der Morlocks"
Broschiert, 200 Seiten, € 15,40, Edition Phantasia 2010.
Kevin Wayne Jeter feiert heuer seinen 60. Geburtstag - zu diesem Anlass hat die Edition Phantasia seinen 1979 veröffentlichten Roman "Morlock Night" neu herausgegeben; meines Wissens erscheint er damit zum ersten Mal auf Deutsch. Außer Beiträgen sowohl zum "Star Wars"- als auch "Star Trek"-Universum hat der kalifornische Autor Romane im Großraum Horror / Steampunk / Science Fiction veröffentlicht - "Die Nacht der Morlocks", eine Fortsetzung von H. G. Wells' Klassiker "The Time Machine", vereint alle drei Elemente in sich. Abgesehen von diesem Sequel hat Jeter übrigens auch Fortsetzungen zu "Blade Runner" - sowohl dem Film als auch Philip K. Dicks Romanvorlage - geschrieben. Philip José Farmer musste sich für derlei Werktätigkeit einst den Ruf des literarischen Parasitentums gefallen lassen ...
Protagonist des Romans ist Edwin Hocker, einer aus dem Zuhörerkreis von Wells' Original-Zeitreisendem, den Jeter der Anonymität entreißt und ihn als bornierten Bildungsbürger des viktorianischen London zeichnet - was eine vielversprechende charakterliche Ausgangslage ist, wenn man an die Herausforderungen denkt, die sich Hocker bald stellen werden. Politische Konzepte, die vom hehren britischen Imperialismus abweichen, sind bestenfalls Wirrköpfigkeit und schlimmstenfalls verdammungswürdige Schurkerei - und natürlich hält Hocker den Reisebericht des Zeitreisenden für Schwachsinn. Als er von der abendlichen Runde im Haus des Zeitreisenden heimgeht, ahnt er noch nicht, dass ihn jeder weitere Schritt unwiederbringlich von der sorgsam gehegten Selbstgefälligkeit forttragen wird. Erst hat er ein ungemütliches Gespräch mit einem weiteren Besucher der Abendrunde, der sich als "Dr. Ambrose" vorstellt und sich schon bald als - wahrhaftig - Merlin der Magier entpuppen wird. Und als sich Londons Nebel endlich lichtet, steht er anstatt in seiner vertrauten Umgebung plötzlich in einer postapokalyptischen Ruinenlandschaft: Einschlagskrater, lodernde Feuer und geschlachtete Menschen, wohin man auch sieht - die aus der Zukunft angereisten Morlocks sind dabei die Welt zu erobern. Hocker reagiert trotz der schockierenden Szenerie, die Anleihen bei Wells' "War of the Worlds" nimmt, standesgemäß, als ihm die Kugeln um die Ohren pfeifen: "Wissen Sie, dass Sie auf einen Bürger Großbritanniens schießen?"
Jeter ist, wie schon erwähnt, ein amerikanischer Autor. Er macht sich einen Spaß daraus, Hockers gönnerhaften Patriotismus - der schwärmt von den geliebten christlichen und menschlichen Idealen, die in England mehr denn in jedem anderen Land verkörpert sind - bis zur höchsten Lächerlichkeit zu karikieren. Und setzt handlungsmäßig noch eins drauf, denn wo ein Merlin ist, kann Artus nicht weit sein. Der Legende nach schläft der Tafelrundenkönig ja irgendwo unter der Erde, um in der Stunde der Not in sein bedrängtes England zurückzukehren. Der Artus, den man Hocker dann präsentiert, ist jedoch ein gebrechlicher Greis. Und das angesichts solcher Herausforderungen: Die Morlocks haben beinahe schon die ganze Welt verwüstet, die Erde ist angesichts des erhöhten Zeitreiseverkehrs dabei in ein zeitloses Nirgendwann zu stürzen, im Hintergrund tobt der Zweikampf zwischen Merlin und dessen ewigem Widersacher Merdenne - und zu allem Überfluss gibt es da auch noch die Hosen tragende und mit Waffen herumballernde Tafe, die so gar nicht Hockers Vorstellungen von einem Fräulein entspricht. "Amazone", klar.
Das Bemühen, die Morlock-Invasion abzuwehren und die zeitliche Kontinuität wiederherzustellen, führt zu einer Schnitzeljagd mit absurden Zügen, ins Hochgebirge, in die Zukunft und in die Londoner Kanalisation, wo - Jules Verne lässt grüßen - ein Morlock-U-Boot herumschippert. Schließlich ist der nasse Unterbauch der Hauptstadt Teil eines kontinentüberspannenden Netzes von Unterwasserwegen, das einst die alten Atlanter angelegt haben. Jeter befasst sich aber nicht nur in ironischer Weise mit abenteuerlichen historischen Hypothesen, wie sie im 19. Jahrhundert modisch waren, er holt auch gute Pointen raus: Im Untergrund existiert nämlich eine Kolonie von Menschen, die von all dem Zeug leben, das die Stadtleute oben in der Kanalisation verlieren - einer ist jedoch schon vor Jahren aus der Kolonie ausgewandert, um sein Glück in der Kanalisation einer anderen Stadt zu machen. Der Satz des Monats!
Es liegt nicht nur an den unweigerlichen Folgen von Zeitparadoxa, dass die Handlung immer wieder knirscht wie gigantische schlecht geölte Steampunk-Zahnräder. Haarsträubende Querverbindungen, Logik-Fehler und blinde Motive gibt es zuhauf - dennoch liest sich das Ganze durchaus vergnüglich. "Die Nacht der Morlocks" ist eine augenzwinkernde Abenteuergeschichte mit starkem Pulp-Einschlag. Was Wells davon gehalten hätte, werden wir leider nie erfahren.

Stephen Baxter: "Zeitschiffe"
Broschiert, 731 Seiten, € 10,30, Heyne 2002.
An dieser Stelle hat es sich einfach angeboten, eine alternative Fortsetzung der "Time Machine" einzubauen, auch wenn es sich um einen etwas älteren Titel handelt. Vor gar nicht so langer Zeit hab ich sogar noch ein Exemplar von Stephen Baxters "Zeitschiffe" in einer Buchhandlung herumstehen sehen - und die anderen Kaufkanäle, die's für "Antiquarisches" so gibt, sind ja allgemein bekannt. Romane und Erzählungen, die den Wells-Klassiker weiterspinnen, gibt es reichlich, dies hier ist aber etwas Besonderes. Und nicht nur weil es sich um die offiziell abgesegnete Fortsetzung handelt, die 1995 zum 100-jährigen Jubiläum des Originals erschien. Man hat gut daran getan, den Zauberer der Hard-SF als Autor zu wählen. Die "Zeitschiffe" ("The Time Ships") bietet ebenso spannendes wie locker zu lesendes Vergnügen, trotz oder vielleicht auch weil es auf eine Unzahl wissenschaftlicher Theorien Bezug nimmt. Als deren wichtigste die Viele-Welten-Interpretation, die hier dazu führt, dass eine Zeitreise nicht einfach in eine zukünftige oder vergangene Welt führt, sondern dass sie rein durch den Akt ihrer Durchführung neue Welten erschafft. Ich konnte dem Einfluß der Zeitmaschine nicht entrinnen: nun, da sie einmal erfunden war, schien es, als ob ihre Auswirkungen sich in der Vergangenheit und Zukunft verzweigten, wie Wellen, die ein Stein erzeugt, der in den gemächlich dahinfließenden Strom der Zeit geworfen wurde, stöhnt der Zeitreisende einmal. Und hat zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal annähernd begriffen, wie grundlegend und unumkehrbar seine punktuelle Erfindung das Multiversum tatsächlich verändert hat.
Anders als Jeter wählte Baxter den Original-Zeitreisenden als Hauptfigur - und Ich-Erzähler, was praktischerweise ermöglicht ihn weiterhin namenlos zu belassen. Am Ende der "Time Machine" verschwindet der Zeitreisende bekanntlich auf Nimmerwiedersehen. Baxter greift ein loses Ende auf und lässt seinen Protagonisten erneut in jene Zukunft aufbrechen, in der er das Eloi-Mädchen Weena beim Kampf gegen die Morlocks im Stich lassen musste. Nun will er sie retten; aber schon unterwegs merkt er, dass sich die Zukunft nicht so entwickelt wie auf seinem ersten Trip. Er unterbricht seine Reise 150.000 Jahre vor Weenas Zeitebene und findet die Erde als dunklen, verlassenen Ort vor - denn die Weltbevölkerung lebt seit langem auf einer um die Sonne gebauten Dysonsphäre mit dem Ausmaß von 300 Millionen Erdoberflächen. Erneut ist sie zweigeteilt, die ethischen Aspekte sehen aber gänzlich anders aus. Die am dunklen Außenrand der Sphäre lebenden Morlocks haben ein monochromes Utopia errichtet: Totaler Rationalismus und ein friedliches Nebeneinander verschiedener Gesellschaftssysteme bilden die Rahmenbedingungen einer hochtechnologischen Morlock-Zivilisation, deren einziges Ziel die Mehrung des Wissens ist. Diejenigen Menschen hingegen, die ihr genetisches Erbe bewahrt haben und auf der lichten Innenseite der Sphäre leben (auf sie wird nur kurz eingegangen), sind in eine endlose Folge von Kriegen verstrickt. Wie es immer war und wohl auch immer sein wird, solange sie sich der Evolution zu etwas Höherem verweigern.
Fällt das Wort Utopia, sollte man sich sofort nach einem ortskundigen Fremdenführer umsehen. Den erhält der Zeitreisende in Form eines Morlocks, der vom Charakter her einem gewissen Mr Spock nicht unähnlich ist und den unwahrscheinlichen Namen Nebogipfel trägt (so heißt er auch im englischsprachigen Original; der Name stammt ursprünglich aus einer älteren Kurzgeschichte von H. G. Wells). Nebogipfel begleitet den Zeitreisenden auch auf dem Weg zurück in die Vergangenheit; die beiden werden fortan ein dynamisches Gespann bilden, das trefflich philosophieren und streiten kann, während Baxter die Möglichkeiten des Zeitreise-Themas in allen Facetten auslotet. Die Begegnung mit dem eigenen Ich in jüngerer Gestalt und eine Reise ins ferne Paläozän - also die Ära nach dem Aussterben der Dinosaurier und noch bevor sich die Säugetiere zur späteren Artenvielfalt aufgeschwungen hatten - wird ebenso vorkommen wie Kolonialkriege, die vom Raum in die Zeit verlagert wurden, oder ein Jahr 1938, in dem der Erste Weltkrieg immer noch nicht zu Ende gegangen ist. In dieser Ära macht der viktorianisch geprägte Zeitreisende übrigens Erfahrungen mit gezwungenermaßen martialisch gewordenen Frauen, die denen von Jeters Edwin Hocker durchaus ähneln. Baxter baut hier eine ganze Reihe Verweise an weniger bekannte Werke von Wells ein. Und so ganz nebenbei korrigiert er in eleganter Weise auch noch Fehler, die Wells aufgrund des Wissensstandes seiner Ära in der "Time Machine" begangen hatte - etwa was die Lebensdauer der Sonne betrifft. Baxter tut dies, ohne Wells lächerlich zu machen, sondern indem er die Diskrepanz aus seiner eigenen Romanhandlung heraus plausibel erklärt - eine Meisterleistung.
Während sich das Panorama in seiner ganzen Vielfalt entfaltet, machen sowohl der Romanprotagonist als auch sein Publikum einen anhaltenden Lernprozess durch. Wir LeserInnen werden in unterhaltsamer Weise ins Werk Kurt Gödels und theoretische Konzepte wie die quantenmechanische Multiplizität eingeführt. Und der Zeitreisende darf sich Stück für Stück den Kopf von überholten Vorstellungen wie Geschlechterstereotypen oder der Auffassung, ein Krieg hätte auch seine guten Seiten, freispülen lassen. Mehr als einmal ist es Nebogipfel, der ihm die erforderliche Kopfwäsche verpasst. Einmal - noch ein geschickt platziertes Eingehen auf Kritik an der Original-"Time Machine" bzw. deren ideologischen Aspekten - würgt er ihm auch die unbequeme Wahrheit rein, dass seine dämonisierte Sicht der Morlocks auf nicht viel mehr als Standesdünkeln und kreatürlicher Angst vor der Dunkelheit beruht.
In jüngster Vergangenheit hatte Stephen Baxter die Welt in "Die letzte Flut" buchstäblich untergehen lassen; zuletzt eröffnete er mit "Stone Spring" einen in der Steinzeit spielenden Zyklus, in dem die BewohnerInnen der Region, die wir heute als Ärmelkanal kennen, durch den Bau eines riesigen Walls die hereinflutende Nordsee aufhalten und damit der Geschichte einen völlig anderen Verlauf geben. Für jeden anderen Autor wären das monumentale Ideen - nach Baxter-Verhältnissen kann man fast schon von Kleine-Brötchen-Backen sprechen. Immerhin führte er uns in seinem "Xeelee"-Zyklus sowohl an den Anfang als auch ans Ende der Raum-Zeit. "Zeitschiffe", das im selben Zeitraum entstanden ist, tut dies ebenfalls (etwa wenn die meilenlangen Titelobjekte zum Urknall reisen), geht aber noch weit darüber hinaus. Hier wie dort steht die menschliche Evolution und die Frage ihres langfristigen Überlebens im Vordergrund. Wir treffen auf eine Maschinen-Zivilisation, die eine gigantische Noosphäre gebildet hat, und finden uns in einer Zukunft wieder, in der die Milchstraße dunkel und leer erscheint, weil alle Sterne von Dysonsphären verhüllt wurden. Und wir gelangen in ein Universum, in dem das Olberssche Paradoxon gegenstandslos ist: Hier leuchtet der Nachthimmel weiß, denn dieses Universum ist wirklich unendlich - und egal auf welchen Punkt man den Blick richtet, überall sendet ein Stern sein Licht aus. Und selbst das kann nicht genug sein: Es geht um nicht weniger als die Kolonisierung der Unendlichkeit ... das ist sogar für Baxtersche Verhältnisse atemberaubend.
Im Vergleich zu "Nacht der Morlocks" ist dies natürlich die bedeutend ergiebigere Variante einer Fortsetzung - um nicht zu sagen: Science Fiction at its best. Doch beide Romane haben ihre Qualitäten - und eine weitere Gemeinsamkeit: Sie stellen nicht nur das abstrakte Prinzip der Zeitreise in den Vordergrund, sondern sehr wohl auch das konkrete Ding, das von Wells inspiriert erst Rod Taylor und später Guy Pearce in exzentrischer Optik in die Zukunft beförderte. Am besten beschrieben in "The Big Bang Theory": "This looks like something Elton John would be driving through the Everglades."
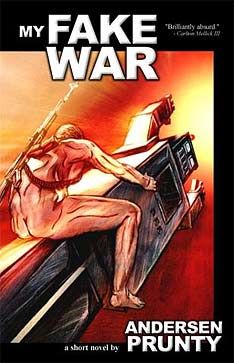
Andersen Prunty: "My Fake War"
Broschiert, 128 Seiten, Eraserhead/Swallowdown Press 2010.
Stell dir vor, du gehst hin und es ist kein Krieg - das fasst in etwa die Situation zusammen, in der sich der Ich-Erzähler von "My Fake War" bald wiederfinden wird: Saul Dressing, ein 43-jähriger Bürger der United States of Everything, fett, faul und glatzköpfig - der prototypische Antiheld. Freiheit definiert er als praktische Umsetzung seiner Erkenntnis, dass er sich für seinen Job als Bibliotheksangestellter (und mangels PartnerIn) doch eigentlich die Zehennägel gar nicht zu schneiden bräuchte. Als eines Tages der Rekrutierungsbeamte Baxter Baxter an Sauls Tür hämmert, muss der sich beim Anblick von Sauls Füßen erst mal kräftig übergeben ... und verpasst ihm später eine ungefragte Pediküre. Eine letzte Serviceleistung, denn sonst hat Baxter nur schlechte Nachrichten im Gepäck: Saul soll als Soldat in das unbekannte Land Grisnos geschickt werden, wo die USE irgendwie involviert sind. In was genau, scheint niemand zu wissen. Am allerwenigsten Saul.
Bizarro-Autor Andersen Prunty, der gerne bemitleidenswerte Individuen mit undurchschaubaren Mechanismen der Macht konfrontiert, hat sich in seiner jüngsten Novelle der Absurdität des Krieges gewidmet. "My Fake War" stellt sich damit - zumindest solange alles noch einigermaßen "normal" abläuft - in die Tradition von Satiren wie Joseph Hellers "Catch-22" oder auch Woody Allens "Die letzte Nacht des Boris Gruschenko". Auf dem Helikopterflug nach Grisnos erhält Saul seine ersten Instruktionen, so spärlich und widersprüchlich sie auch sein mögen: Er soll den EinwohnerInnen von Grisnos im Alleingang den Krieg erklären. Beziehungsweise sie zum Angriff provozieren und ihnen dann den Krieg erklären. Beziehungsweise sie zur Aufgabe ihres Landes überreden, damit die USE mit dem "Nation Building" beginnen können. Sauls Funk-Kommunikation mit wechselnden Vorgesetzten ist an Absurdität kaum zu überbieten: "Earlier surveillance has revealed the country's population to be between fifty and a thousand. They are all dangerous", lautet der Kern des Briefings. Und als Saul mit dem Fallschirm über der Wüste von Grisnos abgeworfen wird und kurz darauf den Hubschrauber in einem Feuerball aufgehen sieht, versichert ihm eine neue Stimme aus dem Headset: "It's all part of the mission."
Von herkömmlichen Kriegssatiren beginnt sich "My Fake War" an dem Punkt zu lösen, an dem Saul die Möglichkeiten seines HighTech-Gewehrs erkundet. Von der "Braut des Soldaten" keine Rede mehr, dieses Teil bringt gleich die ganze Verwandtschaft mit: Es spendet Essen, Wasser und Sonnencreme - je nachdem, auf welches der vielen kleinen orangen Knöpfchen man drückt - und baut ein Zelt auf; sogar eine Bidet-Funktion ist enthalten. Und dass wir uns im Bizarro-Genre befinden, macht spätestens die erste Begegnung mit einem Einwohner von Grisnos deutlich. Der hat zwar eine Haut wie eine Echse, trägt aber den beruhigend unexotischen Namen Bob Weathers und hegt keinerlei kriegerische Absichten (was bei Saul im Hinblick auf die Erfüllung seines Auftrags gemischte Gefühle und bei seinem immer noch zugeschalteten Vorgesetzten äußerste Frustration auslöst). Überdies wohnt Bob mit seiner unsichtbaren, aber reizenden Familie in einem imaginären Haus, das das Elisabethanische Theater an Abstraktion noch übertrifft. Statt realer Objekte liegen hier nur kleine Schilder mit Aufschriften wie "Fenster" oder "Tür" im Sand - für Bob immerhin real genug, dass er in Sitzhöhe über einem "Stuhl"-Schild schweben kann. Ein Umstand, der nebenbei bemerkt noch von Bedeutung sein wird.
An einer Stelle philosophieren Bob und Saul anhand eines fiktiven Buchs über Climax and Anti-Climax und die strukturellen Anforderungen von Erzählungen. "My Fake War" selbst ist dreigeteilt. Der anfängliche, noch in den USE angesiedelte, Teil nimmt die Verhältnisse in einem Land aufs Korn, das wegen seiner horrenden Kriegs- und Kontrollkosten die Infrastruktur verkommen ließ. Einerseits originell dargestellt (in der Leihbücherei stehen noch ganze 17 Titel, vor der Tür lauern homeless doctors ...), andererseits aber auch vergleichsweise platt. Schwer zu sagen, ob das noch Kriegskritik oder schon Kriegskritikverarsche ist. Nach den surrealen Highlights von Teil 2 (Grisnos) geht es abschließend wieder in die USE zurück, und auch die Aussage konkretisiert sich wieder. Rache für die Entrechteten, Tragik und auch ein Hoffnungsschimmer fließen zu etwas zusammen, das ein klarer Aufruf zum Widerstand gegen Machtapparate, die auf die Rechte des Einzelnen pfeifen, ist. Es wird sogar explizit auf die Macht des Wortes hingewiesen - wer hätte gedacht, dass Bizarro in geradezu rührend idealistischer Weise staatsbürgerliche Tugenden beschwören kann. Platz für Dinge wie einen Rundflug auf einem verschimmelten Roboter oder den Zweikampf mit einem nackten Regierungsbeamten, dem noch das Klopapier aus dem Arsch baumelt, bleibt trotzdem. Wie's mit Climax and Anti-Climax in "My Fake War" aussieht, dürfen die LeserInnen dann selbst entscheiden.

Jeff Somers: "Der elektronische Mönch"
Broschiert, 416 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2010.
Ja, von wegen ich lese schnell. Kaum komme ich dazu, das erste der Jeff-Somers-Bücher, die jetzt der Reihe nach bei Bastei herauskommen, zu rezensieren, da ist auch schon das nächste auf dem Markt. Schiebe ich dann nächsten Monat nach. Doch noch. Denn das Lesen von "Der elektronische Mönch" (im Original "The Electric Church" betitelt und nicht zu verwechseln mit Douglas Adams' "Der elektrische Mönch") war eine Achterbahnfahrt. Beginnend mit "gute Idee", übergehend in "ui, nicht so gut umgesetzt", mündend in "aber irgendwie hat's was". Was gleichzeitig die Endbilanz ist und Appetit auf das kommende "Die digitale Seuche" geweckt hat. Langweilig wird "Der elektronische Mönch", zweiter Roman des Autors und erster aus seiner "Avery Cates"-Reihe, nämlich nie.
Die Welt von Übermorgen ist vereint und lässt alle manuellen Arbeiten von Droiden verrichten - klingt paradiesisch, ist in Wahrheit verheerend. Die mittlerweile 22 Jahre zurückliegende Vereinigung ist alles andere als konfliktlos vonstatten gegangen. Von zahlreichen Städten sind nur ausgebombte Ruinenlandschaften übrig geblieben, verwahrlost und zugleich übervölkert. Denn nur eine verschwindend kleine Minderheit von Superreichen lebt im technischen Utopia - die Masse der Bevölkerung nimmt von diesen nicht mehr wahr als die Kondensstreifen ihrer Gleiter, die sich über den Himmel ziehen. Anders als Autoren mit vergleichbar dystopischen Nahzukunft-Szenarien wie Richard Morgan oder William Gibson blendet Somers die privilegierte Klasse komplett aus (hat was von "E.T.", wo man die Köpfe der Erwachsenen auch nie zu sehen bekommt). Und dank der Droiden (die übrigens ebenfalls nicht ins Bild kommen) lebt die gesamte Normalbevölkerung nicht im Freizeit-Paradies, sondern schlicht und einfach in Arbeitslosigkeit. Total verelendet hausen sie in baufälligen Ruinen oder gleich auf der Straße, halten sich mit diversen Gaunereien kurzfristig über Wasser und werden von einem brutalen Polizeiapparat in Schach gehalten. Es ist eine grimmige und grindige Welt - gesunde Zähne sind hier ein klares Zeichen gehobenen Alters; ein selten gewordenes Überbleibsel aus der Welt vor der Vereinigung.
Avery Cates lebt seit 27 Jahren im versifften Ghetto Manhattan. Für ein Milieu, in dem wenige die 40 erreichen, fühlt er sich damit fast schon zu alt, und erst recht für seinen Job als Auftragskiller. Seit er bei einem Job versehentlich eine Polizistin getötet hat, befindet er sich auf der Flucht vor dem Sicherheitsapparat. Umso willkommener daher ein Angebot, das ihm ausgerechnet von höchster polizeilicher Stelle gemacht wird: Im Gegenzug für die Löschung seiner Akten und einen fetten Batzen Geld soll Avery den Propheten einer - staatlich bedauerlicherweise anerkannten - Sekte töten, gegen die sich Scientology wie ein buddhistisches Nonnenkloster ausnimmt. Die Cyberkirche verheißt Erlösung, höhere Erkenntnis und ewiges Leben durch Verpflanzung des Gehirns in einen Körper aus Kunststoff und Metall. Mit den Cyborg-Mönchen - schwarze Kutte, weißes Latexgesicht und dunkle Sonnenbrille - bringt Somers ein Horror-Element in die Handlung ein. Unheimlich sind aber nicht nur die auf allen Straßen predigenden Mönche an sich; schlimmer noch ist, dass Personen, auf die sie besonders eifrig einpredigen und die sie geradezu verfolgen, in aller Regel kurz darauf selbst als Mönche auftauchen. Der Einheitsrat, der sich sonst einen Dreck um die Vorgänge auf der Straße schert, bekommt langsam Angst vor einer globalen Unterwanderung.
Trotz aller auf der Straße erworbenen Erfahrung kann Avery die Mission natürlich nicht alleine ausführen. Auf Einführung eines Love Interests verzichtet Somers, stattdessen sammelt er ein skurriles Trüppchen um seinen Protagonisten an. Dazu gehören unter anderem ein Revolvermann, der sich als der legendäre Widerstandskämpfer Canny Orel ausgibt, die beiden resoluten Omas Milton & Tanner und jemand, der noch am ehesten dem entsprechen würde, was Avery als Freund bezeichnen könnte: Kev Gatz, ein Psioniker, der wie ein wandelnde Leiche aussieht und der Menschen geistig beeinflussen kann. Und so richtig normal wirken auch die beiden Polizisten nicht, mit denen es das Außenseiter-Team im Verlauf des Einsatzes wiederholt zu tun bekommt - der eine war schon wahnsinnig, bevor er zum Mönch konvertiert wurde, der andere unterstützt Averys Team zwar, sorgt mit seinen seltsam insektenhaften Bewegungen und der Gabe immer da aufzutauchen, wo man ihn am wenigsten erwartet, seinerseits für Beunruhigung. Zu nicht geringen Anteilen kaschiert Somers mit derart pittoresker Oberflächengestaltung auch, dass die meisten Figuren charakterliche Leerstellen bleiben.
Probleme hat der Roman immer wieder, wo es um die Konsistenz geht - sprachlich und darüberhinaus. Avery ist ein Killer, aber auch ein Ehrenmann und sogar - wie sich mit der Zeit herausstellt - ein waschechter Idealist; so ganz passt das nicht zusammen. Die Sprache spiegelt dies wider: "Der elektronische Mönch" ist durchwegs dreckig erzählt, und auf den ersten Blick scheint Avery den Tonfall eines abgebrühten Noir-Detektivs zu pflegen. Bei näherer Betrachtung erweist er sich aber als ziemliches Plappermaul. Immer wieder und wieder spult er seine Lebensweisheiten - vor allem über die hirnlosen "Bullen" der niederen Ränge und deren vorgesetzte Officers, denen man besser aus dem Weg geht - ab, als wollte er sich sein persönliches Straßenmantra einpauken. Klingt eher nach einem Jugendlichen als einem, der die Street Credibility mit dem Löffel gefressen hat. Ist Sprache wirklich hartgesotten, wenn das Wort "hartgesotten" immer wieder explizit ausgesprochen wird? Des öfteren verweist Avery darauf, dass jeder im Ghetto ständig bemüht ist, einen selbstsicheren Eindruck zu machen, vom richtigen Gang bis zu genetischen "Aufwertungen" (die die Muskeln anschwellen und die Lebenserwartung schrumpfen lassen). Die Harter-Bursche-Nummer nennt er das; nicht ganz zu klären ist, ob die nun Avery abzieht oder der Autor. Ein paar sehr anachronistisch wirkende Ausdrücke in der Übersetzung - Jungspunde, Blondchen oder Ganovenehre - tragen auch nicht gerade zu sprachlicher Glaubwürdigkeit bei.
Nichtsdestotrotz ist der Roman ohne Frage durchgängig unterhaltsam und enthält einige wirklich gute Ideen (plus offene Fragen und noch auszuführende Details, was den Weltentwurf anbelangt) - genug jedenfalls, um auch dem Sequel "Die digitale Seuche" mit Spannung entgegen zu sehen.

Pierre Bordage: "Die Sternenzitadelle"
Broschiert, 667 Seiten, € 16,50, Heyne 2010.
Wie gut, dass ich nicht nur viele Bücher lese, sondern einen Teil davon auch rezensiere. Nachdem sich die deutschsprachige Veröffentlichung des Abschlussbands von Pierre Bordages "Krieger der Stille"-Trilogie doch deutlich hinausgezögert hat, musste ich erst mal meinen alten Text (hier die Nachlese) hervorkramen, um wieder Anschluss zu finden. Immerhin geht der Autor derart verschwenderisch mit Personal und Schauplätzen um, dass sich "Vom Winde verweht" daneben wie eine billig abgekurbelte Telenovela ausnimmt. Wer jemals den naiven Versuch gestartet hat, mal eben die Wookieepedia anzuklicken, um sich schnell auf den aktuellsten Stand zu bringen, wie's nach der Filmtrilogie mit der "Star Wars"-Historie weitergegangen ist (wie viele Republiken, Bürgerkriege und Sith-Herrschaften hat's da eigentlich inzwischen gegeben?!?), der ist auch für Bordage gerüstet. Siehe etwa all die Ausschnitte aus fiktiven Sagen, historischen Berichten und Kommentaren, die stets den Kapiteln vorangestellt sind und die Romanhandlung aus noch ferneren Zukünften spiegeln. Hier wird ein Mythos aus dem Boden gestampft - vergleichbar mit dem Tempo, in dem einer der Romanprotagonisten, Mahdi Shari, innerhalb von nur zehn Jahren zur Legende auf zahlreichen Planeten geworden ist. Bordages Romane durchweht der Atem der Geschichte - vergleichbar mit dem "Herrn der Ringe"; bloß dass es hierzu noch kein ergänzendes "Silmarillion" gibt, das eine klare (Zeit-)Linie reinbringt.
"Die Sternenzitadelle" (im Original "La citadelle Hyponéros"; 1995) führt Mahdi Shari, Jek At-Skin, Tixu Oty, Aphykit, Oniki Kay und all die anderen Hauptcharaktere aus "Die Krieger der Stille" und "Terra Mater" noch einmal als Auserwählte für den gemeinsamen Kampf gegen das Böse zusammen - einige neue stoßen erst jetzt hinzu, um das biblische Dutzend vollzumachen. Etwa Ghë, Nachfahrin von atomar verseuchten Menschen, die vor 10.000 Jahren die Erde mit einer Exilflotte verlassen haben und nun nach Terra Mater heimkehren. Oder Whu Phan-Li, der vielleicht letzte Ritter der Absolution. Die Auslöschung seines Ordens hat er wegen eines amourösen Abenteuers verpasst; und die letzten 20 Jahre verbrachte er ausgerechnet damit, für einen Kinderhändlerring zu arbeiten. Das soll einer Läuterung und Aufnahme in den Zwölfer-Kreis der Krieger der Stille aber nicht entgegen stehen - niemand demonstriert dies deutlicher als Fracist Bogh, der als aktuelles Oberhaupt der Kirche des Kreuzes Massenhinrichtungen und Genozide mitzuverantworten hat. Vom Saulus zum Paulus gewandelt muss er nun gegen ebendiese Kirche antreten, die das wichtigste Instrument des eigentlichen Feindes darstellt, der In-Creatur. Diese hat viele Gesichter: Ein Wissenschafter sieht in ihr "nur" das große Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße, das Millionen von Sternen verschluckt, die Krieger der Stille hingegen kennen sie als die Antithese des Lebens - das personifizierte Nichts, das alles Leben auszulöschen trachtet. Die kleine Kriegerin Yelle nennt sie schlicht den Blouf.
"Die Sternenzitadelle" trägt sehr stark ausgeprägte metaphysische und esoterische Züge. Und grundsätzlich sei an dieser Stelle festgehalten, dass es sich bei Bordages Romanen um Weltraum-Fantasy handelt, nicht um Science Fiction. Astronomische und biologische Aspekte bleiben vage (und die Übersetzung bringt mit wackeligen Wortstellungen gelegentlich ein zusätzliches Unsicherheitselement ein) - extra humorvoll daher das Staunen eines Wissenschafters, als Tixu Oty auf dessen luftarmem Schrottplanet materialisiert und seine Atmung sofort den örtlichen Gegebenheiten anpasst. Das bereitet dem Experten "wissenschaftliche Schwierigkeiten" - er selbst brauchte immerhin Jahrzehnte, um zu einem fellbedeckten Wesen mit extrastarker Lunge zu "mutieren". Die körperlichen und geistigen Fähigkeiten, die den Kriegern der Stille durch die innere Macht des Antra (der "Klang des Lebens") verliehen werden, sind pure Magie. Selbst "Star Wars"-Fans alter Schule, denen die Entmystifizierung der Macht durch poplige Midichlorianer immer noch schwer im Magen liegt, werden über die Möglichkeiten des Antra, wie zum Beispiel interstellare Reisen ohne Raumschiff, Bauklötze staunen. Aber das ist nur die Oberfläche, das magische Denken geht - beabsichtigtermaßen - bis hinunter zum Fundament. So wenden die künstlich erzeugten humanoiden Scaythen - vermeintliche Vollstreckungsgehilfen der Kirche, in Wahrheit Werkzeuge der In-Creatur - systematisch die Methode der Gedächtnislöschung an, um Menschen sukzessive ihrer Kreativität zu berauben und sie auf ihre Funktionalität zu reduzieren. Diese mentale Auslöschung wird explizit gleichgesetzt mit dem kosmischen Kahlfraß durch den Blouf. Das ist eine der Astrologie ähnliche Verknüpfung von Makro- und Mikrokosmos - "Das Universum ist nichts anderes als eine Projektion kleiner Universen", sagt Mahdi Shari an einer Stelle - oder kurz gesagt eben: Magie.
Der Feind ist recht klar definiert: Alles was den Menschen von sich selbst entfremdet, insbesondere (religiöse) Hierarchien. Speziell die katholische Kirche - kaum verschlüsselt als Kirche des Kreuzes - bekommt hier massiv ihr Fett weg. Von Dogmatismus über Frauenfeindlichkeit und Machtgier bis zu Ketzerverbrennungen und Pädophilie lässt Bordage wirklich nichts aus. Der Autor zeigt eine klare Linie, wenn er die Herkunft seiner Hauptfiguren beschreibt: Die zwölf Auserwählten stammen zwar aus extrem unterschiedlichen Milieus, allen ist aber die Angewohnheit gegen Regeln zu verstoßen oder zumindest ein gewisser Freiheitsdrang zu eigen. Und die jeweiligen Gesellschaftssysteme eint der Umstand, dass ihre ursprünglich sinnvoll gewesenen Regeln zu einem rigiden System der Unterdrückung verkommen sind. Und so nebenbei ermöglichen sie dem Autor natürlich auch opulente Beschreibungen exotischer Welten: Etwa die von verschiedenfarbigen Sonnen bestrahlte Zentralwelt Bella Syracusa, die mit unglaublicher natürlicher Schönheit prunkt (und dennoch von Machtintrigen vergiftet ist). Oder das Ökosystem des Planeten Ephren, dessen Festlandmassen von einem gigantischen Korallenschild bedeckt sind, der laufend von einem Frauenorden gereinigt wird, um Licht und Luft bis zur Oberfläche dringen zu lassen. Oder Ghës durch die Milchstraße vagabundierende Flotte, in der drakonische Strafen gegen Sauerstoffverschwendung gelten und daher nur langsame Körperbewegungen erlaubt sind. Auch das ist die "Krieger der Stille"-Trilogie schließlich: ein buntes, pralles Abenteuer. Eines mit brutalen Zügen überdies - selbst wenn schon alles gut zu werden verspricht, ist jederzeit noch ein Blutbad möglich.
So faszinierend Bordages Saga auch ist, sie hat auch ihre Schwachpunkte. Die Auserwählten (von wem wurden sie eigentlich auserwählt?) berufen sich nicht nur in Bezug auf ihre Mission, sondern auch in der Durchführung jeder Handlung auf etwas, das nicht greifbar und daher auch nicht hinterfragbar ist. Unter dem Dach der Indda bzw. Inddikischen Wissenschaft, zu der nur kreative "Ur-Menschen" Zugang haben, versammelt sich ein metaphysisches Konglomerat aus Rousseau'schem "Zurück zur Natur", Pantheismus, Tao und weiß der Religionswissenschafter was noch. Garniert mit etwas Anthropischem Prinzip aus der Quantenphysik, siehe Sharis Satz: "Alles Existierende auf dieser Welt muss durch einen Zeugen bekundet werden, um seine Existenz zu bestätigen. Das Beobachtete existiert nicht ohne seinen Beobachter." In dieser esoterischen Melange schwimmen dann auch Bestandteile, die auf eher verquaste Gedankengänge hindeuten: Auffällig oft geht beispielsweise die Erleuchtung eines Protagonisten mit Sex Hand in Hand. Ziemlich hippiesk, das - und wenn Bordages Trilogie schon mit "Dune" verglichen worden ist, dann sollte aber auch auf "Yellow Submarine" nicht vergessen werden. Der Kampf der BewohnerInnen von Pepperland gegen die Blue Meanies (bzw. Blaumiesen) ist ganz derselbe wie der von Bordages kreativen Ur-Menschen gegen die Mächte der Uniformität und Unterdrückung. Selbst die zentrale Aussage der "Krieger der Stille"-Trilogie kann man sich von den Beatles entleihen: All you need is love.

Terry Pratchett: "Der ganze Wahnsinn"
Broschiert, 352 Seiten, € 10,30, Piper 2010.
Schreibt der Mann doch glatt, dass ihm Kurzgeschichten nicht liegen würden - um dann gleich den Gegenbeweis anzutreten: Mehrfach geglückt, ein paar Mal weniger prickelnd (offenbar aber eher vom Thema als von der Länge abhängig), streckenweise brillant. Die Sammlung "Der ganze Wahnsinn" gibt Einblicke in Terry Pratchetts Leben, enthalten sind neben Kurzgeschichten auch Zeitschriften-Beiträge, Reden und Kommentare und dergleichen mehr - allesamt launig formuliert wie gewohnt. Siehe etwa "Keine Sorge", ein herrlicher Reisebericht von einer Lesetour durch Viericks alias Australien, auf der der prominenteste Hutträger der gegenwärtigen Literatur unter anderem eine Autogrammstunde auf einem Sarg geben und eine Sensenklinge signieren durfte. Die Textsammlung ist 2007 als Hardcover erschienen - wer die jetzt nachgereichte günstigere Paperback-Variante kauft, bekommt die ganze sorgfältige Aufbereitung mit Bibliografie und einleitenden Kommentaren, allerdings mit einer Ausnahme: Die teils zweiseitigen Scheibenwelt-Illustrationen Josh Kirbys waren nur in der gebundenen Ausgabe enthalten; gegen ein bisschen Mehrwert für den höheren Preis ist schließlich auch nichts einzuwenden.
Kernstück des Buchs ist die 60-seitige Novelle "Das Meer und kleine Fische" mit den Golden Girls der Scheibenwelt: Esme Wetterwachs und Gytha Ogg. In Lancre steht der traditionelle Hexenwettbewerb an und die Organisatorin begeht den strategischen Fehler, Dauersiegerin Oma Wetterwachs von der Teilnahme abhalten zu wollen. Und viel schlimmer noch: Sie lässt die Bemerkung fallen, Oma könnte ruhig ein wenig netter sein. Also ist die plötzlich nett - und löst mit derart ungewohntem Verhalten in ganz Lancre eine Welle der Panik aus (man stelle sich vor: Esme Wetterwachs in Rosarot, brrr ....). Tod hat in mehreren Episoden Kurzauftritte und in "Troll dich" treffen wir einen weiteren alten Bekannten wieder: Cohen der Barbar hat hier eine tragikomische Begegnung mit einem der letzten Brückentrolle. Die Rollen scheinen klar verteilt und beide versuchen die hehre Zweikampf-Tradition aufrechtzuerhalten ... aber so richtig wie in alten Zeiten will's ihnen nicht mehr von der Hand gehen, seit sich die Zivilisation auszubreiten beginnt - ein immer wiederkehrendes Motiv in den Scheibenwelt-Romanen. Und in "Eine akademische Austreibung teuflischer Apparate" diskutiert das Kollegium der Unsichtbaren Universität über den Vorschlag eine Art Evaluierung einzuführen - Gelegenheit für Pratchett, satirische Attacken auf publish or perish und andere Phänomene der Forschungsgegenwart zu reiten.
... und dann wäre da noch "Die Hymne von Ankh-Morpork", die Pratchett sogar vertonen ließ - inklusive der Passagen, die nur "aus verlegenem Gebrumm" bestehen. Was auf die Beobachtung zurückgeht, dass die meisten Menschen in etwa die erste Strophe ihrer Nationalhymne kennen, sich dann eine Zeitlang mit mhm mhm mhm behelfen müssen, um dann in den Abschlusszeilen wieder mit besonderer Lautstärke einzusteigen. Ein Paradebeispiel dafür, wie Pratchett - der schließlich mal Journalist war - in seine Scheibenwelt-Erzählungen immer wieder Alltagsbeobachtungen einfließen lässt, die sonst höchstens in irgendeiner Zeitungskolumne landen würden und bald wieder vergessen wären; hier erhalten sie einen Platz, der die Tagesaktualität überdauert. Schließlich lautet Pratchetts Devise in Sachen Scheibenwelt und Fantasy generell: Sie ist eine Möglichkeit, das Hier und Heute zu sehen, nicht das Dort und Damals.
Interessant ist vor diesem Hintergrund natürlich auch, wie Pratchett zur Fantasy-Literatur steht. Das Wort "Eskapismus" ist für ihn per se noch kein Vorwurf: Es kommt darauf an, wovor man flieht und wohin. Die abgedruckte Rede "Lass Drachen sein" ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die Phantastik, durchaus in Konfrontation mit der selbstgefälligen Mainstream-Belletristik: Ich befinde mich lieber in der Gesellschaft von Menschen, die zum Mars blicken, als in der von Personen, die den Nabel der Menschheit betrachten - andere Welten sind besser als Fussel. Den Satz möchte man sich aufs Kopfkissen sticken - genauso wie die später im Buch folgende Tirade "Elfen waren Mistkerle" ein geeigneter Arschtritt für Fantasy-AutorInnen, die mit unoriginellen Werken den Markt überschwemmen, wäre: Die Elfen - auf der Scheibenwelt kommen sie bekanntlich nie gut weg - dienen hier aber nur als Aufhänger für einen Rundumschlag Pratchetts gegen Kitsch, Schund, Epigonentum, pseudoarchaische Sprache und nicht hinterfragte Rollenstereotype in der Fantasy.
Enthalten sind auch einige Kurzgeschichten, die abseits der Scheibenwelt angesiedelt sind; nicht immer bewegt sich Pratchett dabei auf sicherem Gelände. "Cybertrip" beispielsweise ist eine recht altbackene Cyberpunk-Geschichte. Kurz und rührend dafür "Die Weihnachtsfestplatte", in der sich ein vereinsamter Firmencomputer etwas vom Weihnachtsmann wünscht. "Hollywood-Hühner" basiert lose auf einer wahren Begebenheit; nämlich der, dass in Los Angeles einst eine Transportladung Hühner von einem Lastwagen entkam und fortan - gefangen zwischen zwei unüberquerbaren Highway-Spuren - eine kleine Kolonie aufbaute. Bei Pratchett entwickelt sich daraus sogar eine eigenständige Zivilisation mit fortschreitender Flucht-Technologie. Bemerkenswert wegen ihres Entstehungsdatums ist die Erzählung "Die Hades-Angelegenheit"; geschrieben, als der kleine Terry 13 war! Im einleitenden Kommentar schämt er sich dafür auch recht kokett - da hab ich aber von wesentlich älteren AutorInnen schon deutlich Schlechteres gelesen ... Und in "Letzter Lohn" kehrt Pratchett auch schon wieder zu seinem eigentlichen Genre zurück: Die Geschichte dreht sich um den Fantasy-Autor Kevin, der seine Erfolgsserie über Erdan den Barbaren auslaufen lassen will ... als der solcherart "Verstorbene" plötzlich vor Kevins Tür erscheint und in der Wohnung seines Schöpfers sein persönliches Walhall zu finden glaubt.
Gelegentlich packen mich Bedenken der Art: Soll ich schon wieder einen Pratchett in die Liste aufnehmen? Beim Lesen lösen sich die aber stets auf - der Mann haut einfach Texte zum Niederknien raus; das zeigen auch Formate wie dieses, die für SammlerInnen sowieso interessant sind, anderen aber eher nur die Zeit bis zum Erscheinen des nächsten Romans (vorzugsweise aus der Scheibenwelt) überbrücken helfen. Im September ist es übrigens soweit: Dann erscheint unter dem Titel "Der Club der unsichtbaren Gelehrten" endlich die deutsche Ausgabe von "Unseen Academicals" - auf der Scheibenwelt bricht das Fußballfieber aus!
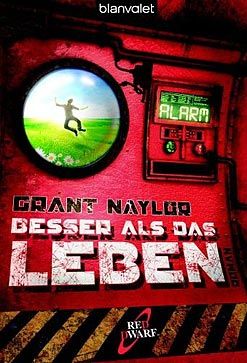
Grant Naylor: "Besser als das Leben"
Broschiert, 316 Seiten, € 8,20, Blanvalet 2010.
Wir bleiben auf der humorigen Seite: Drei Millionen Jahre in der Zukunft und fernab der (vermutlich längst menschenleeren) Erde zieht das riesige Raumschiff "Roter Zwerg" durchs All. Davon kriegen seine vier Insassen aber schon länger nichts mehr mit: Dave Lister, der wahrscheinlich letzte lebende Mensch, sein nur noch als Hologramm existierender Vorgesetzter Arnold J. Rimmer, der Putzroboter Kryten und schließlich Kater, der zu einer humanoiden Intelligenz evolvierte Nachfahre einer Katze, die Dave einst an Bord schmuggelte. Alle vier sind vom eintönigen Bord-Alltag in die Weiten des Computerspiels "Besser als das Leben" geflüchtet, das für sie die Erfüllung sämtlicher Wünsche simuliert. Dummerweise ist BADL allerdings so avanciert, dass es auch auf unbewusste Regungen eingeht - und auf der Ebene hat Rimmer tief verinnerlicht, dass er ein jämmerlicher Versager ist, dem jede Demütigung zu Recht widerfährt. So ist er in BADL zwar ein Frauenschwarm und zeitreisender Superstar, der mit Elvis und Julius Cäsar Saufgelage veranstaltet ... muss aber auch hinnehmen, dass seine Errungenschaften immer wieder zunichtegemacht werden.
Lister indessen suhlt sich in einem ewig weihnachtlichen Bedford Falls - jenem fiktiven Städtchen, das Schauplatz des Hollywood-Tränendrüsendrückerklassikers "Ist das Leben nicht schön?" war: Gute Menschen, wohin man auch spucken kann - und dazu eine eigene Familie; in der Realität mangels Menschheit ein unerfüllbarer Wunsch. Dass das Kitsch-Panorama bald in einem flammenden Inferno aufgeht, wirft ein interessantes Licht darauf, welche unterbewussten Regungen Lister wohl so hegen könnte - allerdings geht die Zerstörungsorgie im wesentlichen auf Rimmers Einwirkung zurück. Auf die Visionen der übrigen zwei Hauptfiguren wird nur kurz eingegangen, da diese auch die deutlich eindimensionaleren Charaktere sind: Kryten darf einen ständig nachwachsenden Berg Teller abwaschen, der hypereitle Kater vergnügt sich mit Sex und Grausamkeiten gegen kleine Pelztiere. - Von allen vieren unbemerkt bahnt sich indessen draußen in der Realität Ungemach an: Schiffscomputer Holly, längst senil geworden, sehnt sich nach Gesellschaft, findet sie in einem Billigtoaster mit Sprachmodul und nimmt von diesem einen fatalen Ratschlag an, wie er seine alte Speicherkapazität wiedererlangen kann.
Wie schon im Vorgängerband "Roter Zwerg" (hier die Nachlese) hat das Autorenduo Rob Grant und Doug Naylor (alias "Grant Naylor") den Inhalt mehrerer Folgen der BBC-Sitcom "Red Dwarf" in die Form eines Episodenromans umgegossen. Weitere Handlungen werden sich um die drohende Kollision mit einem Planeten, den Sturz in ein Schwarzes Loch und die davon ausgelösten Zeitverzerrungseffekte, einen Gestaltwandler sowie ein sehr, sehr unerwartetes Wiedersehen mit [... das wäre gespoilert] drehen. "Red Dwarf"-Freaks werden sicher rasch die Unterschiede zwischen TV-Serie und Roman feststellen (ich hätte zu gern gesehen, wie Katers Mäusepolo auf Reitbrontosauriern umgesetzt wurde - und erst recht Rimmers Gefangenschaft als Schallwelle in einer Isolationszelle, was in einen originellen Gefängnisausbruch mündet). Überdies ist für das ExpertInnenpublikum das Drehbuch der ersten "Red Dwarf"-Folge beigefügt, das sich vom betreffenden Roman ebenfalls unterscheidet.
Für den Rest der LeserInnen ist eher von Belang, dass Grant & Naylor nach wie vor die Kunst der Übertreibung beherrschen und in ihren besten Momenten in Pratchett-Manier Phänomene unserer Alltagswelt in ihre fiktive einfließen lassen: Sehr schön etwa die Passage darüber, nach welchem System Menschen für Hochzeitsfotos gruppiert werden. Dass die Romane an eine Sitcom gebunden sind, hat aber natürlich auch seine Nachteile. Spätestens in diesem zweiten Band sind die Figuren an ihr zentrales Charaktermerkmal - der Versager, der Eitle, der mit Schuldkomplexen beladene Beflissene und der Normalo, dem das Leben übel mitgespielt hat - gebunden und dürfen sich auch nicht mehr verändern, da der größte Teil der Situationskomik auf ihrem Zusammenspiel beruht. Insofern kann "Besser als das Leben" nichts Neues mehr liefern - außer eben neue Pointen. Im Herbst erscheint der dritte Band ("Volle Kraft zurück!"; diesmal von Grant alleine geschrieben) - einige zentrale Fragen des Lebens werden aber bereits in "Besser als das Leben" beantwortet. Zum Beispiel warum Hunde ständig an ihren Hoden lecken oder was der Song Contest mit der Entscheidung zu tun hatte, welcher Planet des Sonnensystems zur Müllhalde für die anderen degradiert werden soll. Und nicht zu vergessen wie Salzburg zum Ausgangspunkt einer weltweiten Rebellion werden konnte.
Sodala, meine Damen und Herren: Dies war die letzte Rundschau in derStandard.at/Kultur. Fürderhin wird die Rubrik über mein heimatliches Wissenschaftsressort - genauer gesagt die dortige "Gutenberg-Galaxis" - laufen, was mir aus mindestens vier arbeitsorganisatorischen Gründen leichter fällt. Ansonsten wird sich rein gar nichts ändern - Sie müssen sich nur an die neue blitzblaue Hintergrundfarbe gewöhnen und künftig ein Stückchen weiter nach unten scrollen. (Was Sie hoffentlich auch tun werden.) Ein paar alte Bekannte werden Ihnen die Umgewöhnung erleichtern, Genaueres weiß ich noch nicht - bei mir biegen sich gerade wieder die Regale durch ... (Josefson)