
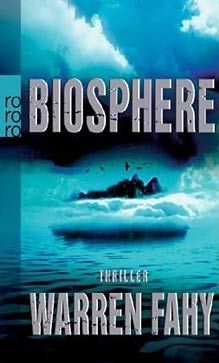
Warren Fahy: "Biosphere"
Broschiert, 495 Seiten, € 10,30, rororo 2010.
Als Autor ist der Kalifonier Warren Fahy bislang ein unbeschriebenes Blatt gewesen; vorgesetzt man rechnet Werbetexte und Filmrezensionen nicht mit ein. Dafür entwirft er gleichsam rückwirkend die Urknall-Version des Szenarios von der abgelegenen Insel mit einer Fauna und Flora, die längst ausgestorben sein sollten. "King Kong" und "Die vergessene Welt" (Arthur Conan Doyle, nicht Michael Crichton) kleben im Vergleich dazu an der Gegenwart, denn Fahys Insel ist das letzte Überbleibsel eines uralten Superkontinents, neben dem sich Pangäa wie das reinste Neubaugebiet ausnimmt. "Fragment" daher der Originaltitel des 2009 erschienenen Romans, der auf "Deutsch" zu "Biosphere" wurde. Was aber nur die erste von vielen, vielen Mutationen ist, die uns - vor allem aber den Romanfiguren - mit Karacho ins Gesicht springen werden.
Vor dem Lesen könnte es sich anbieten einen Gurt anzulegen - Tempo ist angesagt. Das gilt für den aberwitzigen Lebenszyklus der Inseltiere - eine Wissenschafterin fasst den Takt von Fressen, Vermehren und Gefressenwerden einmal als Krieg im Kreißsaal zusammen - und ebenso für die panische (und meist vergebliche) Flucht der armen WissenschafterInnen, die auf der Insel gelandet sind. Genau genommen beginnt es aber schon früher, nämlich bei der Vorstellung der ProtagonistInnen. Im Schnelltakt werden die TeilnehmerInnen der Doku-Soap SeaLife nach folgendem Schema vorgestellt: Körper - Augen - Haare - Bekleidung ... plus ein paar Anmerkungen zum Charakter. Das könnte die Oberflächlichkeit einer auf Generierung von TV-Bildern bedachten "Forschungsexpedition" illustrieren ... oder es ist die seltsame Idee eines Autors, der seinen ersten Roman schreibt und so etwas für notwendig hält. Auf jeden Fall hat es den gleichen Effekt wie eine Cocktail-Party, auf der einem in kurzer Zeit viel zu viele Namen und Gesichter vorgestellt werden, die man sich ohnehin nicht merken kann.
Anders als auf den meisten Parties entsorgt hier aber schon nach kürzester Zeit ein erstes Gemetzel die meisten Figuren - am besten nicht verwirren lassen und gleich auf die Botanikerin Nell Duckworth und den Meeresbiologen Andrew Beasley konzentrieren. Dazu kommen noch zwei, die erst später die Insel betreten werden: Der buchstäblich über Kinderleichen gehende Bestseller-Autor Thatcher Redmond, eine geltungssüchtige Medien-Nutte der Wissenschaft - und sein genaues Gegenteil Geoffrey Binswanger, der zwar auch das Zeug zum Medienstar hätte, auf Popularität aber pfeift.
Da die blutigen Bilder vom ersten Landgang live in alle Welt übertragen werden, zieht sich bald eine Seeblockade der Navy um die Insel zusammen. Schon im ersten Drittel tritt der Roman also in die Phase ein, die keine der im Vormonat vorgestellten Erzählungen der "Monstrous"-Anthologie errreichte: Die militärischen Bemühungen um Aufklärung und schließlich Abwehr einer biologischen Gefahr, eigentlich ein klassischer Bestandteil von Monstergeschichten. Zur Sorge besteht auch aller Grund: Bald zeigen die wissenschaftlichen Analysen, dass jede einzelne der wehrhaften Insel-Spezies das Potenzial hätte, die restliche Biosphäre vollständig zu vernichten, sollte sie erst einmal auf einen der Kontinente eingeschleppt werden. Was gleichzeitig der eigentliche - und gewollte - Gag des Romans ist: In der realen Welt fallen Insel-Biotope mit deprimierender Schnelligkeit der Verbreitung vom Menschen eingeschleppter Spezies zum Opfer - Fahy dachte sich, er dreht den Spieß mal um.
Und Fahy hat seine mörderische Brut nicht nur im Wort beschrieben. Der Roman enthält auch einige Illustrationen von Hendersratten, Spigern und Tellerameisen, da lacht das Herz! Vor allem letztere sind vom biologischen Konzept her so bestechend, dass man sich fragt, warum die Natur noch nicht selbst auf den Gedanken gekommen ist. Überdies sind es keine willkürlich zusammengewürfelten Spezies mit möglichst spektakulären Kräften, Fahy hat sich bemüht, eine in sich stimmige alternative Evolutionlinie zu entwerfen. Als Ausgangspunkt wählte er dafür Fangschreckenkrebse, eine Tiergruppe, die den LSD-Träumen von Pulp-Coverzeichnern entsprungen zu sein scheint. (Web-Tipp: Eine Image-Search zum Stichwort "mantis shrimp").
Vorwarnung: Im letzten Drittel gehen Fahy die Gäule durch. Zuvor hielten sich haarsträubende Einfälle und ein erkennbares Gespür für wissenschaftliche Themen (und wie man sie schildert) noch die Waage. Doch die Plot-Wendung, die dann kommt, ist einfach albern - da muss man schon die Humor-Brille aufsetzen, um sich den Roman nicht zu verderben. - Eine unbestreitbare schreiberische Leistung ist es hingegen, wenn ein Autor es schafft, Sympathien oder Antipathien zu wecken, die der eigenen sorgsam gehegten Weltanschauung zuwiderlaufen. Irgendwann zwischen der Szene, in der ein kamerabestückter Mungo von den Inseltieren zerfetzt wird, und dem x-ten Massaker an hilflosen WissenschafterInnen habe ich mich - erklärter Tierschutz-Verfechter, der ich bin - bei dem ungewohnten Gedanken ertappt, dass die ganze ökologisch wertvolle Insel mitsamt ihren widerlichen Mistviechern hoffentlich bald ein schönes langes Vollbad in Napalm nimmt.

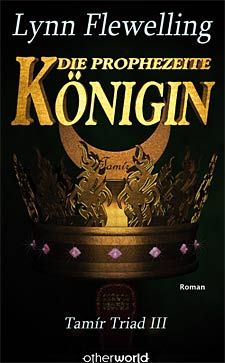
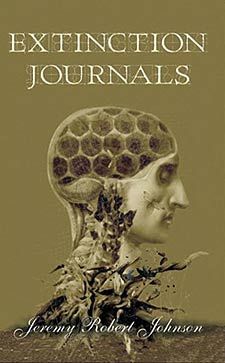
Jeremy Robert Johnson: "Extinction Journals"
Broschiert, 104 Seiten, Eraserhead/Swallowdown Press 2006.
Heißt es nicht immer, dass Kakerlaken die einzigen sind, die einen Atomkrieg sicher überleben werden? Slum-Kid Dean hatte daher die folgerichtige Idee, als die TV-Nachrichten die Phrase vom bevorstehenden Nuklearschlag nicht mehr länger mit einem "vielleicht" versahen: Er hat sich eine ganze Legion der kleinen Krabbler - lebendig und mit den Füßchen voran - an seinen Spezialanzug genäht, einen Sauerstofftank umgeschnallt und ist ins Freie gestakst. Und er hat überlebt - wie's aussieht als Einziger.
Jeremy Robert Johnson, Bizarro-Schreiber aus Portland, Oregon, und Kumpel von "Fightclub"-Autor Chuck Palahniuk, scheint ein ausgesprochenes Faible für nukleare Apokalypsen zu hegen: Nachzulesen in seiner Geschichtensammlung "Angel Dust Apocalypse" aus dem Jahr 2005. Darunter befindet sich auch eine sieben Seiten kurze Erzählung mit dem Titel "The Sharp Dressed Man At the End of the Line", kompakt und in rhythmischer Sprache, sodass man streckenweise fast von einem Gedicht sprechen könnte (man hört beim Lesen förmlich, wie großartig sich der Text für einen Vortrag eignen würde - Bizarro-Lesungen haben stets Event-Charakter). Am Ende dieser Geschichte trifft Dean auf seinen sehr an George W. Bush erinnernden verhassten Präsidenten, der den Krieg ausgelöst hat und nun weinerlich nach Vergebung sucht. Dean gewährt ihm die ersehnte Umarmung. Natürlich in seinem Anzug. Die Kakerlaken legen los. - Und darum beginnt "Extinction Journals", das unmittelbar an diese Episode anschließt und in herkömmlicher Prosa geschrieben ist, mit dem Satz: The cockroaches took several hours to eat the President.
Ich werfe nicht so gerne mit großen Wörtern wie "Existenzialismus" herum - aber finde mal jemand eine andere Bezeichnung für das Szenario, wenn Dean einsam unter einem dunklen Himmel durch Asche und brennende Ruinen stapft, angetrieben von the Fear (mit großem F), die nicht näher benannt zu werden braucht. Er ist sich gar nicht mal so sicher, dass er den Atomkrieg überhaupt überlebt hat - sein vorerst bester Gegenbeweis, dass er nicht im Fegefeuer gelandet ist, bleibt, dass er immer noch den Drang zum Pinkeln verspürt. Als ein engelhaftes Wesen in brennendem Streitwagen vom Himmel schwebt, bietet es Dean weder große Eröffnungen noch Erlösung an, sondern fragt ihn nur verwirrt: "Where did everybody go?" Dann labert es noch einige Zeit über die menschliche DNA und die Irrtümer der Weltreligionen, aber Dean verliert schnell das Interesse. Ihm reicht es zu wissen, dass er am Leben ist - und für eine wachsende Zahl von Baby-Kakerlaken, mit denen er in eine empathische Kommunikation eintritt, die Mutterrolle übernommen hat. Sein Motto ist einfach: DO NOT DIE.
You'll laugh, you'll cry, you'll lose your lunch heißt es in einer Lobpreisung auf Johnsons Werke überaus passend. Ekelszenen gehen Hand in Hand mit komischen Momenten, und der Autor lässt es sich auch nicht nehmen, als Extra-Draufgabe die allerabgegriffensten Klischees eines Boy-meets-Girl-Szenarios mitzuverwursten: Er fühlt sich als "Lone Wolf", sie träumt von "white picket fences" ... kitschiger geht's nimmer, und das alles inmitten fresswütiger Insektenkolonien. Geigen und Gore.

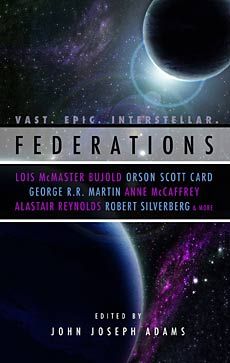

Dirk van den Boom: "Tentakelsturm"
Broschiert, 193 Seiten, € 13,30, Atlantis 2009.
Eine Sternenföderation hätt' ich noch - womit ich gleichzeitig das Ende einer Trilogie nachtrage, die 2007 begann. Irdische Sphäre nennt sich Dirk van den Booms Variante des Motivs - und seit dem ersten Band ist diese Sphäre eingeschrumpelt wie ein Ballon, dem man die Luft ausgelassen hat. Gerade mal das innere Planetensystem hält die Menschheit noch, der Rest ist dem Ansturm der Tentakel geschimpften pflanzlichen Aliens zum Opfer gefallen. Im letzten Akt des Dramas verlagern sich die Kampfhandlungen nun auf Mutter Erde selbst.
Eine Sternschnuppe zog eine leuchtende Bahn über den Nachthimmel. So lautet der erste Satz des Abschlussbands - und Schöngeister sollten ihn an dieser Stelle vielleicht gleich wieder zuschlagen. Denn man kann es sich an den Tentakeln abzählen: So beschaulich wird's auf den kommenden Seiten nimmer wieder. Kurz zur Erklärung für diejenigen, die die beiden ersten Bände nicht gelesen haben (hier der Rückblick): Die Aliens sind nicht zur Unterwerfung der Menschheit angereist, sie verwenden sie als Dünger. (Angehende) Leichen tragen die Sporen aus, aus denen die Krieger der Tentakel schlüpfen - Angehörige höhergestellter Kasten pflanzt man als Setzlinge ins lebende Gehirn: Blumentöpfe nennen die Menschen die Unglücklichen, die ihre paar restlichen Tage ohne Schädeldecke fristen müssen. - Soviel also zum Thema Beschaulichkeit ... lange hat sie ohnedies nicht angehalten: Schon ein paar Sätze weiter erweist sich obige Sternschnuppe als abgeschossenes Tentakel-Schiff. Wenigstens der Wunsch ist den Erdstreitkräften erfüllt worden.
An verschiedenen Fronten der letzten großen Abwehrschlacht sind noch einmal die Hauptfiguren der beiden bisherigen Bände im Einsatz. Capitaine Jonathan Haark muss den von Feindschiffen umwimmelten Jupiter erreichen, um Dr. DeBurenberg, das leicht derangierte Genie, in einer Forschungsstation abzusetzen - die Hoffnung auf eine "Wunderwaffe" lebt noch. Und Ex-Soldatin Rahel Tooma, einst aus persönlichen Gründen aus dem Militärdienst ausgeschieden, dann aber zur Retterin tausender Flüchtlinge avanciert und postwendend wieder einberufen, erhält ein neues Kommando nahe dem Hauptquartier der Erdstreitkräfte in der Sahara. Erst einmal hat sie aber mit den Folgeerscheinungen des massiven Pharmazeutika-Gebrauchs zu kämpfen, mit dem sie sich durch die zurückliegenden Schlachten gepusht hat. - Als neue Hauptfigur, gleichsam stellvertretend für die gesamte kämpfende Erdbevölkerung, kommt Leon Shiver hinzu, ein unauffälliger, schmerbäuchiger Kaufhaus-Sicherheitsmann irgendwo in Europa. Nicht mehr allzuweit von der Rente entfernt, wird er nun ebenfalls unter Waffen gestellt - so wie praktisch alle, die noch irgendeine Gliedmaße bewegen können. Irgendwie berührend die Szene, in der Leon von seiner Frau ein letztes Stück Tiefkühllasagne angeboten bekommt, während beide mit Helm und Schusswaffen in der Küche stehen und am Fenster mitansehen, wie ein Tentakel-Raumschiff auf ihre Heimatstadt stürzt. Ein letzter Hauch von normalem Eheleben ... dann ziehen beide in den Häuserkampf.
Es ist ein dreckiger Krieg, und van den Boom erzählt ihn lapidar und kompromisslos - das gilt auch für die klare Abgrenzung gegenüber dem Feind. Anders als in Teil 2 kommen diesmal die Aliens nicht mehr zu Wort (so ganz überzeugend war das ohnehin nicht) und präsentieren sich statt dessen als anonymer Angreifer, der hauptsächlich auf Masse und sein biologisches Waffenarsenal setzt. Nicht zu knapp erinnern die Tentakel in ihren verschiedenen Erscheinungsformen an die Bugs aus "Starship Troopers".
Im Abwehrkampf feuern nicht nur die Romanfiguren, sondern auch der Autor buchstäblich aus allen Rohren - Wörter wie Dodge Annihilator Megatruck grenzen fast schon an Poesie. Was van den Booms Variante von Military Science Fiction von beispielsweise der eines David Weber unterscheidet, ist aber etwas anderes: Hurrapatriotismus ist hier nicht angesagt. Stattdessen zieht sich ein tiefer Bruch zwischen der Bevölkerung und den Instanzen, die sie nominell beschützen. Und das gilt - keine Selbstverständlichkeit im Genre - sowohl für die Politik als auch das Militär. Rahel und Jonathan haben beide ihre Erfahrungen mit Machtmissbrauch in der Armee gemacht - ihr daraus resultierendes Misstrauen haben sie für immer verinnerlicht und nur für den Überlebenskampf vorübergehend zur Seite geschoben. Und auch die Verzweiflungsmaßnahme des Erddirektorats, die gesamte Bevölkerung unter Waffen zu stellen, führt nicht automatisch zum allgemeinen "Schulterschluss" (ein Top-Anwärter für das scheußlichste Wort aller Zeiten), sondern zum Zusammenbruch der zivilen Ordnung. Nicht grundlos machen sich die ProtagonistInnen Gedanken, was aus der Erde werden wird ... im unwahrscheinlichen Falle, dass sie die Invasion übersteht. - Fazit: Bester Band und somit gelungener Abschluss der "Tentakelkrieg"-Trilogie.
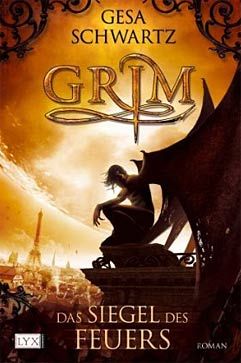
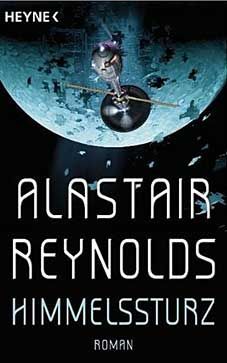
Alastair Reynolds: "Himmelssturz"
Broschiert, 784 Seiten, € 10,30, Heyne 2010.
Das nenne ich buchhandlungstauglich: Eine gute und großdimenionierte Plot-Idee (hier: ein ganzer Mond geht stiften), die im Klappentext angerissen werden kann, und dazu ein Eröffnungssatz, bei dem man unwillkürlich grinsen muss: Ihr Name war Chromis Anemone Laubenvogel, und sie hatte einen weiten Weg zurückgelegt, um ihr Anliegen vorzutragen. - Damit bin ich schon gewonnen; ähnlich wie durch eine gute erste Einstellung eines Films. Wie sich zeigen wird, ist Frau Laubenvogel - nicht die Hauptfigur des Romans - auf recht originelle Weise temporal nicht so leicht ver-"ort"-bar. Im Prolog lernen wir sie jedenfalls als Provinzpolitikerin eines in der ferneren Zukunft liegenden mittelgroßen Sternenreichs kennen, das sein 10.000-Jahresjubiläum feiern will. Sollte man zu diesem Anlass eine Dysonsphäre bauen oder doch lieber einen Springbrunnen? Auf jeden Fall legt die Laubenvogel Wert darauf, die mythische Wohltäterin der Vergangenheit zu ehren ...
... und damit springt der Roman auf die eigentliche Handlungsebene um. Wir schreiben das Jahr 2057 und mit seiner 145 Mann (und Frau) starken Besatzung ist das Raumschiff "Rockhopper" der Vereinten Wirtschaftseinheiten im Sonnensystem unterwegs, um Kometen zusammeln und zwecks Rohstoffgewinnung in Erdnähe zu befördern. "Wir schieben Eis" lautet das Credo der Besatzung - "Pushing Ice" ist auch der Originaltitel des Romans, der 2007 ins Deutsche übersetzt wurde und nun auch als Taschenbuch veröffentlicht wurde. Noch ahnt niemand, dass sich diese lakonische Selbstmotivation zu einem interstellaren "Tschaka!" auswachsen wird, das die Äonen überdauert. - Aber ich will nicht vorgreifen: Für die Crew der "Rockhopper" gehen die Wochen der Routinearbeit schlagartig zu Ende, als sich der Mond Janus erst aus seinem Orbit um den Saturn und dann aus der Eklitik des Sonnensystems löst, um auf den 260 Lichtjahre entfernten Stern Spica Kurs zu nehmen. Nur die "Rockhopper" fliegt auf einem Kurs, der sie dem Mond - offenbar in Wahrheit ein 190 Kilometer großes Raumschiff unbekannter Herkunft - eine Zeitlang folgen lassen kann, um Daten zur Erde zu senden. Nicht alle Eisschieber sind mit dieser neuen Mission einverstanden: Aus der bordinternen Abstimmung entspringt eine Konfliktlinie, die die gesamte weitere Handlung prägen wird.
Der Besuch beim außerirdischen Riesending ist ein Arthur C. Clarke-Topos, dass es klassischer nicht mehr geht. Freunde des Sense of Wonder werden sich aber zunächst noch gedulden mussen. Zwar erspäht man im Zielgebiet des mobilen Mondes eine künstliche Konstruktion, die offenbar mehrere Lichtminuten groß ist - das war es in Teil 1 des Romans aber auch schon. Im Mittelpunkt steht hier der routiniert beschriebene Bordalltag. Erst schlägt man sich noch eher kuriosen "Problemen" herum: Etwa wie man sich für die tägliche Pressekonferenz mit CNN zurechtmodelt (die Besatzung der ISS kann ein Lied davon singen, wie es ist, ständig "Medienereignisse" kreieren zu müssen ...) oder ob das Pinguin-Logo auf der Außenhülle der "Rockhopper" auf Aliens aggressiv wirken könnte. Später mit ernsteren wie Unfällen und dem Verdacht, von den eigenen Auftraggebern hintergangen worden zu sein. Die Lagerbildung an Bord verschärft sich - die eine Seite von Kommandantin Bella Lind angeführt, die andere von deren leitender Mitarbeiterin und bester Freundin Svetlana Barseghian. Sie mahnt vergeblich zur Umkehr - bis es schließlich zu spät ist und die "Rockhopper" an den immer weiter beschleunigenden Janus gebunden bleibt. Svetalana wird Bella niemals verzeihen, ihre Warnungen missachtet zu haben - und nie ist im Dilatationsflug eine sehr lange Zeit.
"Himmelssturz" ist das Zeit und Raum hinter sich lassende Duelle zweier Frauen, die einander ähnlicher sind, als ihnen lieb ist. Beide bleiben im festen Glauben das richtige zu tun konsequent bis zu Kompromisslosigkeit, beide treffen unpopuläre Entscheidungen und müssen mit deren Konsequenzen leben. Ihre Spiegelbildlichkeit tritt umso deutlicher hervor, wenn das Pendel der Macht in Teil 2 von Bella auf Svetlana umschwingt. Nun geht es darum, eine überlebensfähige Kleinkolonie auf dem Janus einzurichten. Wie Parasiten werden die Menschen dann zwischen den gebirgshohen Maschinen des Mondes herumkreichen und Ideen wälzen , wie sie aus deren unerschütterlichen Bewegungsabläufen auf irgendeine Weise Energie gewinnen könnten. Ihre Reise ist damit aber noch lange nicht zu Ende - ebensowenig ist es die Feindschaft zwischen den Hauptfiguren. - Und wer sich zu diesem Zeitpunkt noch an das Vorwort erinnert, dem wird sich inzwischen auch langsam die Frage aufgedrängt haben, wer nun eigentlich die mythische Wohltäterin der zukünftigen Vergangenheit ist.
"Himmelssturz" ist ein wenig länger als seine Handlung, und zieht man die Höhepunkte des Revelation-Space-Zyklus oder auch "Das Haus der Sonnen" zum Vergleich heran, dann handelt es sich sicher nicht um denjenigen von Alastair Reynolds' Romanen mit dem größten Wow!-Faktor. Zumindest in Teil 2 und 3 bietet er aber das, was man sich von ihm erhofft. Reynolds ist einfach ein Autor, der nur in großen Räumen leben kann.
In der nächsten Rundschau wird möglicherweise die Zeitmaschine (ja, genau die) angeworfen. Und sollte sich das mit dem Erscheinungsdatum nicht mehr ausgehen, dann besuchen wir eben eine Stadt, die auf Schienen durch die Gegend rumpelt. Hauptsache in Bewegung bleiben. (Josefson)