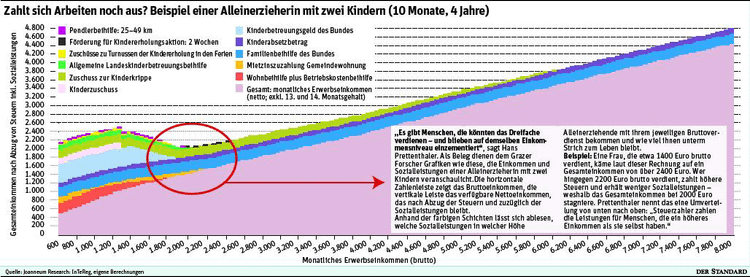Wien - Die Idee erhielt viel Applaus, zuallererst vom Finanzminister. Franz Prettenthaler vom Grazer Joanneum-Institut hat das Transferkonto erfunden, um den "Wildwuchs" an Sozialleistungen von Staat, Ländern und Gemeinden transparent zu machen. Kernbotschaft: "Unkontrollierte Umverteilung auf allen Ebenen" führe dazu, dass sich höherer Arbeitseinsatz für Familien ab dem unteren Mittelstand oft nicht mehr lohne.
Klingt bedrohlich - aber lässt sich diese These auch belegen? Experten melden erhebliche Zweifel an. "Prettenthaler hat tendenziöse, unrealistische Beispiele gewählt, um dramatische Ergebnisse zu erzielen" , kritisiert Josef Wöss, Leiter der Abteilung Sozialpolitik in der Arbeiterkammer. Die Familienforscherin Eva Festl sagt: "Die getroffenen Annahmen sind mitunter nicht geeignet, das Gros der österreichischen Familien abzubilden."
Prettenthaler nennt in seiner Studie, deren Langfassung kommende Woche veröffentlicht wird, etwa ein fiktives Berufseinsteigerpaar, das gemeinsam nur 950 Euro verdient, aber zwei Kinder und ein Auto hat. Dank diverser Sozialleistungen von Kindergeld bis Pendlerbeihilfe käme die "Familie Gruber" auf ein Nettoeinkommen von 2800 Euro, das nur mehr um 450 Euro unter jenem der "Familie Schmied" läge, die brutto 3800 Euro verdient, deshalb aber Steuern zahlt und um viele Zuschüsse umfällt. Wöss hält etwa für abwegig, dass die Grubers, die für ihren Hungerlohn kaum voll beschäftigt sein könnten, ihre einjährige Tochter in der Krippe unterbringen (und dafür Beihilfe beziehen): "Und die Familie Schmied verdient gerade um die paar Netsch zu viel, um kein Kinderbetreuungsgeld mehr zu bekommen. Dabei gäbe es vie-le Gestaltungsmöglichkeiten, um nicht rauszufallen."
2007 seien nur in fünf Prozent der Haushalte mit Kindern unter zwei Jahren beide Eltern, wie in der Studie angenommen, voll erwerbstätig, sagt Festl. Häufiger sei ein Elternteil nicht erwerbstätig, teilzeitbeschäftigt oder karenziert. Die Familie beziehe in den meisten Fällen Kinderbetreuungsgeld - und Prettenthalers Rechnung fiele weniger spektakulär aus.
Mit der Lupe suchen
Noch ein Beispiel relativiert Festl. Prettenthaler versucht, etwa anhand einer Alleinerzieherin (s. Grafik), nachzuweisen, dass sich Mehrarbeit nicht lohne, weil sich Gehaltserhöhungen wegen wegfallender Sozialleistungen sogar in sinkenden Gesamteinkommen niederschlagen könnten. Einwand der Familienforscherin: Der Niedrigverdienern vorbehaltene steirische Kinderzuschuss, der für den Effekt hauptsächlich verantwortlich ist, werde nur das erste Lebensjahr über ausbezahlt - und deshalb kaum eine Bezieherin vom Arbeiten abhalten. Festl vermisst zwar auch Anreize für Erwerbstätigkeit, führt das aber mehr auf fehlende Kinderbetreuungseinrichtungen zurück.
"Um Schwachstellen freizulegen, muss man auch mögliche extreme Fälle aufzeigen" , argumentiert Prettenthaler: "An den Haaren herbeizogen sind die Fälle jedenfalls nicht. Da wird die soziale Realität verkannt." Vom Tisch wischt der Forscher auch Wöss' Kritik, dass er die Steuervorteile der Besserverdiener, etwa das 13. und 14. Gehalt, ausblende. Selbst wenn's in seiner eigenen Grafik anders steht (siehe oben), beteuert Prettenthaler, die steuergeschonten Zusatzgehälter inkludiert zu haben.
Abgesehen vom Vorwurf der Dramatisierung glauben aber auch die Kritiker, dass die Studie einen wahren Kern treffe. Der Arbeiterkämmerer Wöss plädiert deshalb für Einschleifregelungen statt starrer Verdienstgrenzen, ab denen Sozialleistungen abrupt wegfallen.
Norbert Neuwirth vom Institut für Familienforschung meint zwar auch, dass man manche von Prettenthalers Fällen "mit der Lupe suchen" müsse, hält den angeprangerten "Schwelleneffekt" , der Niedrigverdiener in Abhängigkeit von Sozialleistungen halte, aber für eine "sehr einschneidende" Tatsache. Allerdings mahnt Neuwirth, auch die Kehrseite der angeblichen sozialen Hängematte zu sehen: Laut einer Studie des Europäischen Wohlfahrtszentrums holt die Hälfte jener Menschen, die Anspruch auf Sozialhilfe hätte, diese gar nicht ab. (Gerald John/DER STANDARD-Printausgabe, 22. Oktober 2009)