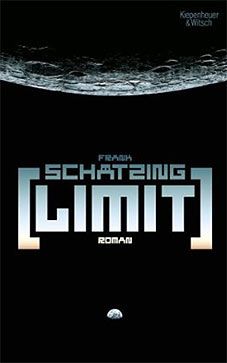
Frank Schätzing: "Limit"
Gebundene Ausgabe, 1.320 Seiten, € 26,80, Kiepenheuer & Witsch 2009.
Wie hektisch wohl hinter den Kulissen der Run auf Rezensionsexemplare getobt haben mag? Nach dem Mega-Erfolg von "Der Schwarm" hat sich mit Sicherheit jeder von SF-Websites über tagesaktuelle Medien wie uns und das ehrenwerte Följetong bis hin zur "Petra" um den neuen Roman von Frank Schätzing geprügelt. Hoffentlich nicht mit dem Buch selbst in der Hand: Das würde angesichts seiner Masse zu tödlichen Quetschwunden führen. 1.300 Seiten! Und es glaube keiner, die wären in Balkenlettern bedruckt. - Hat man die anfängliche Hemmschwelle erst mal überwunden, findet man sich flugs in so etwas wie einem ins Jahr 2025 verlegten Agatha-Christie-Setting wieder, in dem sich die Reichen und Schönen inklusive ihrer Macken und Zickereien an einem exquisiten Ort versammeln; einer davon unter falscher Identität und mit mörderischen Absichten. Sammelplatz ist die ecuadorianische Isla de las Estrellas, der Ankerplatz des Weltraumfahrstuhls, der hinauf zur privaten Raumstation OSS führt und der die Raumfahrt revolutioniert hat. Wer in der international besetzten Richnik-Riege - vom russischen Oligarchen über die taiwanesische Modezarin bis zur US-Talklady - eine herausragende Rolle spielen wird, lässt sich lange Zeit nicht sagen. Im Mittelpunkt stehen allerdings der Milliardär Julian Orley (Schöpfer der Orley Space Station), der zwecks InvestorInnen-Suche zur Mondreise eingeladen hat, und seine Kinder: Tim, mit dem er im klassischen Vater-Sohn-Konflikt steht, und Lynn, die zusehends auf ihren zweiten großen Burn-out zutreibt. Eitles Geplauder prägt die Kapitel um die Mondreisegesellschaft - letztlich sind sie privilegierte VertreterInnen eines Utopia, das Hotels im Orbit und auf dem Mond errichtet hat und an einem zweiten Monaco baut, welches - idyllischen Berghang inklusive - durch die Südsee kreuzen soll.
Tief in den Niederungen der Erde bewegt sich indessen der Cyber-Detektiv Owen Jericho, den wir kennenlernen, als er im Süden Chinas einen Kinderporno-Produzenten hops nimmt. Seinen nächsten Auftrag erhält er von einem Industriellen, der ihn bittet die verschwundene Tochter eines Freundes aufzuspüren. Yoyo ist als Gründerin der Netz-Dissidentengruppe Die Wächter in Konflikt mit den chinesischen Behörden geraten; hinter ihrem jetzigen Abtauchen scheint aber mehr zu stecken. - Im Gegensatz zu den eminenten Fortschritten in Sachen Weltraum-Infrastruktur und globaler Energieversorgung scheint die Evolution des World Wide Web bis 2025 nur maßvoll vorangeschritten zu sein. Jericho ist jedenfalls in vergleichsweise gegenwärtigen Ermittlungen unterwegs - eine weise Entscheidung Schätzings, denn den Cyberpunk-Autor hätte ihm wohl kaum jemand abgenommen. Gemeinsam mit dem rührigen Software-Unternehmer Tu Tian und Yoyo hetzt Jericho in der Folge der Auflösung eines Geheimnisses hinterher, von dem die Sicherheit der Mondreisegesellschaft abhängt; und ein bisschen auch das Schicksal der Weltwirtschaft.
"Limit" ist viel zu lang, keine Frage. Dass der Roman deswegen nicht notwendigerweise langweilig wird, ist vor allem Schätzings launigem Stil geschuldet; auch wenn der bisweilen ins Geschwätzige übergeht. Als Meister der Selbstinszenierung kann Frank Schätzing entsprechendes Vermögen auch seinen Charakteren implantieren und sie in witzige Wortduelle treiben. Da wird sogar mal mit Selbstironie kokettiert: Gleich zu Beginn etwa räsoniert eine der Hauptfiguren, dass es nichts Uninteressanteres gäbe als das Meer - auch ein Kommentar zu den vielfach bekundeten Wünschen nach einer "Schwarm"-Fortsetzung. (Ähnlich wie "die Muse" in Albert Brooks' gleichnamigem Film einst "Titanic"-Regisseur James Cameron nahelegte: "Stay out of the water.") Einen 78-jährigen David Bowie auf der OSS Astronautenballaden singen zu lassen ist ein netter Einfall - ebenso wie der Umstand, dass der zum Mond mitreisende Schauspieler Miles O'Keefe just als Titelheld in der Verfilmung von "Perry Rhodan" zu Weltruhm gelangte. Solcherart Humor verzuckert die eigentliche Handlung, die sich aus zwei Grundelementen zusammensetzt: Spannung ("Limit" erinnert in vielerlei Hinsicht an Schätzings Polit-Thriller "Lautlos" aus dem Jahr 2000) und ... sagen wir: Didaktisches.
Bereits im "Schwarm" schuf Schätzing in einem fort Situationen wie Konferenzen oder Lagebesprechungen, in denen zusammenrecherchiertes Wissen zum Besten gegeben werden konnte. Das verstärkt sich hier noch einmal deutlich. Viele Motive - von der geschätzten Anzahl des Weltraummülls im Erdorbit über den Abbau von Helium-3 auf dem Mond als Lösung aller Energieprobleme bis zur Verwendung des lunaren Regoliths als Baumaterial für Mondbasen - hat man vielleicht noch aus der Wissenschaftsberichterstattung der vergangenen Jahre in Erinnerung. Doch damit ist es bei weitem nicht getan: Erklärt wird, was ein Avatar ist oder die Albedo, der Van-Allen-Gürtel oder ein geostationärer Orbit, die Grundregeln der chinesischen Etikette oder eine kurze Geschichte der Ölförderung in Äquatorialguinea; nicht selten hat man dabei das Gefühl, im Hintergrund das leise Surren eines Overhead-Projektors zu vernehmen. (Und es würde auch niemanden groß verwundern, wenn auf "Limit" ein themenbezogenes Sachbuch folgen würde wie einst "Nachrichten aus einem unbekannten Universum" auf "Der Schwarm".) Schätzing gefällt sich als kundiger Führer durch die Sehenswürdigkeiten der Mondoberfläche ebenso wie durchs pittoreske Großstadt-China oder das Berliner Pergamon-Museum. Der Wert dieser Passagen hängt ausschließlich vom Wissensstand der LeserInnen ab - sicherheitshalber gehen die Erklärungen jedenfalls vom Level Null aus. Das ist das Material, aus dem Bestseller geschnitzt werden. Was "Limit" allerdings fehlt, ist ein ähnlich effektiver Aufbau wie im "Schwarm", der sich ja in Stufen einer fortschreitenden Eskalation präsentierte. Hier kommt die Handlung erst so nach und nach in Gang - beziehungsweise die Handlungen, denn die beiden Plot-Linien auf dem Mond und auf der Erde beeinflussen einander zwar, sind aber über den größten Teil des Romans hinweg nur geringfügig verzahnt.
Das Pulver der Science Fiction hat Frank Schätzing mit "Limit" sicherlich nicht erfunden. Es bleibt ein recht unterhaltsamer Roman, der seine Momente ebenso hat wie seine Längen und der für LeserInnen vor allem dann interessant ist, wenn sie sich mit den abgehandelten Themen zuvor nicht oder kaum beschäftigt haben. Für andere erschließen sich hier keine neuen Horizonte - außer sie legen die im Dezember erscheinenden CDs der Hörbuch-Version im Auto ein. Damit können sie dann nämlich weit, weit, weit fahren.
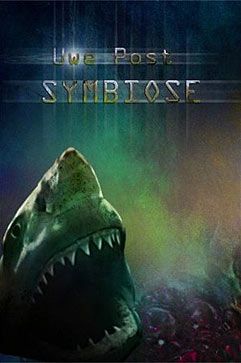
Uwe Post: "Symbiose"
Broschiert, 198 Seiten, € 13,30, Atlantis 2009.
Willkommen in der Welt des Jahres 2134 – entschuldigen Sie, dass es grade etwas hektisch zugeht: Immerhin ist die schöne Tiga aus der wichtigsten Castingshow des Planeten als Siegerin hervorgegangen und wird nun in Amsterdam 2.0 zur neuen Weltkaiserin gekrönt. Aric Ekloppos hat sich in die Menge der euphorisch Feiernden eingereiht und wird im Trubel fast zu Tode getrampelt – erstes Schlaglicht auf die Welt von "Symbiose". Ein weiteres wird auf Aniaa Karim geworfen, die in Tübingen in einer Beziehung mit einer außerirdischen Vyrroc lebt. Ein drittes auf Leop Üller, der als Symbioniker am Heidelberger Biotools-Institut arbeitet.
Letzterer bietet sich zugleich als Führer in die einzigartige Welt von "Symbiose" an, wo man auf Mechanik und Elektronik gerne verzichtet und statt dessen auf künstlich gezüchtete Organismen setzt: Flechten und Moose kleiden das Eigenheim aus, methanfurzende Luftfische kurven wie Allzweck-Zeppeline durch den Himmel, Telefonschnecken schieben sanft ihre Pseudopodien in Ohr und Kehlkopf und die Kinder kicken (fies! Szenenapplaus!) flauschige weiße Knutbälle durch die Gegend. Biologisch abbaubar sind die hilfreichen Produkte allesamt – meistens gleich durch die eigenen Artgenossen. Ein paar allzu kalauernde Wortspiele wie Brillenschlangen oder Trinkuine tauchen zwar auch auf, aber das verzeiht man dem Autor gerne, der hier seinen zweiten Genre-Roman vorlegt und zuvor bereits in zahlreichen Kurzgeschichten seine überbordende Fantasie unter Beweis stellte.
Doch ist nicht alles eitel Wonne in der schönen neuen Weltsymbiose. Das Baby von Aniaas Partnerin Pschist-I wird krank und auf die Heimatwelt der Vyrroc gebracht; in der familiären Klokröte findet Aniaas Freundin Vita seltsame Mikroben. Der unschuldige Narr Aric wird in einem fort herumgereicht, ohne zu begreifen, wie ihm geschieht: Nach einem Talkshow-Auftritt wird er zum publicityfördernden Begleiter einer nicht nur machtlüsternen Politikerin und gerät in einen Terroranschlag der Steeldogs, der letzten militanten Vertreter des Maschinenzeitalters. Und Leop muss feststellen, dass seine angebetete Arbeitskollegin Mooha nicht mehr ins Büro zurückkehrt; das verheißt nichts Gutes in einer Welt, die ein Ministerium für Meinungsschutz kennt und in der nicht nur unliebsame Texte, sondern auch schon mal Personen oder ganze Organisationen verschwinden. Ganz zu schweigen von mörderischen Jugendbanden, die in den verwahrlosten Zonen Leichen zu makabren Tableaus drapieren. Alle drei Hauptfiguren stoßen überdies auf unterschiedlichen Wegen auf Spuren einer nahenden Bedrohung: Leop findet in Moohas Notizen Anmerkungen über ein weltraumtaugliches Fluchtfahrzeug, Aniaa sieht in einer esoterischen Gaia-Seance, wie sich riesige Kiefer um die Erde schließen. Was kommt da auf unseren Planeten zugeflogen – ein seltsam geformter Asteroid oder tatsächlich ein gigantischer Weltraumhai? Doch was immer es ist: Chaos und Unruhen brechen aus, und die Spitzenpolitiker haben längst beschlossen, sich an Bord eines biotechnischen Riesenkäfers ins All abzusetzen; auf die Bevölkerung wird gepfiffen. "Ich war schon immer der Meinung, dass Bürger die Ausübung unserer Tätigkeit nur behindern", findet einer den Silberstreifen am Horizont des Weltuntergangs.
Nicht selten hat man beim Lesen den Eindruck, sich selber einen Halluzinogene absondernden Psyfrog unter die Zunge geklemmt zu haben. In ultrakurzen Kapiteln hasten die ProtagonistInnen durch eine mit bizarren Details vollgestopfte Travestie von Zukunftswelt, in der Humor und Gewalttätigkeiten aneinanderknallen. Das lässt an China Mievilles New Crobuzon denken oder auch an Moebius' "John Difool"-Comics ... oder an die abgedrehte TV-Serie "LEXX", Sein Schatten hab' sie selig. Vor allem aber macht es jede Menge Spaß zu lesen. Und trotz des wirbelnden Chaos wird das Ganze schließlich sogar zu einem runden Ende gebracht, das Schicksal der Erde inklusive. Aber Hand aufs Herz: Mit Posts schlimmster Horrorvision, der Spamtaube, könnte es ohnehin kein Weltuntergang aufnehmen. Nicht auszudenken, wenn all die unerschöpflichen Legionen versiffter Stadttauben auch noch in einem fort Reklamebotschaften in die Gegend plärrten ...
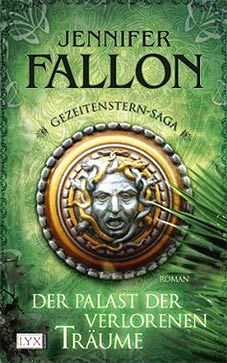
Jennifer Fallon: "Gezeitenstern-Saga 3: Der Palast der verlorenen Träume"
Broschiert, 574 Seiten, € 15,40, Egmont Lyx 2009.
Wie Sphärenmusik klingt's, wenn die Götter ihre von jahrtausendelanger Einsicht geprägten Gespräche führen und über das Wesen der Welt oder ihrer unsterblichen Brüder und Schwestern philosophieren. Etwa im Stil von: "Ich wette, diese mürrische alte Hure würde ihre linke Titte hergeben, um sich das hier unter den Nagel zu reißen." - Der Amyrantha-Clan ist wieder auf Sendung! Das fabulöse Intrigenspiel von Jennifer Fallons "Gezeitenstern-Saga" geht in die dritte und leider schon vorletzte Runde.
Besagte Titte baumelt an der vierschrötigen Maralyce ... und im Grunde könnte diese sie locker entbehren, denn wie bei allen Unsterblichen von Amryrantha wüchse auch ihr jedes verlorene Körperteil nach, bis ans Ende aller Zeiten. Leider hat die Alte mit der Kodderschnauze, die mit ihren trockenen Kommentaren in Teil 2 der "Gezeitenstern"-Saga (hier der Rückblick) entzückte, im dritten Teil nur einen Cameo-Auftritt. Doch dass sie sich nicht an den Machtspielchen ihrer "KollegInnen" beteiligt, sondern stattdessen auf der Suche nach Bodenschätzen im Alleingang einen halben Kontinent untertunnelt hat, erscheint nun plötzlich in einem ganz anderen Licht. Vielleicht sucht sie ja gar kein Gold, sondern den Tumultstein, der gleich am Anfang von "Der Palast der verlorenen Träume" als neues Motiv eingeführt wird? - Man wird sehen, welche Rolle dieser Kristall des Chaos noch spielen wird - mit Blick auf den Titel des abschließenden vierten Teils der Saga ("The Chaos Crystal") sicher eine größere als das Zauberding, um das sich Teil 2 gedreht hatte, und das an dessen Ende kräftig entzaubert wurde: Die Ewige Flamme. Nur durch deren verzehrendes Feuer konnten gewöhnliche - sehr, sehr gewöhnliche - Menschen zu den Quasi-Göttern aufsteigen, die Amyrantha seit Jahrtausenden plagen. Dachte man. Doch wie ausgerechnet einer ihrer erbittertsten Gegner feststellen musste: Es führen mehr Wege zur Unsterblichkeit als gedacht. Oder wie Maralyce im zentralen Satz von Teil 2 feierlich verkündete: "Bah! Die Ewige Flamme ist für'n Arsch."
So ist also Declan Hawkes, ehemals Erster Spion des ermordeten Königs von Glaeba, durch einen Unfall zum ersten neuen Unsterblichen seit Jahrtausenden geworden. Und nicht nur das: Er hat nicht nur die üblichen Kräfte totale körperliche Regeneration und Supervulgarität erlangt, sondern offenbar auch die verheerende Macht eines Gezeitenfürsten ... und findet sich damit unversehens als Mitglied jenes elitären Unsterblichen-Grüppchens wieder, das anstrengungslos globale Katastrophen auslösen kann und dies auch bereits mehrfach getan hat. Ein Leben lang bekämpfte Declan deshalb als Mitglied der Bruderschaft des Tarot die Umtriebe der Gezeitenfürsten - nun steht ihm die verhasste Allmacht plötzlich selbst offen und beginnt ihren verführerischen Reiz auf ihn auszuüben. - Cayal, der Unsterbliche Prinz des gleichnamigen ersten Teils der Tetralogie, ist solcher Verlockungen längst überdrüssig und hat nach wie vor nur das eine Ziel, endlich sterben zu können. Ausgerechnet er wird seinem alten Rivalen Declan nun zum Mentor werden müssen. Währenddessen stellt die Frau, die zwischen ihnen steht - Fürstin Arkady Desean -, zu Beginn von "Palast der verlorenen Träume" fest, dass sie zum ersten Mal etwas mit Cayal gemeinsam hat: Todessehnsucht nämlich, nachdem sie durch die Intrige eines weiteren Unsterblichen in die Sklaverei verkauft wurde und nun auf einem fremden Kontinent einem ungewissen Schicksal zwischen Hure und Gebärmaschine entgegensieht.
Der dritte "Gezeitenstern"-Teil weist zum ersten Mal eine gewisse Schwäche in der Handlungskonstruktion auf. Denn Declan bleibt zwar beständig auf Arkadys Spur, doch Cayal verschlägt es aus völlig anderen Gründen just in dieselbe Gegend. Ebenso wie die halbmenschliche Chamälidin Tiji, die einst Declans Gehilfin war, dann aber von Angehörigen ihres versteckt lebenden Volkes in dessen letzte Enklave entführt wird. Und die liegt zufällig ... erraten: alle Wege führen in die Sümpfe von Senestra. Das bemüht die Plausibilität etwas, aber Fallons frische Erzählweise macht dies locker wett. So lernt Einzelgängerin Tiji zum ersten Mal die Gebräuche ihres Volks kennen - unter anderem in einer witzigen Hommage an die berühmte "Susi und Strolch"-Spaghetti-Szene, in der Tiji und ein hübscher Chamälide gemeinsam an einer aphrodisierenden Motte nuckeln.
Auch die anderen Hauptfiguren der bisherigen Teile liegen aber nicht auf der faulen Haut: Arkadys (Schein-)Ehemann Stellan bemüht sich, die Machtergreifung einer Unsterblichen-Familie in Glaebas Nachbarreich Caelum hinauszuzögern. Und der Hundemensch Warlock, der ihm dabei hilft, entdeckt allmählich den Kitzel des Geheimdienstlebens. Und am eisigen Ende der Welt hat der Unsterbliche Lukys, der behauptet einen Weg gefunden zu haben, wie man seinesgleichen töten kann, seinen Palast der unmöglichen Träume errichtet. (So wird er jedenfalls im Roman genannt, der im Original auch "The Palace of Impossible Dreams" heißt; warum die deutschen Titelträume "verloren" sind, bleibt ein Geheimnis.) - Insgesamt bewegt sich in Teil 3 weniger Entscheidendes als zuvor, und auch der diesmalige Knalleffekt am Schluss dröhnt nicht so laut wie in den vorherigen Bänden. Doch schafft Fallon es wie gehabt, das Lesen an sich zum puren Vergnügen zu machen, egal was passiert (oder nicht passiert). Und für einen vorletzten Band ist ein kurzes Innehalten ohnehin normal. Alle Figuren sind auf dem Brett und bereiten sich auf den finalen Showdown vor. In Gandalfs Worten: "It's the deep breath before the plunge."
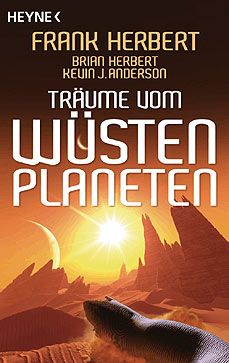
Frank Herbert, Brian Herbert & Kevin J. Anderson: "Träume vom Wüstenplaneten"
Broschiert, 590 Seiten, € 10,30, Heyne 2009.
"Ich schreibe nicht beiläufig, und es täte mir leid zu hören, dass jemand mich beiläufig liest." So lautet eine Passage in einem Antwortbrief Frank Herberts an einen Fan in der Zeit vor der Veröffentlichung von "Dune". Zu der es beinahe nicht gekommen wäre, weil die Verlage in den 60ern das, was später zu einem der monumentalsten Epen der Science Fiction-Geschichte werden sollte, reihenweise abgelehnt hatten. Denn wer wollte schon einen 400-Seiten-"Schinken" lesen? (Selige Zeiten waren das noch ...) Einblicke aus erster Hand wie diesen bietet "Träume vom Wüstenplaneten" (im Original "The Road to Dune"), und dabei handelt es sich - das sei ausdrücklich gesagt - um Sekundärliteratur. Wer nie eines der "Dune"-Bücher gelesen oder wenigstens eine der Verfilmungen gesehen hat, wird mit diesem Werk vermutlich noch weniger anfangen können als mit der Frank Herbert-Biografie "Dreamer of Dune", die ebenfalls dessen Sohn Brian geschrieben hat. "Dune"-Fans hingegen erschließen sich hier neue Aspekte.
... obwohl: So einfach ist das mit der Ausschließlichkeit gar nicht. Denn ca. die Hälfte des Bands nimmt ein ohne jedes Vorwissen konsumierbarer Roman mit dem Titel "Der Gewürzplanet" ein. Es ist dies die ursprüngliche Version des späteren Erfolgsromans, die freilich nur in Entwürfen, Figuren- und Szenenbeschreibungen existierte, wie Brian Herbert sie im Nachlass seines Vaters fand und daraus gemeinsam mit Kevin J. Anderson zu einer Geschichte ausformulierte. Der Stil ist somit eindeutig nicht der Frank Herberts (wie LeserInnen der seit 1999 erscheinenden neuen "Dune"-Bücher des Autoren-Duos bezeugen können). Doch die unterschiedliche inhaltliche Ausrichtung des abgetriebenen Zwillings geht auf Frank Herbert selbst zurück, der im Verlauf der Planungen erkannte, dass sich aus einer ursprünglich recht einfachen Abenteuergeschichte (die vermutlich schneller einen Verleger gefunden hätte, wie in der Einleitung spekuliert wird) etwas Größeres machen ließe.
"Der Gewürzplanet" verfolgt den Weg des hemdsärmeligen Adeligen Jesse Linkam (dem Vorbild für Leto Atreides), dem vom Hochkaiser für zwei Jahre das Monopol des Gewürzabbaus auf der Dünenwelt überlassen wird, das bis dahin ein gewisser Valdemar Hoskanner (= Vladimir Harkonnen) innehatte. Die alternativen Namensversionen lassen den Roman für "Dune"-Fans wie eine Parallelweltgeschichte wirken - nicht zuletzt wenn Jesse anstelle von Lady Jessica von einer Konkubine/Privatsekretärin mit dem glamourösen Namen Dorothy Mapes begleitet wird. Doch bleibt es nicht einfach bei unterschiedlichen Benennungen: So ist beispielsweise Barri, der gemeinsame Sohn der beiden, halb so alt wie der spätere Paul Atreides und ein ganz gewöhnliches Kind, das Videospiele spielt und für die Geschichte keine größere Bedeutung hat. Und auch die Melange selbst ist hier einfach nur eine beliebte Luxus-Droge der herrschenden Klasse, um deren Abbau mit Intrigen, Sabotage und schließlich offener Gewalt gekämpft wird - und nicht der Lebenssaft des Imperiums. Denn Mentaten und Gilde-Navigatoren gibt es hier ebensowenig wie Bene Gesserit, Fremen oder einen Kwisatz Haderach. Und mit diesen fällt auch der gesamte metaphysische Themenkomplex um Religion und Vorherbestimmung, um Jahrtausende überspannende Blut- und Zeitlinien und Pläne in Plänen weg. Ganz zu schweigen von Charakteren, die durch ihre grenzenlose Beherrschung von Körper und Geist oft unmenschlich wirken ... was sie in den Augen der Bene Gesserit-Hexen allerdings erst wirklich zu Menschen macht und sie von Tieren (wie uns) unterscheidet. - "Der Gewürzplanet" ist also einfach ein Abenteuerroman und gewissermaßen "Dune light".
Ergänzt wird dies um biografische Informationen über Frank Herbert (seltsamer Gedanke, dass der Schöpfer des Wüstenplaneten ein Hühnerhaus mit automatischer Rupfmaschine unterhielt), Briefwechsel und bislang unveröffentlichte Szenen aus den ersten beiden "Wüstenplanet"-Romanen, die entweder gestrichen oder abgeändert wurden. Da diese den veröffentlichten Pendants nicht gegenüber gestellt werden, können damit aber wirklich nur noch ausgemachte "Dune"-Fans, die Herberts Romane wie die Orange-Katholische Bibel herunterzitieren, etwas anfangen. Auch wenn von geradezu aufsehenerregenden alternativen Enden die Rede ist. - Den Abschluss machen mehrere Kurzgeschichten aus der Feder von Brian Herbert und Kevin J. Anderson. "Das Flüstern der Meere Caladans", die stilistisch beste, schildert das Schicksal einer Kompanie von Atreides-Soldaten während des Harkonnen-Angriffs auf Dune; eine melancholische Geschichte, die zum Keim einer neuen Fremen-Legende wird. Die drei anderen sind Episoden aus der Ära von Butlers Jihad, dem die Zukunft verändernden Krieg gegen alle künstlichen Intelligenzen, wie ihn Herbert & Anderson in ihrer 10.000 Jahre vor "Dune" angesiedelten "Legenden"-Trilogie beschreiben. Wer diese gelesen hat, wird hier bekannte Figuren wie Xavier Harkonnen oder den Roboter Erasmus wiedertreffen.
Wie gesagt: "Träume vom Wüstenplaneten" ist nichts für NeueinsteigerInnen, hat als Sekundärliteratur für die Fangemeinde aber seinen Wert. Und was Tolkien bei Klett-Cotta an Aufarbeitung bekommt, hat sich auch Herbert bei Heyne redlich verdient.
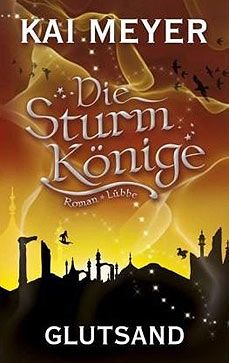
Kai Meyer: "Die Sturmkönige", Teil 3: "Glutsand"
Gebundene Ausgabe, 476 Seiten, € 19,60, Lübbe 2009.
Keine Elfen, keine Zwerge, keine Drachen, keine Vampire - und doch bedient sich Kai Meyer eines Fantasy-Stoffs, wie er klassischer kaum sein könnte: der Sagen aus 1001 Nacht. Vielleicht löst der deutsche Autor mit seiner ebenso apokalyptischen wie kunterbunten Morgenland-Version ja noch eine Modewelle aus. "Glutsand" ist jedenfalls ein würdiger Abschluss der originellen "Sturmkönige"-Trilogie; was bisher geschah, finden Sie hier. Und wer die beiden ersten Bände noch lesen möchte, sollte jetzt schleunigst zur nächsten Seite weiterklicken, denn der nächste Absatz beginnt mit einem dicken fetten Spoiler.
Konsterniert mussten Meyers ProtagonistInnen am Ende von Band 2 ("Wunschkrieg") feststellen, dass sie gar nicht in der richtigen Welt leben, sondern in einer Kopie derselben, die ein mächtiges Magier-Paar schuf und in einer versiegelten Flasche am Meeresboden des Originals versenkte. Grund für ihren drastischen Eingriff (und einen in der Fantasy-Literatur bemerkenswerten Plot-Twist) war das Überhandnehmen der Wilden Magie, deren verheerende Auswirkungen einfach nicht mehr in den Griff zu bekommen waren. So wurde die Notbremse gezogen, alles Magische in die Kopie verbannt, die Originalwelt nahm den uns bekannten nicht-magischen Geschichtsverlauf ... und nur die Kopien der Menschen haben in ihrer Flaschenwelt nach wie vor den Scherben auf. Vor allem wegen der alles massakrierenden Dschinn-Heere, die sich nun auf Bagdad, die letzte freie Stadt des Morgenlands, zubewegen. Der Samarkander Junis kommt gerade zurecht, als die erste Angriffswelle auf die Stadt losrollt: Schlammvulkane werden zum Ausbruch gebracht, Rieseninsekten fallen über die Verteidiger her und die fliegenden Knochenthrone der Dschinnfürsten schweben höhnisch über den Legionen lobotomisierter Menschensklaven, die in völligem Wahnsinn über alles und jeden herfallen: Der jüngste Tag bricht an.
Als letzte Hoffnung für die Welt ist eine - das Motiv kennen wir doch - bunt zusammengesetzte neunköpfige Gruppe unterwegs, angeführt vom Schmuggler und begnadeten Teppichreiter Tarik, der ein Fragment eines Dschinnfürsten in sich trägt, den er leider doch nicht so ganz töten konnte. Dazu kommen die verhinderte Assassine Sabatea, deren Blut tödlicher ist als jedes Schlangengift, der Bagdader Hofmagier Khalis, der byzantinische Krieger Almarik, das Geschwisterpaar Nachtgesicht und Ifranji aus den Slums von Bagdad und ein geflügeltes Elfenbeinpferd. Plus zwei "Mitglieder", die nicht wirklich einsatzfähig sind: Khalis' scheintote Tochter Atalis, die er - was für ein Bild! - in einem mit Honig gefüllten Kristallschrein konservierte. Und die ehemalige Sturmkönigin Maryam, die am Ende von Teil 2 starb und die Tarik in vager Hoffnung auf Wiederbelebung kurzerhand zu Atalis in den Sarkophag stopfte. Gegen Khalis' ausdrücklichen Wunsch, und spätestens hier enden die Tolkien-Assoziationen. Denn die Fellowship of the Flying Carpet ist alles andere als eine eingeschworene Gemeinschaft: Misstrauen, Rivalitäten und wechselseitige Rachegelüste treiben sie an - selbst das ätherische Elfenbeinpferd pocht unbarmherzig auf die Einlösung einer Blutschuld. Wie hatten sie jemals annehmen können, auch nur in Skarabapur anzukommen, ohne sich zuvor gegenseitig die Schädel einzuschlagen? grübelt Tarik.
So sind denn auch die Motive der GefährtInnen, ans Ziel ihrer Queste zu gelangen, gänzlich unterschiedlich - nur der Weg eint sie: Ins besagte Skarabapur, wo die Quelle der Wilden Magie liegen soll und wo angeblich die welterschütternde Macht des Dritten Wunsches gesammelt wird. Eine alte Stadt, vielleicht nur eine imaginäre, oder auch einfach das Symbol der Erfüllung aller Wünsche ... noch wissen sie es nicht. Sehr schön kommt Meyer jedenfalls in vielfältigster Weise immer wieder auf Wünsche und Ambitionen als das zentrale Motiv der "Sturmkönige"-Trilogie zurück. Und die moralischen Ambiguitäten, die daraus entspringen, können die Heldentaten der "Guten" ebenso skrupellos wie die Massenmorde der "Bösen" (fast) verständlich erscheinen lassen.
Auf dem Weg ans unklare Ziel - und zu einem Showdown, der nichts zu wünschen übrig lässt - kommen sie jedenfalls noch an einer Menge Stationen von opulenter Bildhaftigkeit vorbei: In einem menschenleeren Persien, in dem die Dschinne Wälle aus den Schädeln der Getöteten errichtet haben, einer Glaswüste aus geschmolzenem Sand, unter deren Oberfläche sich gigantische Tiere bewegen, und schließlich einem Abgrund, der wie der Rand der Welt aussieht. "Glutsand" ist wie schon seine beiden Vorgänger eine Orgie aus Farben, bizarren Formen und Action - das schreit alles geradezu danach als Anime verfilmt zu werden!
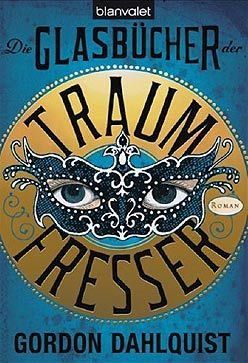
Gordon Dahlquist: "Die Glasbücher der Traumfresser"
Broschiert, 924 Seiten, € 10,30, Blanvalet 2009.
Sollte jemand aus der Erwähnung Gordon Dahlquists im Aufmacher geschlossen haben, dass an dieser Stelle sein kürzlich auf Deutsch erschienenes "Dunkelbuch" rezensiert wird: Sorry. Das wird zwar kommen, erst ist aber noch das im Vorfeld in der Taschenbuchausgabe wiederveröffentlichte Werk dran, mit dem der US-Autor in seine faszinierende Welt der Traumfresser einführte (im Original erschien "The Glass Books of the Dream Eaters" 2006). Wobei die "Tasche" zum Buch einen tragfähigen Gurt braucht, denn mit über 900 in engem Satz bedruckten und kaum von Kapiteln unterteilten Seiten liegt hier ein ordentliches Textkorpus vor.
Von Beginn an fällt der wohlerzogene Tonfall auf, in dem Dahlquist seine Erzählung entspinnt - maßgeschneidert für ein quasi-viktorianisches Setting (zu den Schwierigkeiten zeitlicher und geografischer Einordnung später mehr). So wird die erste der drei Hauptfiguren des Romans, Celeste Temple, stets als Miss Temple angeführt - noch sind wir LeserInnen nicht so weit, dass wir sie plump duzen dürften. Von ihrer Plantagen-Insel ist sie auf Bräutigamschau angereist, erhält von ihrem Verlobten aber in schnöder Briefform den Laufpass. Doch als das patente Mädel, das sie ist, lässt sie diese Demütigung nicht auf sich sitzen und folgt ihm mit Opernglas und Kapuzenmantel bewehrt bis in einen Bummelzug in die Provinz. Dort schließt sie sich einer maskierten Festgesellschaft an, die sich - ihr Ex-Verlobter inklusive - auf einem labyrinthischen Anwesen versammelt, wo gar seltsame Ereignisse ihren Lauf nehmen. Halbnackte Frauen werden - offenbar hypnotisiert oder unter Drogen gesetzt - einem handverlesenen Publikum präsentiert; die Stimmung erinnert stark an die Orgienszene in Stanley Kubricks "Eyes Wide Shut". Eine raubtierhafte Frau in Rot scheint das Geschehen zu steuern - Celeste ... pardon: Miss Temple wird enttarnt, entgeht mit knapper Not Vergewaltigung und Ermordung und rettet sich in den Zug zurück in die Hauptstadt. Ein kurzer Blickwechsel mit einem ebenfalls in Rot gekleideten Mann im Zug beendet das erste Kapitel. 80 Seiten sind vorbei, wir begreifen nichts und sind völlig gebannt.
Besagter Mann in Rot wird Kardinal Chang genannt und ist ein Auftragskiller mit der Seele eines Poeten. Er hätte auf dem Maskenball einen seiner blutigen Jobs erledigen sollen, doch ist ihm jemand zuvorgekommen. Als er später engagiert wird, Miss Temple ausfindig zu machen, stößt er auf immer mehr Indizien des Geheimnisses hinter dem aktuellen Geschehen: Er sieht Menschen mit seltsamen Brandmalen um die Augen und eine Steampunk-artige Maschine, an deren Gewirr von Schläuchen und Rohren eine Prostituierte angeschlossen wurde. Und auch am Ende seines Kapitels erfolgt ein kurzer Blickkontakt: Zu Doktor Abelard Svenson, wie sich gleich darauf herausstellt; dem dritten im Hauptfiguren-Trio. Svenson ist verantwortlich für den mecklenburgischen Prinzen Karl-Horst von Maasmärck, das schwarze Schaf der Familie. Der büxt wieder einmal aus und es dauert nicht lange, bis auch Svenson der Ermordung nahekommt. Seine Beobachtungen enthüllen weitere Details des bereits zuvor Erspähten: Er findet bläuliche Glasscheiben, in denen Erinnerungen gespeichert und in total-immersiver Weise abrufbar sind (vom Steam- geht es gleichsam über in den Cyberpunk), und einen Mann, dessen Arme teilweise zu Glas geworden sind. Erst nach 240 Seiten kehren wir zu Miss Temple zurück respektive kommt es zum Zusammentreffen der drei Hauptfiguren. Wider alle Erwartungen werden sie sich verbünden und sich an die Enträtselung der Verschwörung machen, die hinter dem Verfahren steckt, mit dem die Glasbücher geschaffen werden und das - noch bedeutsamer - für deren BenutzerInnen in eine Transformation münden soll. Alle drei haben zu diesem Zeitpunkt bereits Blut an den Händen - wie es im Klappentext heißt: Sie riskieren ihr Leben, ihre Ehre und ihre Tugend.
Erotik und Gewalt hinter verschlossenen Türen, detektivische Ermittlungen und dunkle Machenschaften, verheimlichte Skandale und geschickt aufgestellte Spanische Wände: "Die Glasbücher der Traumfresser" ist durchgehend aus einer Schlüssellochperspektive geschrieben. Kein Setting könnte dafür geeigneter sein als ein "viktorianisches": die Ära, in der die Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit am stärksten war. "Viktorianisch" deshalb unter Anführungszeichen, weil Zeit und Raum gar nicht so leicht festzumachen sind. Auf den Plantagen von Miss Temples Familie schuften Sklaven - obwohl die beschriebene Welt sich nach einem Zeitraum liest, in dem die Sklaverei in den USA, zumindest aber in Europa längst abgeschafft war. Länder wie Frankreich und Italien werden wie selbstverständlich erwähnt - wo sich das eigentliche Geschehen abspielt, wird aber geschickt offen gelassen. Viele Charaktere tragen englische Namen, doch kommen auch schwer einordenbare wie Xonck, Aspiche oder Vandaariff - Landsleute nichtsdestotrotz - dazu. Und dann wäre da noch die Statue einer von Schlangen umgarnten Heiligen Isobel zu erwähnen, die es in dieser Form in unserer Welt nicht gibt ...
Wie in einer dreifachen Spirale bewegen wir uns aus den Perspektiven der drei ProtagonistInnen auf des Rätsels Lösung zu. Und wie es Spiralen so an sich haben, werden die Wege zum Mittelpunkt hin immer kleiner. Heißt ganz prosaisch: Auch die "Glasbücher" sind sehr gut, aber viel zu lang - gemessen nicht einfach an der Seitenzahl, sondern am Fortschritt der Handlung. Nicht dass nichts geschähe: Es wird geflüchtet und in Häuser eingebrochen, es werden alte Leichen gefunden und neue produziert (beides in Massen), es wird immer weiter eingetaucht in eine dekadente Welt von Sex und Gewalt. Trotzdem kehrt, wenn schon nicht rasender Stillstand, so doch hektisches Schleichen ein - zusammengehalten freilich von Dahlquists stilistischer Gabe. Um dies uneingeschränkt genießen zu können, sind Atmosphäre- gegenüber HandlungsleserInnen allerdings im Vorteil. Der Autor hat dem auf jeden Fall Rechnung getragen: Der Folgeroman "Das Dunkelbuch" ("The Dark Volume") ist um ein Drittel kürzer ausgefallen; demnächst an dieser Stelle.
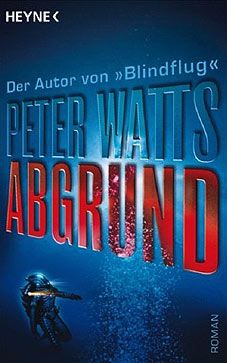
Peter Watts: "Abgrund"
Broschiert, 494 Seiten, € 9,20, Heyne 2008.
Kanada ist zu einem guten Pflaster für wissenschaftlich orientierte SF-Autoren geworden: Man denke nur an Robert Charles Wilson oder Robert J. Sawyer. Hier darf sich auch Peter Watts einreihen, der mit seiner Space Opera "Blindflug" ("Blindsight") einen Erfolg landete. Groß genug, dass nun auch seine früheren Romane, in denen er von seiner Kompetenz als Meeresbiologe zehren konnte, auf Deutsch erscheinen. "Wellen", der abschließende Band der sogenannten "Rifters"-Trilogie, ist vor kurzem erschienen. Anstatt die ganze Trilogie zusammengefasst zu präsentieren, mach ich das jetzt aber einzeln - deshalb, weil' s sonst kein Vorbeikommen an Spoilern gibt. Wer nur an Teil 3 interessiert ist, möge daher nun zwei Seiten weiterklicken.
Man nehme ein Dutzend Kinder beliebiger Abstammung. Man mische sie gründlich durch, bis keine Klümpchen mehr übrig sind. Dann lasse man sie für zwei bis drei Jahrzehnte vor sich hinköcheln und dann langsam hochkochen. Schließlich schöpfe man die Psychopathen, die Schizoaffektiven, die multiplen Persönlichkeiten und den ganzen Abschaum ab. [...] Man lasse sie abkühlen und serviere sie dann mit Dopamin garniert. Und was erhält man dabei? Etwas, das verbogen, aber nicht zerbrochen ist. Etwas, das in Spalten passt, die für den Rest der Menschheit zu krumm und schief sind. Eine solche Spalte ist die Juan-de-Fuca-Riftzone am Grunde des Pazifiks, der ideale Standort, um geothermale Energie für die darbende Welt zu gewinnen. Nur dass Durchschnittsmenschen mit der klaustrophobischen Situation unter einer drei Kilometer hohen Wassersäule nicht zurechtkommen - also hatte ein Konzern die zynische Idee statt dessen die psychisch Angeknacksten hinunterzuschicken. Und die prallen nun in der Station Beebe aufeinander: Der Pädophile Jerry Fischer, der gewalttätige Mike Brander, die vorerst noch undurchsichtigen Karl Acton und Ken Lubin. Und allen voran das ehemalige Missbrauchsopfer Lenie Clarke, die von niemandem berührt werden möchte, keine wirkliche Verbundenheit mit der Menschheit empfindet und die eine seltsame Faszination für Tod und Gefahr fühlt: Allesamt Wesenszüge, die für den weiteren Verlauf der Trilogie noch eine entscheidende Rolle spielen werden.
Das soziale Gefüge in Beebe ist also denkbar prekär - doch langsam beginnen sich die Rifter zu verändern. Implantate ermöglichen ihnen wie ein ein- und ausschaltbarer Alternativ-Metabolismus Wasser zu atmen, im Dunkeln zu sehen und den Tiefendruck zu ertragen. Immer mehr Zeit verbringen sie außerhalb der Station, beginnen draußen zu schlafen ... und manche schwimmen einfach in ihren neuen Lebensraum davon. Durch Feinabstimmung ihrer Gehirnchemie gehen sie überdies einen quasi-empathischen Verbund ein. Als der Psychologe Yves Scanlon, der die Teammitglieder ausgesucht hat, zu einem Kontrollbesuch eintrifft, fühlt er sich allein unter einer neuen Spezies, die sich von der Menschheit zusehends entfernt: Der ewigen Nacht verhaftet, monströs und zerbrechlich wie Tiefseefische; er selbst, der sich als Mechaniker des Gehirns begreift, nennt sie Vampire - und zu Jerry, bei dem die (Rück-)Entwicklung am weitesten fortgeschritten ist, fragt er sich, ob dieser Maskottchen oder Vorbild der Gruppe sei.
"Abgrund" (im Original: "Starfish", 1999) ist ein überaus dunkler Roman - die Abgründe des Ozeans sind dabei gewissermaßen das Spiegelbild derer der menschlichen Psyche. Und auch das wenige, das wir an Informationen über die Welt der Oberfläche erhalten, stimmt nicht eben optimistisch: Von einer globalen Energiekrise ist die Rede, von Kernschmelzen, steigenden Meerespiegeln und Flüchtlingszonen an den Küsten. - Erst im letzten Viertel des überaus beeindruckenden Romans wird das auftauchen, was bereits im Klappentext angekündigt wird: Ein bislang in der Tiefsee gefangenes Virus, mehr noch: eine uralte Lebensform, die nicht auf DNA basiert und die eine - potenziell gefährliche - Alternative zu jeglichem Leben in der uns bekannten Form darstellt. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten - wer die "Rifter"-Trilogie von Beginn an lesen möchte, sollte die folgenden beiden Seiten also überspringen.
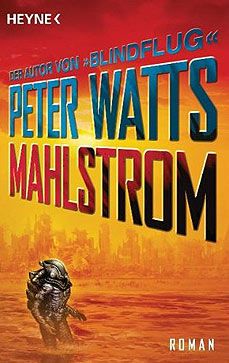
Peter Watts: "Mahlstrom"
Broschiert, 511 Seiten, € 10,30, Heyne 2009.
Sind Sie sicher, dass Sie weiterlesen möchten? Gut. Man hat eine Atombombe auf Beebe geworfen, um das Biotop des Virus zu vernichten, welches bei einem Ausbruch die gesamte Biosphäre auslöschen könnte. Auf die Besatzung der Station wurde dabei ebenso wenig Rücksicht genommen wie auf die Millionen Menschen, die der vom Atomschlag ausgelöste Tsunami an den Pazifikküsten tötete. βehemoth wird die Mikrobe genannt (und hoffentlich wird das jetzt von jedem Rechner richtig angezeigt: benannt nach dem biblischen Ungetüm, aber mit griechischem Buchstaben am Beginn, weil es sich gewissermaßen um eine "Beta-Version" des Lebens handelt). Doch Lenie Clarke und Ken Lubin haben überlebt - und speziell Lenie sinnt auf Rache, weil man sie nun einmal zu oft in ihrem Leben verscheißert hat. Als schwarze Meerjungfrau entsteigt sie dem Ozean und beginnt den in ihrem Körper angereicherten βehemoth zu verbreiten. Was dem Autor übrigens noch einige Probleme bereiten wird ...
Die Verhältnisse an der Erdoberfläche sind sogar noch schlimmer, als man sich anhand der Andeutungen in Band 1 ausgemalt hat: Die Erde ist eine kranke, brutale, völlig kaputte Welt - im Vergleich dazu wirkt sie in John Brunners "The Sheep Look Up" wie ein Naturschutzpark. Längst werden Epidemien und Umweltzerstörungen nicht mehr ursächlich behandelt, sondern nur noch eingedämmt. Die fortschreitende Parzellierung von N'AmPaz (also Nordamerika) in Sperrgebiete und Quarantänezonen ermöglicht rücksichtsloses Durchgreifen. Müssen 100.000 Menschen geopfert werden, um eine Million andere zu retten, wird dies ohne mit der Wimper zu zucken getan. Und das alles wohlgemerkt, noch bevor βehemoth die Szene betritt. Der für die Behörde BRIKS - allgemein nur Entropie-Patrouille genannt - arbeitende Achilles Desjardins ist einer, der Tag für Tag solche unmenschlichen Entscheidungen zu treffen hat - dank pharmakologischer Manipulation seines Gehirns bereitet ihm dies keinerlei Probleme. Weit weniger jedenfalls als Sou-Hon Perreault, die per Online-Verbindung Mechfliegen durch Katastrophengebiete steuert, wo Flüchtlinge gefüttert und mit in der Nahrung enthaltenen Drogen ruhig gestellt werden.
Der Biologismus wird in "Mahlstrom ("Maelstrom"; 2001) noch weiter getrieben als im Vorläuferband. Das Internet hat sich zu einer künstlichen Biosphäre, dem titelgebenden Mahlstrom, weiterentwickelt, in dem längst weit mehr als nur Viren und Würmer im täglichen Kampf um Überleben und Reproduktion stehen; vor allem Watts' Konzept einer Anemone wird im weiteren Geschehen eine bedeutende Rolle spielen. Die Parallelsetzung von Meeresleben und Internetfauna hat ihre absolut poetischen Seiten - etwa wenn mit nahezu denselben Worten, wie in Band 1 eine Qualle beschrieben wurde, die auf der Flucht Körperteile abstößt, nun geschildert wird, wie sich der Datenstrang "94" im Existenzkampf bewährt. - Deutlich weniger schön ist der Biologismus, wenn jede humanistische Sichtweise völlig zum Erliegen kommt. Die Schuld war ein Neurotransmitter und Moral eine chemische Verbindung. Jedes Gefühl ist genau auf der Aktivität eines bestimmten Gens verortet, lässt sich manipulieren ... und wird manipuliert. Statt Menschlichkeit herrscht kalte Regulierbarkeit, die Menschen selbst betrachten sich als biochemische Maschinen.
In all das platzt Lenie Clarke nun mit ihrer Virenlast ... und weiß nicht mehr, wie ihr geschieht. Gejagt von den Behörden muss sie auf ihrem selbstauferlegten Kreuzzug feststellen, dass sie nach ihren ersten Landgängen zum Mem geworden ist: Eine verzerrte Version Lenies geistert durch das globale Netz, und wohin immer sie ihren Fuß setzt, brandet ihr der Mythos von der Meerjungfrau und schließlich von der die Apokalypse verkörpernden Meltdown Madonna bereits entgegen. Achilles deutet das Massenphänomen als Ausdruck des kollektiven Unbewussten der Menschheit, welches Suizidgedanken hege - in Wahrheit steckt ein ganz anderes Kollektiv dahinter. Und Lenie wird einmal mehr zur tragischen Figur: Kämpft mit Visionen und Erinnerungsproblemen (die eine besonders zynische Ursache haben), lässt sich in aufwallendem Selbsthass vergewaltigen und attackiert vollkommen normale Vater-Tochter-Gespanne als vermeintliche Missbrauchsfälle, weil ihr ihre eigene Vergangenheit mit der Gegenwart durcheinander kommt.
Das eigentliche Thema von Band 2 ist wachsende Unübersichtlichkeit - das ist zwangsläufig nicht immer einfach mitzuverfolgen, wird von Watts aber gut gelöst; zumindest was die globale Ebene betrifft. Für Lenies Orientierungsverlust, der die äußere Welt widerspiegelt, gilt dies nur bedingt. Seelische Konflikte einmal beiseite geschoben: In welchem Ausmaß sich Lenie der Seuche, die sie verbreitet, und deren Auswirkungen bewusst ist, wird widersprüchlich dargestellt. So ganz scheint sich Watts da leider selber nicht im Klaren gewesen zu sein. Insgesamt macht dies "Mahlstrom" zum anspruchsvollsten, interessantesten, aber auch zum am wenigsten gelungenen Teil der Trilogie.
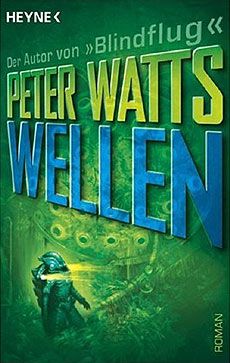
Peter Watts: "Wellen"
Broschiert, 688 Seiten, € 10,30, Heyne 2009.
Mit Teil 3 kehrt die "Rifters"-Trilogie dahin zurück, wo sie begonnen hat: ins Meer, wenn auch nicht ins selbe. Da der Vernichtungsfeldzug von βehemoth nicht gestoppt werden konnte, N'AmPaz und schließlich die ganze westliche Hemisphäre unter Quarantäne steht, haben sich die, die sich's leisten konnten, ins abgeschottete Habitat Atlantis am Mittelatlantischen Rücken zurückgezogen. Dort leben die inklusive ihrer Familien etwa 1.000 Menschen umfassenden Firmenbosse gleichsam umzingelt von den verbliebenen 60 Rifters: Lenie Clarke, Ken Lubin und ihren LeidensgenossInnen aus anderen ehemaligen Unterwasserprojekten. Seit fünf Jahren hält ein prekärer Waffenstillstand zwischen den beiden verfeindeten Gruppen - in der realen Welt sind zwischen dem Erscheinen von "Mahlstrom" und "Wellen" ("βehemoth: β-Max and Seppuku"; 2005) fast genauso viele Jahre verstrichen. Genug offenbar, dass aus Lenies ominöser Andeutung am Ende von "Mahlstrom", die Internetfauna könne die Welt retten, nicht mehr wurde als ein blindes Motiv. Jedenfalls wird am Beginn von "Wellen" darauf nicht mehr eingegangen: Ein weiteres Indiz dafür, dass "Mahlstrom" seinerzeit etwas aus dem Ruder gelaufen ist.
Und wir erleben die Teilrehabilitierung von Lenie Clarke: Sie hat nicht einfach eine Lebensform, die Milliarden Jahre lang sicher am Grunde des Ozeans schlummerte, in die Welt getragen - offenbar wurde bei einer früheren Unterwasserexpedition am Erbgut von βehemoth herumgepfuscht, was ihm erst seine verheerende Virulenz verlieh. Anscheinend wollte Peter Watts die Hauptfigur seiner Trilogie nachträglich in einem positiveren Licht erscheinen lassen. Doch reicht dies aus, um die de facto größte Massenmörderin der Geschichte sympathisch erscheinen zu lassen? Schwerlich, immerhin setzt sich die für jedes Maß und Ziel blinde Egozentrizität, mit der Lenie einst ihren Rachefeldzug gegen die böse Welt startete, nun in ebenso großer Wehleidigkeit darüber, was sie angerichtet hat, fort. Aber wer Menschen zum Mögen sucht, ist in den "Rifters"-Romanen ohnehin an der völlig falschen Stelle.
Niemand illustriert dies deutlicher als Achilles Desjardins, der Kämpfer wider die fortschreitende Entropie aus Band 2. Eine Arbeitskollegin hat ihn aus politischen Gründen von seinem biochemisch induzierten Schuldgefühl befreit und damit ein Monster freigelassen. Bittere Ironie: Während Lenie und die meisten anderen Rifter durch gefälschte Erinnerungen zu "Psychopathen" gemacht wurden, ist Achilles als solcher geboren - und nun, von der chemischen Fessel gelassen, lebt er dies aus. Achilles' Sadismus ist für Watts Anlass, noch einmal sein biologistisches Menschenbild darzulegen (was er im Nachwort noch einmal ausdrücklich rechtfertigt). Überhaupt fällt auf, dass Sex in der Trilogie stets im Kontext von Gewalt und Selbsthass steht: Selbst Geschlechtsverkehr in beiderseitigem Einverständnis war nichts als die Vergewaltigung eines Opfers, das aufgegeben hatte (wozu es im Nachwort keinen Kommentar gibt). Und eine elaborierte, wirklich ekelerregende Folterszene, die sich gegen Ende des Romans über einige Seiten erstreckt, hätte Watts sich und den LeserInnen durchaus ersparen können.
Doch zurück zur äußeren Handlung: Lenie und Ken steigen zurück an die Oberfläche in ein Nordamerika, das schon zur Hälfte den sterilisierenden Flammen überlassen wurde, und begegnen Taka Ouelette: Einer Ärztin, die mit ihrer mobilen Krankenstation durch die verelendeten Seuchenzonen klappert und wie ein Sinnbild des Niedergangs wirkt. Noch einmal werden Biosphäre und Datenwelt parallel geschaltet, denn auch in letzterer ist die Ödnis eingekehrt. Von der einst mannigfaltigen Internetfauna ist fast nichts mehr geblieben - nur noch als Lenies bezeichnete rabiate Programme fegen in zerstörerischem Wahnsinn durch die Leere. Und doch scheint es im verrottenden Unterholz der realen Welt auch neues Leben zu geben: Seltsame Unkräuter und Insekten, die irgendwie zuviele Beine haben, tauchen an immer mehr Orten auf. Vor diesem Hintergrund streben Lenie und Ken - plötzlich und ohne dass wir's so recht gemerkt haben in Sachen Weltenrettung unterwegs - einem Showdown entgegen, der in seiner hollywoodesken Konstellation Person-versus-Person für eine so komplexe Geschichte irgendwie simplifizierend wirkt. Andererseits nach 1.600 fordernden Seiten auch irgendwie befreiend.
Was bleibt nun von einem so monumentalen Werk wie der "Rifters"-Trilogie? Zunächst das lobenswerte Einbringen wissenschaftlicher Erkenntnisse. Im Anhang jedes der drei Romane führte Watts seine Quellen an, darunter zahlreiche damals topaktuelle Artikel aus Fachzeitschriften. Das bewegt sich auf einem etwas anspruchsvolleren Level als Frank Schätzing und spricht für echte Kenntnis der Materie. Aus der Verknüpfung unterschiedlicher Gebiete von der Biochemie bis zur Kybernetik erwächst ein überaus komplexes Gebilde - und Watts größte Leistung ist es, all dies in einem umfassenden Leitmotiv zusammenzuführen: dem Verlust von Kontrolle (seien es Gefühle und Triebe, sei es die Ökologie, die Entwicklung der Internet-Evolution oder im sozialen Kontext der zum Selbstläufer werdende Mythos von der Meltdown Madonna). Ein erstaunlich klar erkennbarer Roter Faden angesichts solcher Komplexität, dafür ein Bravo! Aber wir finden hier auch ein in seiner Kälte unsäglich deprimierendes Menschenbild vor. Was die Trilogie einiger erzählerischer Schwächen zum Trotz insgesamt zu einem sehr guten Werk macht. Und einem ziemlich unsympathischen.
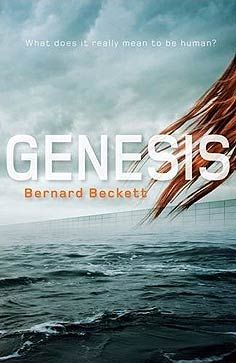
Bernard Beckett: "Genesis"
Gebundene Ausgabe, 208 Seiten, Quercus 2009.
Ein spannendes Referatsthema hat sich die junge Anaximander ausgesucht, um die Aufnahmeprüfung an der ehrwürdigen Academy zu bestehen: Leben und Tod des legendären Adam Forde (2058 - 2077), der die Struktur von Platos' Republic einst durcheinander wirbelte. Die Geschichte dieser Republik, die sich Mitte des 21. Jahrhunderts auf der Insel Aotearoa (=der Maori-Name für die neuseeländische Heimat des Autors Bernard Beckett) etablierte, erfahren wir aus Anaximanders historischem Abriss: Geboren aus den ökologischen und kriegerischen Wirren seiner Zeit, versuchte das Inselreich auf seine Art zu Stabilität zu finden. Change Equals Decay lautet der zentrale Lehrsatz. Und um Veränderungen zu verhindern, wurde eine Staatsform geschaffen, die sich tatsächlich am platonischen Staat, wie in der "Politeia" beschrieben, orientiert. Die Menschen werden - abhängig von ihrem Genom - in die vier Klassen der Philosophen, Techniker, Soldaten und Arbeiter eingeteilt, Männer und Frauen leben voneinander getrennt, Kinder werden nicht von ihren Eltern, sondern vom Staat aufgezogen. Und es ist ein verschärfter platonischer Staat: Der Great Sea Fence schottet das Land gegenüber der Außenwelt ab, sich nähernde Flugzeuge und Schiffe werden gesprengt, Flüchtlinge ausnahmslos erschossen. Zu Paaren eingeteilte Wachsoldaten müssen diese Politik durchsetzen: Einer schießt auf die Asylsuchenden, sein Partner zielt derweil auf seinen Hinterkopf.
Ein solcher Soldat war Adam - doch er lehnte sich auf: Erschoss statt dessen seinen Partner, als ein kleines Mädchen - später Eve genannt - an den Wall gespült wurde. Das klingt nach einem erwartbaren Story-Verlauf, aber nichts da: Eve beispielsweise wird daraufhin keinerlei Rolle mehr spielen, und was zunächst nach einem zeitlosen Szenario Individuum-versus-totalitäre-Gesellschaft à la Huxley oder Orwell aussah, nimmt einen völlig anderen Verlauf. Die regierenden Philosophen wissen nicht recht, was sie mit dem durch seinen Schauprozess populär gewordenen Adam anfangen sollen. So stellen sie ihn für ein Experiment, das einer von ihnen betreibt, ab: Adam wird zum "Companion" eines neuartigen künstlichen Wesens, das äußerlich einem Orang-Utan nachgebildet wurde und über Intelligenz verfügt: Art. - Ging es zuvor also um die Frage der Menschlichkeit unter moralischen Gesichtspunkten, so geht es nun eine Ebene tiefer. In ihren Gesprächen über Evolution, Persönlichkeit und Seele zerpflückt Art ein Argument Adams, wodurch sich ein Mensch grundlegend von einer künstlichen Intelligenz unterscheide, nach dem anderen. Was sich abwechselnd erhellend, erschreckend oder vergnüglich liest: "You're still just silicon." - "And you're just carbon. Since when has the periodic table been grounds for discrimination?"
Anders als bei Peter Watts, der auf die Frage des Menschseins einfache biochemische Antworten gibt, werden hier Fragen gestellt. Der Interpretationsrahmen ist dabei frei wählbar. Manche Komponenten des Romans erlauben religiöse Deutungen (die Paarung Adam & Eve etwa, der Buchtitel natürlich, und auch von einer Original Sin ist die Rede) - andere hingegen weltliche: Alle Figuren der Romangegenwart tragen die Namen griechischer Philosophen, zugleich ist das Frage-und-Antwortspiel (ob zwischen Adam und Art oder zwischen Anax und ihren Prüfern) gelebte Sokratische Methode. Überhaupt ist der gesamte Roman fast ausschließlich in Dialogen angelegt - Handlungssequenzen werden nur indirekt in Anaximanders Referat bzw. in Form einer holografischen Präsentation wiedergegeben. De facto verlassen wir nie die hermetische Situation der Kammer, in der Anax ihren drei Prüfern gegenüber steht. Das führt trotz der etwas abstrakten Atmosphäre zu eminenter Spannung: Vordergründig wegen der Frage, ob Anax ihre Prüfung bestehen wird - noch viel mehr aber deshalb, weil man sich zu fragen beginnt, was eigentlich aus dieser Republik der Vergangenheit geworden ist bzw. auf welchem Stand sich die Gesellschaft der Romangegenwart befindet. So langsam dämmert einem dabei, dass "Genesis" auf eine Pointe - und möglicherweise eine böse - hinauslaufen könnte. Doch wird es mehr als nur eine geben. Und siehe da: Obwohl "Genesis" beim Lesen wesentlich weniger Zeit in Anspruch nimmt als so manches detailversessene hypertrophe Romanungeheuer, wie auch in dieser Rundschau einige vertreten sind, wirkt es im Anschluss dafür umso länger nach. Große Empfehlung!
P.S.: Man sollte englischsprachige Bücher nicht zu lange herumliegen lassen, sonst kommt einem womöglich eine Übersetzung zuvor. "Genesis" ist in Großbritannien zwar erst 2009 erschienen, wurde in Neuseeland aber schon 2006 veröffentlicht - und liegt seit September auch in einer deutschsprachigen Version vor. Trotz des philosophischen Themas ist beim Lesen des Originals übrigens kein Wörterbuch notwendig - wer es dennoch lieber auf Deutsch hätte: Der Roman ist unter dem Titel "Das neue Buch Genesis" beim Verlag Script5 erschienen.
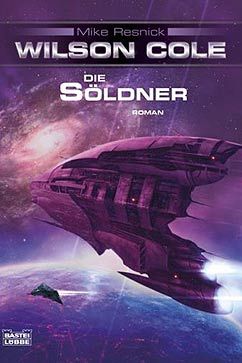
Mike Resnick: "Die Söldner"
Broschiert, 366 Seiten, € 8,20, Bastei Lübbe 2009.
Mögen andere AutorInnen sich mit Nanotechnologie, in Cyber-Klone downgeloadeten Bewusstseinskopien und posthumanen Szenarien abrackern - der 1942 geborene Amerikaner Mike Resnick gehört noch zur alten Schule. Da wird noch per Wurmloch schneller durch die Galaxis gedüst als mit der U-Bahn durch eine Stadt und in jeder Schiffskabine lässt sich die Schwerkraft nach Belieben regulieren wie der Dimmer der Deckenbeleuchtung. Und auch wenn wir uns 3.000 Jahre in der Zukunft befinden, tauchen Wörter wie Gehaltsscheck oder Autopilot auf.
"Die Söldner" ("Starship: Mercenary") dreht sich um die Abenteuer von Captain Wilson Cole und seines alten Äppelkahns "Theodore Roosevelt" - als ausgemustertes Kriegsschiff der Republik ist sie allerdings technologisch immer noch allem überlegen, was sonst so in der gesetzlosen Zone der Inneren Grenze zum Milchstraßenzentrum herumkurvt. Cole und seine multiethnisch zusammengesetzte Crew (inklusive Außerirdischen-Quote) verdingen sich seit einiger Zeit als Söldner. Zuvor hatten sie aus politischen Gründen der durchaus skrupellos agierenden Republik abgeschworen und auch ein Zwischenspiel als interstellare Piraten absolviert - geschildert wird dies in den bereits erschienenen Romanen "Die Meuterer" und "Die Piraten"; Verständnisprobleme mangels Vorwissen wird der aktuelle Roman dennoch keine aufwerfen. Und natürlich sind es Söldner im Dienst der guten Sache: Der Reihe nach knöpft man sich einige Schurken vor, die allesamt ausgetrickst werden. Das ist - analog zu schablonenhaft festgelegten Charakteren wie der Zwei-Meter-Walküre Walli mit dem Finger am Dauerabzug - recht simpel gestrickt und von der weidlich bekannten Mentalität geprägt: Die Jungs gehen rein und holen die Kastanien aus dem Feuer; denen kann keiner.
Zum Ausgleich lockert der für seine Erzählungen mehrfach mit dem "Hugo" ausgezeichnete Autor das Ganze mit Witz und Ironie auf. Gefördert nicht zuletzt dadurch, dass sich wesentliche Anteile des Romans in Dialogform und damit Wortgefechten abspielen. Es gibt Vorbereitungen und Nachbetrachtungen - die eigentliche Durchführung der Missionen wird dann in ein paar Sätzen abgehandelt, als wär's ein Epilog (bzw. ein Epitaph für die erledigten Schurken). Das hat fast etwas von klassischem Theater. Als Running Gag zieht sich der Umstand durch den Roman, dass sich - was Cole manchmal den letzten Nerv raubt - an der Inneren Grenze jeder "Künstlernamen" wie Hammerhai, der Blaue Teufel oder Dschinghis Khan bedient. Das wird bis in absurde Dimensionen getrieben: Ein Dickens-versessener Außerirdischer in Coles Crew benennt nicht nur sich selbst, sondern auch seine KollegInnen nach entsprechenden Romancharakteren. Und mit den Thuggees hat sich gleich ein ganzes Alien-Volk kurzerhand umbenannt, um indischstämmige Menschen-Immigranten abzuschrecken. Alles in allem saust man da so durch und hat auch bei halber Konzentration keine Mühe dem Geschehen zu folgen. - Fast interessanter als der Roman selbst sind dann die Appendizes, in denen die Einordnung der Romanhandlung in Resnicks Birthright-Universum erfolgt, das er ab den 70ern entwickelte: Eine 20.000 Jahre umfassende Zukunftshistorie von der Eroberung des Alls bis zum Untergang der Menschheit. Unter anderem ist im Anhang auch eine Grundrisszeichnung des Casinos enthalten, das in "Die Söldner" eine Rolle spielt: Ein unwichtiges Gimmick zwar, aber irgendwie ein sympathisches - ein wenig so, als käme es aus einem Jugendzimmer, wo Teenager einander stolz ihre SF-Entwürfe unter die Nase halten.
Apropos altmodisch: In der Anfangszeit dieser Rubrik gab's gelegentliches Gemosere über gegenderte Schreibweisen. Aber der Weisheit letzter Schluss kann auch eine Übersetzung à la [...], sagte der Dritte Offizier nicht sein, wenn "der" sich kurz darauf als Frau entpuppt. - Insgesamt wirkt "Die Söldner" wie ein netter Gruß aus einem anderen Zeitalter. Nicht notwendigerweise einem, das drei Jahrtausende in der Zukunft liegt.
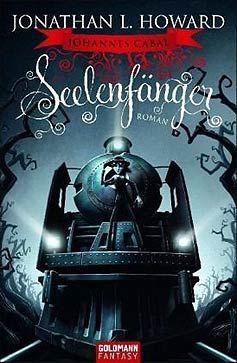
Jonathan L. Howard: "Johannes Cabal, Seelenfänger"
Broschiert, 378 Seiten, € 12,40, Goldmann 2009.
Wer hätte gedacht, dass es schwerer ist in die Hölle zu kommen als in die USA? Jedenfalls sieht der aktuelle Einreisemodus gemäß Vorläufigem Aufnahmeantrag für den Hades - Formblatt (AAAA/342) erst mal die Beantwortung einiger tausend Fragen vor. Auszufüllen nackt unter der niemals versinkenden Wüstensonne der Vorhölle. - Außer man nimmt eine Abkürzung wie Johannes Cabal, der schon in der Eröffnungsszene mit einem Dämon die Modalitäten einer korrekten Beschwörung diskutierte und in den Wind schoss. Die kannte eh nicht mal der Beschworene selbst so genau.
Und Cabal ist gekommen, um sich zu beschweren: Vor Jahren ging er mit dem Satan einen faustischen Pakt ein und verschrieb ihm seine Seele, um nekromantisches Wissen zu erlangen. Doch musste er feststellen, dass die Seelenlosigkeit seine Forschungsergebnisse verzerrt - ein neuer Deal muss also her. Und wie das beim Fürsten der Hölle so ist: Verhandlungen laufen nur über eine Wette. 100 Seelen muss Cabal dem Satan innerhalb eines Jahres beschaffen, dann erhält er seine eigene zurück. Für die dafür benötigte Infrastruktur kramt Satan gnädigerweise ein altes Schubladenprojekt der Hölle hervor, den Jahrmarkt der Zwietracht. Cabal wird ein monströser Zug anvertraut, mit dem er fortan durch die englische Provinz tuckert, um die geheimen Gelüste der Menschen zu wecken und gegen sie zu verwenden. Die Utensilien zum Aufbau der Rummelplatz-Attraktionen sind in den Waggons verladen - inklusive menschlicher Knochen, Haut und Haare, woraus Nekromant Cabal die Jahrmarktsbelegschaft ins "Leben" ruft. Eine weitere Reanimation, die sich als wichtig erweisen wird, führt Cabal ohne Satans logistische Nachhilfe durch: Und zwar an seinem Bruder Horst, den er einst in einer Gruft seinem Schicksal überließ. Zum Vampir geworden, ist Horst dennoch Humanist geblieben - und wird sich in der Folge bemühen, die schlimmsten Auswüchse von Johannes' rücksichtsloser Seelensafari in Grenzen zu halten.
Und solche Milderung wird dringend gebraucht, denn Johannes ist kein von Beginn an sympathischer Held: Misanthrop und mehrfacher Mörder, "teutonisch" (beide Brüder tragen auch im Original deutsche Namen), hochmütig und verdrießlich - und vor allem egomanisch seinem großen Ziel verschrieben, für das der Seelenfang nur eine notwendige Zwischenetappe darstellt und von dem wir erst ganz am Ende erfahren werden. Im Verlauf der schwarzhumorigen Episoden - vom Duell gegen einen Lovecraft-Hexer, der Cabal in ein Taschenuniversum verbannt, über satanische Sabotage bis zu einem Gefängnisausbruch mit einer ganzen Liste höchst skurriler Mordbuben - zeigt Johannes durchaus unterschiedliche Gesichter. Ein unerwartet menschliches sogar in der Begegnung mit dem Geist eines Weltkriegssoldaten - verglichen mit seinem skrupellosen Vorgehen, als er eine verzweifelte Mutter zum Kindsmord anstiftet (auch wenn ihn dafür später das Gewissen drücken wird): Möglicherweise ein Hinweis darauf, dass das Romanprojekt nicht nur auf einer Kurzgeschichte ("Johannes Cabal & the Blustery Day") aufbaut, sondern dass da auch noch einige andere Ideen herumlagen, die nun in Episodenform ins größere Format eingeflossen sind. Ein paar davon recht lose verbunden - insgesamt bildet der Roman aber einen schönen Handlungsbogen.
Der in Großbritannien lebende Jonathan L. Howard war bislang vor allem im Bereich Computerspiele tätig - da wäre der Phantastik fast ein talentierter Autor durch die Lappen gegangen. Howard orientiert sich in der Art seines Humors unverkennbar an Terry Pratchett - aber das tun viele, und nur wenige kriegen es hin. Im "Seelenfänger" (im Original: "Johannes Cabal the Necromancer") wimmelt es nur so vor Situationskomik, Wortwitz, Anspielungen, augenzwinkernder Reflexion genretypischer Motive (etwa wenn Vampir Horst Johannes vor dem Biss fragt, ob ihn der "homoerotische Aspekt" störe) und Gags aller Art. Nicht zuletzt auch vor griffigen bildlichen Beschreibungen, etwa eines verkrüppelten Baumes, der eine Ulme gewesen sein mochte, ehe man ihn regelmäßig mit LSD gedüngt hatte, oder des furchteinflößend scheußlichen Lächelns Cabals, das über sein Gesicht huscht wie ein Melanom in Zeitraffer. - Das einzige, was noch fehlt - und die Covergestaltung scheint diese Forderung ebenfalls zu suggerieren -, ist eine Verfilmung durch Tim Burton. Erst mal aber schreibt Howard am zweiten Band - Vorfreude ist angebracht!
... vielleicht auch auf die nächste Rundschau, aber das wird sich erst beim Lesen zeigen: Wenn wir unter anderem die USA von der Erdoberfläche verschwinden lassen und mit freundlichem Argwohn betrachten, wie sich Kultregisseur Guillermo del Toro als Romanautor macht. (Josefson)