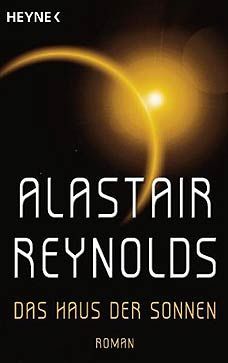
Alastair Reynolds: "Das Haus der Sonnen"
Broschiert, 702 Seiten, € 10,30, Heyne 2009.
Einen brandneuen Reynolds in die Finger zu bekommen sorgt in etwa für gleich viel Vorfreude wie bei einem Stephen Baxter (hatten wir kürzlich) oder Robert Charles Wilson (ist nächsten Monat dran). In "House of Suns" - im Original 2008 erschienen - scheint der walisische Star-Autor extra angetreten zu sein, um das alte Sprichwort "Small is beautiful" komplettemang in den Wind zu schießen und dafür Arthur C. Clarkes berühmten Satz "Jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden" zu illustrieren. Und zwar prall.
Schon der Eröffnungssatz stimmt darauf ein, dass sich "Das Haus der Sonnen" in großen Maßstäben abspielen und Science Fiction mit Fantasy-haften Zügen anreichern wird. Zu Wort kommt das Mädchen Abigail Gentian aus dem Reich der Goldenen Stunde - wobei "Mädchen" relativ ist, denn Abigails Kindheit wurde künstlich auf 30 Jahre verlängert. In einem denkenden und sich ständig wandelnden Haus mit unzähligen Räumen lebt sie auf einem Planetoiden und wird gelegentlich von einem Spielgefährten besucht, der mit seinem Privat-Shuttle einschwebt: Der Kleine Prinz und die Kleine Prinzessin gewissermaßen, ErbInnen zweier Konzerne. Wir schreiben das 31. Jahrhundert - und schon wird im nächsten Kapitel sechs Millionen Jahre in die Zukunft geblendet, wo zwei weitere Hautpfiguren des Romans leben. Auch hier ist der erste Eindruck ein märchenhafter, denn diese beiden - Portula und Campion, Angehörige des Hauses der Blumen (=die Familie Gentian) - stehen gerade in Verhandlungen mit waschechten Zentauren, deren Welt sie mit einem Sternendamm schützen. Andere Häuser beherrschen andere Methoden des Sternenmanagements, bewegen Planeten aus Gefahrenzonen oder entflammen gealterte Sonnen aufs Neue. Die Gentians aber haben sich auf eine besondere Form des Recyclings spezialisiert: Sie sammeln die Hinterlassenschaften einer vergangenen Zivilisation - ringförmige Teile von Dysonsphären, die auf der Innenseite mit idealen Spiegeln ausgekleidet sind - und gruppieren sie als kugelförmige Käfige um rabiat gewordene Sterne. Selbst bauen könnten sie solche Artefakte allerdings nicht - das schafften nur die unbekannten Früheren, die längst verschwunden sind. Genauso wie die ganze Andromeda-Galaxie übrigens, die nur einen Absenz genannten dunklen Fleck am Himmel hinterlassen hat. - Gekleckert hat Reynolds hier also nicht, sondern monumental geklotzt.
Der historische Hintergrund ist der folgende: Abigail wie auch einige andere Superreiche des 31. Jahrhunderts wurden geklont, ihre Erinnerungen auf jeweils 1.000 Splitterlinge beiderlei Geschlechts aufgeteilt. Auch Abigail selbst mischte sich unter ihre Tausendschaft - doch spielt es längst keine Rolle mehr, wer das "Original" war, da die Splitterlinge ihre Erinnerungsstränge fortwährend miteinander tauschen. Das ist nebenbei bemerkt ein netter Trick, mit dem Alastair Reynolds seine begrenzte Fertigkeit, individuelle Persönlichkeiten zu schildern, verschleiern kann - und eine plausible Erklärung dafür, warum die abwechselnd aus Portulas und Campions Ich-Perspektive geschilderten Kapitel voneinander kaum unterscheidbar sind.
Warum die Splitterlinge quasi-unsterblich sein sollen, wird zwar leider nicht befriedigend geklärt - doch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, machen den Hauptreiz des Romans aus. Denn die in der Körperschaft zusammengefassten Häuser bilden eine Meta-Zivilisation, die Jahrmillionen überdauert hat, während rings um sie unzählige Wandelzivilisationen der Menschen innerhalb von wenigen zehntausend Jahren aufblühen und wieder vergehen. (Dass es in der Milchstraße keine Aliens gibt, spielt angesichts der exotischen Vielfalt der körperlich oft stark modifizierten Menschennachkommen keine Rolle - siehe etwa die Zentauren oder die riesenhaften Informationssammler der Vigilanz, mit denen man kommuniziert, indem man sich von ihnen verschlucken lässt.) Für die Häuser sind dies so kurze Zeitspannen, dass sie ein Universales Aktuar eingerichtet haben, das die Wahrscheinlichkeit berechnet, ob eine bekannte Zivilisation zum Zeitpunkt, da ein Körperschaftsraumschiff dort eintrifft, überhaupt noch existiert. Denn - und hier ist "Das Haus der Sonnen" ganz Hard-SF - die Lichtmauer konnte nie durchbrochen werden, weder per Raumschiff noch per Kommunikationssignal. Die weitaus meiste Zeit ihres Lebens verbringen Splitterlinge daher in einer Form von Stasis, während ihre Raumschiffe knapp unter Lichtgeschwindigkeit durch eine sich wandelnde Milchstraße reisen. Zwangsläufig leben sie in einer eigenen, völlig entrückten Kontinuität, für die die hastige Außenwelt kaum mehr als eine Kulisse ist. Sie ehren zu Tode gekommene Körperschaftsmitglieder, indem sie die Gasschwaden einer verwehenden Supernova zu deren Gesichtern modellieren, und sehen ihren Status abgeklärt, doch ohne falsche Bescheidenheit: Ganze Zivilisationen hatten ihre Existenz unseren gottgleichen Taten zu verdanken, die unbezeugt waren und in niemandes Gedächtnis verankert. - Es ist schwer zu sagen, ob eine derart aus dem menschlichen Horizont herausgehobene Perspektive überhaupt glaubhaft geschildert werden kann, aber Reynolds gibt sich wirklich alle Mühe.
Alle 200.000 Jahre treffen sich die Gentians zum Austausch von Erinnerungen auf irgendeinem Planeten - aber diesmal kommt es anders: Unbekannte Angreifer löschen fast die komplette Familie mitsamt dem betreffenden Sonnensystem aus, ganze 52 Gentians können sich auf einen Ausweichplaneten retten. In dessen Beschreibung läuft Reynolds Ideenreichtum noch einmal zur Hochform auf: Die aktuellen Bewohner Neumers haben ihre Bauten auf den gigantischen Türmen einer vergangenen Wandelzivilisation errichtet, der Planet ist von einem Orbitalring aus einer dritten Ära umgeben, die Dünen der Neumer'schen Wüsten bestehen aus dem Staub einer vierten und eine Luftgeist genannte posthumane Entität aus fernster Vergangenheit kontrolliert die Atmosphäre. Hinterlassenschaften versunkener Hochkulturen werden in Science Fiction-Romanen ja gerne eingestreut - hier aber sind sie selbstverständlicher Teil planetarer Topografien, was in dem hier geschilderten Ausmaß ziemlich einzigartig ist. Die Gentians freilich kommen wenig zum touristischen Staunen: Sie müssen vielmehr rätseln, wer sie angegriffen hat und ob es unter ihnen Verräter gibt. - Zum Sense of Wonder gesellt sich damit ein klassischer Whodunnit-Plot auf makrokosmischer Ebene, und am Ende wird nicht nur geklärt werden, was es mit dem geheimnisvollen Haus der Sonnen, das es in der Körperschaft gar nicht gibt, auf sich hat, sondern auch was mit Andromeda geschehen ist. Faszinierend!
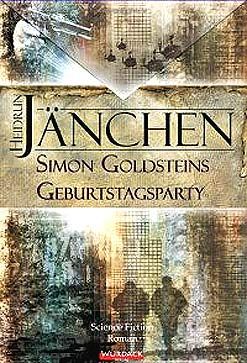
Heidrun Jänchen: "Simon Goldsteins Geburtstagsparty"
Broschiert, 278 Seiten, Wurdack 2008.
"Eine Bombe in die Lichterkette, und die Volksmeinung kippt." – Was da als beiläufiger Satz in einer Ressortleiterbesprechung fällt, bringt die Handlung von "Simon Goldsteins Geburtstagsparty" auf den Punkt: Der Roman der deutschen Autorin und Physikerin Heidrun Jänchen dreht sich um Ereignisse – ob reale oder virtuelle – und wie sie geschaffen, berichterstattet und mit dem passenden Spin versehen werden, um die allgemeine Meinungslage zu beeinflussen; Ereignisse von meist explosiver Natur. – Terrorismus, Verschwörungstheorien und Manipulation der "Wirklichkeit" in der nahen Zukunft – eine sehr ähnliche Mischung servierte Ken MacLeod mit dem zeitgleich entstandenen "The Execution Channel". Allerdings führte der schottische Autor sein Publikum gezielt an der Nase herum: Da wurde, was zunächst ein klares Post-9/11-Szenario zu sein schien, unversehens zur Alternativweltgeschichte, und das Ende erinnerte dann eher an James Blish als an Cyberpunk. Jänchen hingegen bleibt dem eingangs eingeschlagenen Pfad treu und schreitet ihn weiter, ohne das Genre zu wechseln.
Alle ProtagonistInnen sind auf ihre ganz eigene Weise an der Produktion und Verarbeitung von Ereignissen beteiligt: John Dove, ein neurotischer Terrorist mit einem ganzen Bündel psychosomatischer Beschwerden, schafft sie – wenn auch unwillig und auf Anweisung eines obskuren Auftraggebers, der ihn aus der Ferne biometrisch überwacht. Fiana O'Nolan, eine irische Reporterin des European News Service, berichtet darüber – ganz dem Ethos des investigativen Journalismus verhaftet; nur ihre Nachforschungen zur angeblichen Ermordung des EU-Präsidenten hätte sie besser gelassen. Und dann ist da schließlich Frank Böttger, der im deutschen Institut für Medienforschung für die technische Umsetzung medienpolitischer Strategien sorgt. Denn hier wird nicht nur nach Mustern im globalen Kommunikationsaufkommen gesucht, diese sollen auch – etwa mit Mail-Schwemmen oder der Einrichtung und Verlinkung von Websites – gesteuert werden: Nigeria hat biologische Waffen eingesetzt? Ist außenpolitisch nicht opportun – stellen wir's als Hoax dar. Die Amerikaner forschen an Zeitreisen? Machen wir sie lächerlich. – Böttger war auch daran beteiligt, den realen (und erfolgreichen) Anschlag auf Präsident Giraux durch ein geschickt lanciertes Fake-Attentat zu vernebeln – und dieses Ereignis wird es auch sein, das alle Hauptfiguren zusammenführt. – Die Erlebnisse einer weiteren Figur laufen davon zunächst unabhängig: Jeremiah, ein 13-jähriger Junge aus einem nicht genannten Land, der sich aus einer abgeschotteten Christensiedlung in die große Stadt aufmacht. Auch er wird sich am Ende aber in die Haupthandlung einfügen; zumindest zum Teil ...
Jänchen entwirft eine Welt des 21. Jahrhunderts, in der die USA zu einem Gottesstaat geworden sind (ein gerne verwendetes Motiv europäischer AutorInnen, mit mehr oder weniger deutlicher Häme eingesetzt), während diesseits des Atlantiks das "Europa der zwei Geschwindigkeiten" Realität geworden ist und eine Innere Europäische Union einem Konkurrenzgebilde gegenübersteht: Auflösungserscheinungen, die sich auf staatlicher Ebene fortsetzen – wie in Spanien, das in Kastilien und Katalonien zerfallen ist. Für die gesellschaftliche Entwicklung hat Jänchen die Trends der Gegenwart auf die Jahrhundertmitte projiziert: Statt Jugendbanden treiben hier Gangs von Rentnern ihr Unwesen, die mit dem Web aufgewachsen und entsprechend ausgefuchst sind. Die fortschreitende Automatisierung macht Arbeitsplätze zu einem kostbaren Gut – und ganz der Logik einer komplex vernetzten Welt entsprechend verteilt mitten in einer Protest-Demo die mausige Éloïse Flugzettel, auf denen sie die Abspaltung des muslimischen West-China propagiert. Schließlich hat China ihren Arbeitsplatz gefressen – herrscht dort erst mal Bürgerkrieg, werden die Firmen schon wieder abziehen ... – Verschwörungstheorien und paranoide Gedanken aller Art blühen in dieser unübersichtlich gewordenen Welt und ziehen sich auf allen Ebenen durch den Roman. John beispielsweise sorgt sich nach Durchführung eines Bombenattentats, weil sein Magen keinen Alkohol verträgt ("Die Leute achten auf Antialkoholiker, denn jeder von ihnen könnte ein islamischer Terrorist sein."), und die Mondlandung ist längst als Hoax erwiesen; man hat's ja schon immer gewusst.
Auf der Haben-Seite des Romans (und die überwiegt eindeutig) ist ganz klar der Stil zu verzeichnen – vor allem die präzise Sprache und Begriffsverwendung, von der sich so manche AutorInnen eine Scheibe abschneiden könnten. Im Soll steht manchmal die Logik: Des öfteren treffen rein zufällig Figuren aufeinander, zwischen deren Leben es mehr Querverbindungen gibt, als sie zunächst ahnen. Und der Übergang vom ursprünglichen Handlungsbogen zu einem zweiten – nichts weniger als der Ausarbeitung des größten Hoax aller Zeiten, Projekttitel: "Simon Goldsteins Geburtstagsparty" – lässt den Roman in zwei Teile zerfallen. Vor allem aber stellt sich dabei die Frage, warum die Beteiligten so sicher sind, dass die Inszenierung einer virtuellen globalen Katastrophe nicht zu Chaos, sondern zu einem konstruktiven Ergebnis führen wird. Manches bleibt ungesagt. Das ist ein hervorragender stilistischer Kniff, wenn Jänchen beispielsweise nicht plump einen Satz wie "Wegen der geschwundenen Erdölreserven wurde der Flugzeugverkehr weitgehend eingestellt" schreibt, sondern schildert, wie die ProtagonistInnen mit Luftschiff, Transatlantik-Fähre und Eisenbahn unterwegs sind, und so den Leser langsam selber den Hintergrund kombinieren lässt. Dafür würde man sich an mancher Stelle explizite Aussagen wünschen, wo es um die persönlichen Hintergründe der Hauptfiguren geht; so mancher Strippenzieher bleibt da im Dunkeln. – Teilabstriche also an einem Roman, der insgesamt jedoch erfreulich intelligent ist. Und spannend obendrein.

Jay Amory: "Die Welt in den Wolken"
Broschiert, 446 Seiten, € 9,20, Blanvalet 2009.
What if our world is their heaven? hätte sich als einleitendes Zitat über Jay Amorys Roman (Originaltitel: "The Fledging Of Az Gabrielson"), dem ersten aus dem Zyklus "The Clouded World", gut gemacht. Passend jedenfalls zur Handlung, wenn auch nicht in Sachen literarischen Gewichts. Mit Philip K. Dick kann Amory, ein Pseudonym des britischen Autors James Lovegrove, der sich hier primär an ein junges Publikum wendet, natürlich nicht mithalten - andererseits scheuen sich andere Autoren auch nicht, Kaliber wie Tolstoi im Epilog heraufzubeschwören ...
Im Zeitalter nach der Großen Katastrophe leben die Nachkommen derer, die sich in die Troposphäre retten konnten, als geflügelte Luftlinge in Himmelsstädten, die auf kilometerhohen Betonsäulen ruhen. Lastenaufzüge liefern den BürgerInnen alle benötigten Rohstoffe von der Oberfläche, von der sie durch eine für das Auge undurchdringliche Wolkenschicht getrennt sind; darunter sind nach offizieller Lesart nur noch Maschinen im Einsatz, die Erdlinge gelten als ausgestorben. - Umso bunter das Leben in den Himmelsstädten, ein Ambiente, das ein wenig an die alte Cartoon-Serie "The Jetsons" erinnert (nur eben mit Flügeln statt Jet-Packs auf dem Rücken). Man gondelt in Luftschiffen zwischen Städten, die einander in ihrer atemberaubenden Himmelsarchitektur übertreffen, macht Zwischenstopp bei einer als Schneeflocke geformten schwebenden Tankstelle oder spachtelt Schwanensteaks - das hat schon was und hätte durchaus noch ausgebaut werden können. Es ist schon ein wenig paradox: Da gibt es AutorInnen zuhauf, die Seite für Seite in opulenten Beschreibungen standardisierter Fantasy-Welten waten. Und hier hat jemand eine deutlich originellere Setting-Idee, hüpft dafür aber nur wie ein Kiesel übers Wasser. Dass es sich bei der "Welt in den Wolken" trotz zahlreichen Maschineneinsatzes und der post-apokalyptischen Historie um Fantasy handelt, liegt an der gleichermaßen unmöglichen Statik der Städte und Physiologie ihrer BewohnerInnen - aber nicht nur.
Fantasy-typisch setzt sich nämlich auch der Plot in Gang: Ausgerechnet ein Außenseiter, der flügellos geborene 16-jährige Az, wird dazu ausersehen, seine Welt zu retten: Azrael Gabrielson, das Volk der Luftlinge braucht deine Hilfe, tritt man von höchster Stelle an ihn heran. Dass man just einen Flügellosen hinab zur Erdoberfläche schickt, hat seinen Grund: Denn natürlich sind die Erdlinge nicht augestorben, und Az kann sich unter ihnen etwas unauffälliger bewegen. - Am Boden reichert sich die Geschichte um eine Dimension an: Hier hausen die Erdlinge im Elend, unter ihnen die Teenagerin Cassie und ihre Familie von Düsterspähern. Im Familienpanzer "Gackernde Bertha" kurven sie durch das ewige Zwielicht einer verseuchten Welt, um Gegenstände, die aus den Städten zu Boden gefallen sind, aufzusammeln. Das Vikariat, die religiöse Quasi-Regierung der Erdlinge, betrachtet sämtliche Artefakte als "heilig" und hat eine ganze Mythologie rund um den Himmel und dessen BewohnerInnen entwickelt. Die Bewegung der Humanisten kämpft dagegen an - eine ideologische Konfliktlinie, die sich auch durch Cassies Familie zieht. Und wenn einer ihrer Brüder über das Privileg, in jemandes Mülltonne zu leben, ätzt, hat man endgültig die anfänglichen Eloi-und-Morlocks-Assoziationen beiseite gelegt und fühlt sich statt dessen unbequem an die ungleichen Wirtschaftsbeziehungen von Erster und Dritter Welt erinnert.
Problematisch ist allerdings, wie sich Amory an die Bewältigung der fundamentalen sozialen und psychischen Konflikte macht - abzulesen unter anderem daran, welche der Figuren in einer weitgehend jugendfreien Handung, in der viel gerauft und kaum getötet wird, doch noch das Zeitliche segnen müssen. Es darf bezweifelt werden, dass Amory es absichtlich auf eine zynische Handlungsentwicklung angelegt hat beziehungsweise dass ihm überhaupt bewusst war, wie zynisch sein vorläufiges Happy End eigentlich ist. - Ein Gedankenspiel: Packen wir ein paar Leute aus einem umweltverseuchten afrikanischen Bürgerkriegsgebiet in einen Reisebus, machen mit ihnen eine Rundfahrt durch die schönsten Einkaufspassagen Europas - aber bitte nur anschauen, nichts berühren! - und schicken sie mit der Botschaft nach Hause: "Seht ihr, wir sind hier auch nur Menschen. Wir führen bloß ein viel schöneres Leben als ihr." Also wenn das nicht der Weg zu Weltfriede, Freude, Eierkuchen ist, was dann?
Am Ende des Tages bleibt eine fantasievoll erdachte Welt - wer an ihr und ihren schäbigen Fundamenten Gefallen gefunden hat, kann sie im nächsten Jahr wieder aufsuchen, wenn Teil 2, "Piraten der Lüfte" ("Pirates of the Relentless Desert") erscheint. Insgesamt umfasst die Reihe "The Clouded World" bislang vier Teile.
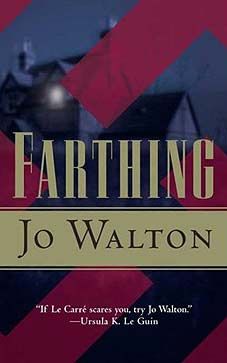
Jo Walton: "Farthing"
Broschiert, 336 Seiten, Tor Books 2007.
Auf leisen Sohlen schleicht das Grauen - und zwar politisches, kein metaphysisches - in eine Geschichte ein, die als klassisch britische Country House Murder Mystery beginnt. Erwischt hat es diesmal den hochrangigen Politiker Sir James Thirkie, dessen Leichnam im Haus des befreundeten Lord Eversley aufgefunden wird; mit einem Dolch wurde ihm ein Davidstern auf die Brust gepinnt. Bald darauf wird sich allerdings zeigen, dass die eigentliche Todesursache pikanterweise Vergasung war.
Das Szenario
Wir schreiben den Mai 1949 - acht Jahre nachdem das Empire auf den Heß-Plan eingestiegen ist und mit Nazi-Deutschland den Peace of Honour geschlossen hat. England fielen dadurch die ehemals französischen Kolonien in Nordafrika zu, Hitler beherrscht das Festland - während sich die USA unter ihrem Präsidenten Lindbergh aus den europäischen Konflikten heraushalten und erste zarte Bande zum japanischen Kaiserreich knüpfen.
Eingefädelt hat den Frieden seinerzeit das sogenannte Farthing Set, ein Kreis von Adeligen, dem Thirkie ebenso angehörte wie Lord und Lady Eversley vom namensgebenden Anwesen Farthing. Dass ihre Tochter Lucy den Juden David geheiratet hat und nun eine "Mrs. Kahn" ist, schmeckt vor allem der Mutter, einer bis ins aristokratische Mark zivilisierten Bestie, überhaupt nicht.
Upstairs, downstairs
Die Kluft zwischen Oben und Unten bzw. Dazugehörend und Draußen zieht sich in vielfältiger Weise durch den Roman. Lucy etwa findet ein poetisches Bild für die "Symbiose" ihrer Mutter mit deren Sekretärin, einer mittellosen Verwandten: They're like a swan: Mummy's the part on top of the water gliding along effortlessly and Sukey's the part below the water kicking frantically. Weniger "schön" klingt es, wenn die eigentlich sehr sympathische Lucy gedankenlos dasselbe, nur auf Jagdbeute anwendbare, Wort für "töten" verwendet wie ihr Vater, nachdem der einen angeblichen Bolschewiken auf seinem Anwesen erschossen hat.
Inspector Carmichael von Scotland Yard, der den hochbrisanten Fall aufklären soll, registriert derartige verbale Entlarvungen sehr genau - wie auch die tiefverwurzelte Unterwürfigkeit der lokalen Polizei, die von der Unschuld der adeligen Herrschaften vorauseilend überzeugt sind.
There's a new wind blowing, and it's gonna be a cold, cold one
Jo Walton erzählt "Farthing" abwechselnd aus Lucys und Carmichaels Sicht: Bei Lucy aus der Ich-Perspektive, wobei sich Lucys sprunghaftes und - noch - relativ unbeschwertes Wesen darin widerspiegelt, dass ihr Bericht immer wieder in nebensächliche Betrachtungen und Erinnerungen abschweift, was sie auf indirekte Weise sehr gut charakterisiert. Bei Carmichael hingegen wählte Walton die dritte Person, vielleicht um seine analytischere Sicht zu illustrieren. Auch von seinem Innenleben erfahren wir aber einiges: Nicht nur dass die satte, grüne, befriedete Landschaft von Hampshire heimliche Wünsche nach einer Barbaren-Invasion in ihm aufsteigen lässt.
Auch dass sein Schwulsein - in Lucys kindlicher Code-Sprache ist er Athenian - für ihn vorerst keine große Sache ist. Aber die Dinge in England ändern sich, und "Farthing" wird sich letztlich darum drehen, wie die ProtagonistInnen auf den Wandel des gesellschaftlichen Klimas reagieren werden.
Subtil und wie am Rande sind von Anfang an Informationssplitter eingebaut, dass Großbritannien längst nicht mehr die leuchtende Antithese zum kontinentalen Faschismus ist: Ein Arbeiter sitzt im Gefängnis, weil er eine Gewerkschaft gründete; die Pflichtschulzeit für Kinder wird verkürzt, um sie früher auf den Arbeitsmarkt zu entlassen; die Polizei wendet von den Nazis übernommene Verhörmethoden an und antisemitische Kommentare werden salonfähig. Lucys jüdischer Ehemann David, ein glühender Patriot, hält unbeirrbar an seiner Meinung fest, dass der irrationale Judenhass den EngländerInnen niemals so im Blut liegen kann wie den Menschen auf dem Festland ... doch das Fortschreiten der Handlung wird dies zunehmend in Zweifel ziehen.
Geschichte ohne Sicherheitsabstand
Jo Walton, eine mehrfach ausgezeichnete Fantasy-Autorin aus Kanada, hat mit "Farthing" erstmals das Gebiet der Alternativweltgeschichten betreten. Das tut sie in ausgesprochen gelungener Weise - vor allem deshalb, weil der Plot von einem Land, das sich langsam aber sicher von der Demokratie abwendet und dem Faschismus ergibt, so verallgemeinerbar ist. Oder wie sie es selbst im Vorwort ausdrückt: This novel is for everyone who has ever studied any monstrosity of history, with the serene satisfaction of being horrified while knowing exactly what was going to happen, rather like studying a dragon anatomized upon a table, and then turning around to find the dragon's present-day relations standing close by, alive and ready to bite.
"Farthing" ist eine in sich geschlossene Geschichte - in zwei weiteren Romanen um Inspector Carmichael und seinen wachsenden seelischen Konflikt wird das beklemmende Gesellschaftspanorama weiterentwickelt und vorerst abgeschlossen: "Ha'penny" (2007) und "Half a Crown" (2008).

Jan Gardemann: "Der Remburg-Report"
Broschiert, 230 Seiten, € 13,30, Atlantis 2009.
SOS Remburg, Rücksturz in die 90er Jahre! - Keine Katastrophenwarnung, sondern ein Hinweis auf einen spannenden Romanerstling, der allerdings mit seinem Mystery-Plot - Menschen mit paranormalen Begabungen, politische Verschwörungstheorien und manipulative Umtriebe von Außerirdischen - Assoziationen an ein "Best of Akte X" weckt. Prosaisches Epizentrum der Ereignisse ist der Neubau eines Einkaufszentrums - der Luzidenpassage - in der fiktiven deutschen Stadt Remburg. Zum Aufklärer wird der Jungjournalist Michael Neustädter; seinen "Remburg-Report" erstattet er, zwei Monate rückwirkend, in ebendieser Passage, kurz bevor ... na, das darf an dieser Stelle nicht verraten werden.
Michael ist so lala durchs Journalistik-Studium gekommen - jetzt arbeitet er als Freiberufler, verkauft aber kaum Stories. Das liegt nicht zuletzt daran, dass er an Narkolepsie - hier als "Hypnosie" bezeichnet - leidet. In Erregungszuständen, also leider auch beim Auftauchen eines potenziellen Knüllers, sinkt er unvermittelt in Schlaf. Anschließend sind seine Erinnerungen an die Ursache der Schlafattacke gelöscht, was ungeahnte Möglichkeiten für nicht-lineare Handlungsverläufe schafft. Das wird zwar nur zum Teil genutzt - dafür setzt ein anderer Nebeneffekt den eigentlichen Plot in Gang: Denn eines Tages entdeckt Michael, als er einer Tonbandaufnahme mit seinem Schnarchen lauscht, dass er im Schlaf offenbar in die Wahrnehmung und Erinnerungen anderer Menschen schlüpft. Das gibt Jan Gardemann Gelegenheit, aus einer Vielzahl von Einzelperspektiven ein Gesamtbild zu entwerfen. Keine dieser Perspektiven ist eine alltägliche - zumindest nach den Maßstäben von Menschen außerhalb Remburgs. Da wäre zum Beispiel Lena, die den Mord an jenem Planungsstadtrat mitverfolgt, der dem Projekt Luziden-Passage im Weg stand. Auch sie verfügt über eine besondere Fähigkeit und wird sich - ebenso wie später Michael - dem Begabteneinsatzkommando der Polizei anschließen. Oder Simon, der nolens volens für den Verbrecherfürsten Ader arbeitet. Karl, ein Kontorsionist mit Selbstheilungskräften, an dem in der Vergangenheit medizinische Experimente durchgeführt wurden. Josef, der in ein psychedelisches Drogenexperiment gerät. Und Björn, der erfährt, dass die jahrhundertealte Legende vom stadteigenen Terroristen Anders Mischer eine höchst reale und überdies mikrotechnologische Seite aufweist ...
... kurz gesagt: Es gehen seltsame Dinge vor in Remburg, der Stadt, die unter einem elektromagnetischen Strahlungsfeld liegt, welches sämtliche drahtlose Kommunikation unterbindet. Was bei weitem nicht ihre einzige Besonderheit bleibt, denn wie beiläufig fließen beständig Info-Schnipsel über andere Seltsamkeiten ein: Die Hemmschwelle gegenüber Gewalt liegt bemerkenswert niedrig und erstreckt sich auch auf "NormalbürgerInnen": Björn erfährt dies in einer gespenstischen Sequenz am eigenen Leib, als er bei einer Demo mit knapper Not prügelnden Polizisten entkommt, nur um anschließend in einen Anrainer-Mob zu geraten, der ihn unter vollkommenem Schweigen zu massakrieren versucht. Rabiate Musiker, die das ganze Land mit neuen subkulturellen Strömungen versorgen, liefern sich einen Krieg mit den Agenten der großen Labels. Ein Uni-Professor, der Michael beeindruckt, scheint gar nicht zu existieren - und dann ist da noch der eigentümliche Dualismus zwischen dem Verbrecher Ader und seinem polizeilichen Gegenstück Braaker, welche einander verdächtig ähnlich sehen. Nicht alle diese Motive werden letztlich von Bedeutung sein, erzeugen aber eine zunehmend irreale Atmosphäre: Langsam glaubte ich, diese Stadt hätte jeden Bezug zur Realität verloren. Remburg war eine Insel, ein Archipel der Unmöglichkeiten in einem glatten Meer der Rationalität. Und da hatten Mutanten, Mensch-Maschine-Verschmelzungen und verschiedene Sorten Aliens noch gar nicht ihren Auftritt.
Wie so oft bei Mystery-Geschichten ist die Auflösung des Geheimnisses dann nicht der spektakulärste Teil der Geschichte - es gilt eher: Der Weg ist das Ziel und mal sehen, wie lange uns der Autor auf diesem Weg bei der Stange halten kann. Das schafft Gardemann, der bislang vor allem als Autor von Heftromanen tätig war (darunter auch ein Hansi Hinterseer-Roman!!!, ist das klasse) und den Sprung ins neue Genre souverän absolviert, beachtlich lange. Hat was!
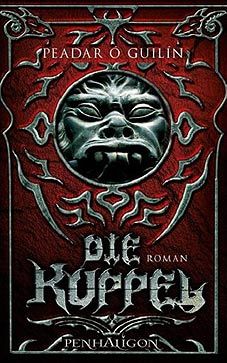
Peadar Ó Guilín: "Die Kuppel"
Gebundene Ausgabe, 445 Seiten, € 19,50, Penhaligon 2009.
Na das ist doch mal ein Bastard von einem Buch! Nicht nur weil der Romanerstling des jungen irischen Autors Peadar Ó Guilín als Hybrid aus Science Fiction und Dark Fantasy daherkommt, sondern auch weil es darin in so selbstverständlich kannibalistischer Weise ums Fressen und Gefressenwerden geht, dass einem dabei Hören und Sehen vergeht ... oder zumindest der Appetit. Und um Missverständnissen vorzubeugen: Das ist eine ausgesprochen positive Eigenschaft.
Unter dem Großen Dach der Welt liegt eine bis zu allen Horizonten ausgedehnte Stadtlandschaft, die nur von spärlichem Pflanzenwuchs durchbrochen ist. Hier hausen die Menschen neben unzähligen anderen Spezies wie den Haarigen, den Panzerrücken oder den Krallenleuten in ihrem jeweiligen Revier. Übertreten der Grenzen ist nicht ratsam, außer man befindet sich auf einem Jagdzug oder hat mit den Nachbarn einen Waffenstillstand ausgehandelt (schwierig, wenn deren Lautäußerungen in der Regel nicht nachgeahmt werden können). Zwar wissen die Bodenbewohner, dass ihre Häuser, die aus unendlich weit zurück liegender Vergangenheit stammen, aus Beton und Metall gebaut sind, und sehen täglich leuchtende Sphären über ihren Köpfen dahinfliegen - der eigene Technologie-Stand ist jedoch denkbar niedrig. Es fehlt einfach am Rohmaterial - außer ein bisschen Moos ist nur das vorhanden, was der eigene Körper hergibt. Respektive der des Nachbarn. So trägt man Kleidung aus Häuten, benutzt Werkzeuge aus Knochen ... und vor allem frisst man sich gegenseitig auf. Vorzugsweise werden Mitglieder anderer Spezies - allesamt als Bestien bezeichnet, was diese ihrerseits auch auf die Menschen anwenden - geschlachtet. Doch auch wer im eigenen Revier zu Tode kommt, dreht sich bald darauf am Spieß - und so werden die Jäger auch mit der traditionellen Abschiedsformel "Möge das Fleisch eurer Körper zum Stamm zurückkehren" auf den Weg geschickt. Und wer zwar noch lebt, aber körperlich nicht mehr zu gebrauchen ist, wird im Rahmen des Fleischhandels mit Nachbarvölkern eben zum "Freiwilligen".
"Die Kuppel" (im Original "The Inferior", erster Teil einer Trilogie) entfaltet ihr hundert Prozent nicht-veganes Panorama anhand der Erlebnisse zweier rivalisierender Brüder: Wandbrecher hat Ambitionen zu Größerem, er kann über den Moment hinausdenken und hinterfragt seine Welt. Zum Sympathieträger wird interessanterweise aber nicht er gemacht, sondern sein deutlich schlichter gestrickter Bruder Stolperzunge. Der wird zwar wegen seines Sprachfehlers von niemandem für voll genommen, ansonsten entspricht er dem geforderten Menschenbild seiner Welt aber voll und ganz: Trifft er auf seiner Queste auf Vertreter einer neuen Spezies, denkt er nicht an Verständigung, sondern daran, wie köstlich es sein wird, ihr Hirn zu löffeln. Anlass dieser Queste ist - natürlich, möchte man sagen - das Eintreffen einer geheimnisvollen Frau: Indrani, die beim Kampf verfeindeter Fraktionen aus dem Großen Dach mit ihrer Sphäre abgestürzt ist. Gemeinsam mit Stolperzunge schlägt sie sich nun durchs Gelände, um zurückkehren zu können - dabei lernen die beiden wirklich jeden Aspekt des kriegerischen Kannibalismus kennen, den die Welt zu bieten hat. (Besonders ekelig eine "Plantage", auf der Gefangene zur Hälfte eingegraben werden, damit der Nachwuchs der betreffenden Spezies sie langsam von unten her anfressen kann.) So ganz langsam kommt es dabei auch zu einer Annäherung zwischen Stolperzunge und Indrani, die sich widerwillig an die Ernährungsgewohnheiten der Bodenwelt anpassen muss. Ó Guilín vermag es dabei, recht glaubhaft die Perspektive der "Barbaren" nachzuvollziehen: Stolperzunge und sein Stamm verehren Indrani nicht als Überwesen, sondern halten sie für geistig zurückgeblieben, weil sie nicht die Sprache des Stammes beherrscht und nur unverständliches "Kauderwelsch" plappert. Ein Problemfall - und damit eine potenzielle Freiwillige. - Ein Minuspunkt in Sachen Logik bleibt hingegen der sogenannte Sprecher, ein Übersetzungsgerät, das irgendwie von jeder Sprache simultan in jede andere übersetzt und dabei auch irgendwie etymologisches Kontextwissen mitvermittelt und irgendwie ... in seiner Beschreibung einfach völlig inkonsistent bleibt. Kein neues Phänomen: Mit Translatorentechnik hat die Science Fiction eben - ebenso wie mit Überlichtantrieben - ihre liebe Erklärungsnot; da liegen Douglas Adams' Babelfische glatt noch im oberen Drittel der Glaubwürdigkeit.
Versuchen wir das Ganze einmal zu visualisieren: Eine riesenhafte Kuppel (die genau genommen wohl gar keine sein dürfte), fliegende Energiekugeln, Barbaren im Lendenschurz, "Bestien" wie aus Brehms Tierleben und eine betörend schöne Frau, die vom Himmel fällt. Da fühlt man sich schon in die Welt der Pulps zurückversetzt, denkt an Edgar Rice Burroughs und Robert E. Howard und sieht glorios reißerische Covers im Stil von "Weird Tales" vor seinem geistigen Auge. - Doch handelt es sich hier um eine literarische Aufarbeitung, die in einem guten knappen Stil erzählt wird, der keinerlei Bock auf Fisimatenten hat (der nächste Satz Kiefer lauert schließlich gleich um die Ecke). Was insgesamt eine Vorgangsweise ist, die sich gar nicht so sehr von der Philip José Farmers unterscheidet, welcher sich Zeit seines Lebens ebenfalls von Pulps inspirieren ließ. Ó Guilín selbst betont, vor allem von Klassikern der Science Fiction beeinflusst worden zu sein, etwa Brian Aldiss' "Helliconia". Ist gar nicht so weit hergeholt, denn hier wie dort beobachten hochtechnologische "Himmelsbewohner" eine Fantasy-artige Welt und müssen sich hüten sie zu betreten. Bei Aldiss würden sie unweigerlich von einem indigenen Krankheitserreger dahingerafft - hier müssten sie aufpassen, nicht aufgefressen zu werden ... - "Die Kuppel" (wer ist bloß auf die Bezeichnung "Jugendroman" gekommen - nur wegen der schnörkellosen Sprache?) bietet jedenfalls deftige Kost für Leseabende. Und würgende Geräusche waren noch bis spät in die Nacht zu hören.

Jonathan Barnes: "Das Albtraumreich des Edward Moon"
Broschiert, 399 Seiten, € 9,20, Piper 2009.
Zwei Jahre vor "The Domino Men" ("Das Königshaus der Monster", hier der Rückblick) schrieb Jonathan Barnes seinen Debütroman, der nun auch als Taschenbuch erhältlich ist. Auch hier ist London der Schauplatz - eine Stadt mit "Geheimer Geometrie", einem unterirdischen Albtraumreich und einem pochenden Giftherz -, die Handlungszeit ist diesmal jedoch der Übergang von der Viktorianischen auf die Edwardianische Ära. Barnes, der Literatur studiert hat, nutzt sein Wissen, indem er die Ausgestaltung des Settings mit einer adäquat altertümelnden Erzählweise verbindet: Denn erst stellt sich mal bescheiden der Erzähler vor - Boswell nennt er sich und bleibt vorerst rätselhaft. Immer wieder wird er sich im Folgenden selbst einbringen: Wenn gleich zu Beginn der Lebemann Cyril Honeyman eingeführt wird, warnt der Erzähler vorbeugend: Nur wenige Seiten trennen uns von seinem Tod. Der tritt auch umgehend ein, nachdem Cyril von einer Bordsteinschwalbe in einen seltsamen Metallturm gelockt wurde, dort zu seinem Entsetzen seine Mutter vorfindet und von einer schuppigen Kreatur auf die Straße gestürzt wird - und dieser finale Abgang wird vom Erzähler auch noch recht mitleidlos kommentiert.
Auftritt Edward Moon, Zauberkünstler von Beruf und Detektiv aus Leidenschaft. Früher hat er für die Polizei einige knifflige Fälle gelöst, inzwischen aber längst seinen Zenith überschritten. Als Betreiber des kleinen Theaters des Unglaublichen tritt er mit einem Kompagnon, der ihm irgendwann "zugelaufen" ist, in Zaubershows auf - der Schlafwandler wird dieser stumme Hüne nur genannt, und nach ihm ist der Roman im Original ("The Somnambulist") benannt. Auch abgesehen davon, dass Moon sich regelmäßig in einem Bordell mit missgestalteten Frauen vergnügt, wird der Romanprotagonist nicht allzu sympathisch geschildert - aber halt! Zumindest beschreibt ihn so der Erzähler, und der mag Moon nicht, wie er freimütig einräumt. Man sollte also nicht alles für bare Münze nehmen, denn wie schon beim "Königshaus der Monster" gesagt: Barnes spielt gerne und tückisch mit seinem Publikum. Da kann er schon mal mitten in der Beschreibung einer Séance abbrechen und den Erzähler eine psychologische Ferndiagnose der LeserInnen erstellen lassen, das Ganze mit einer unheilschwangeren Bemerkung à la "Zu diesem Zeitpunkt bin ich fast sicher schon tot ..." garnieren (weder der ersten noch der letzten ihrer Art) - und flugs geht die Handlung weiter, während man sich einmal mehr die Frage stellt: Wer ist dieser Boswell eigentlich?
Der Mord an Cyril Honeyman bleibt nicht der letzte, und Moon gerät im Zuge seiner Ermittlungen an eine Reihe äußerst seltsamer Gestalten: Der an London gebundene Zeitreisende Thomas Cribb etwa, der Moon von der dunklen Seite seiner Heimatstadt erzählt, der wegen Mordes im Gefängnis dahinsiechende fette Koloss Barabbas oder der albinotische Mr. Skimpole, der Moon dazu zwingt, für das Direktorium zu arbeiten: Jene Geheimorganisation, die auch im "Königshaus" eine zentrale Rolle spielt (Figuren wie Skimpoles Vorgesetzter Dedlock und die beiden dämonischen Präfekten Hawker & Boon haben hier ihren ersten Auftritt; inhaltlich sind die beiden Romane aber klar voneinander getrennt). Die Vorgeschichten der Figuren und ihre mannigfaltigen Beziehungen untereinander bleiben lange Zeit im Dunkeln - werden aber im ebenso furiosen wie sorgfältig ausgeklügelten Finale in allen Facetten geklärt werden. Inklusive der Rollen, die der mythische Gründer Londons, König Lud, der Dichter Samuel T. Coleridge (weltbekannt durch "Kubla Khan") und natürlich der dubiose Erzähler selbst spielen.
Serienmorde, Übernatürliches und Verschwörungstheorien, Umtriebe von Anarchisten und russischem Geheimdienst, magisches Varieté und Freakshows, Somnambulisten und Fliegenmenschen, Séancen und Steampunk-Technik - besser als beim "Königshaus der Monster" passen hier alle verwendeten Motive zusammen und ergänzen sich zu einem fiebrigen Traum vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Uneingeschränkt empfehlenswert.
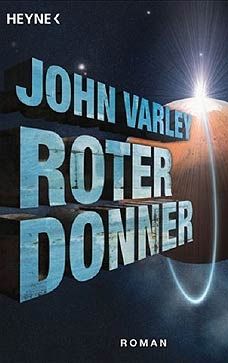
John Varley: "Roter Donner"
Broschiert, 543 Seiten, € 9,20, Heyne 2009.
Das ist mal wieder ein schöner Beleg dafür, dass die Art, wie ein Geschichte erzählt wird, ihren Inhalt überwiegen kann - oder genauer gesagt: Dass sie einen dazu bringen kann, einen vollkommen haarsträubenden Plot zu schlucken, und der dann sogar noch schmeckt. Denn viel absurder kann es gar nicht werden, als dass sich ins amerikanisch-chinesische Wettrennen zum Mars eine dritte Partei einschaltet. Auch aus den USA stammend zwar, aber gewissermaßen bottom-up: Ein paar Spät-Teenager düsen mit einem selbstgebastelten Klapperatismus ins All, der über einen Antrieb verfügt, an den noch nicht einmal die Theoretische Physik gedacht hätte, um auf ihrem Flug Konkurrenz und Naturgesetze hinter sich zu lassen.
Im Zentrum steht Manny, der im familieneigenen Motel nahe Cape Canaveral jobbt: Ein heruntergekommener Schuppen, in dem schon mal Mannys Mutter Dealer mit dem Revolver verjagt und Manny die Einschusslöcher in den Wänden überspachteln muss. Manny und sein bester Freund Dak studieren an einem Internet-College (wir befinden uns ein paar Minuten in der Zukunft), und beide sind sie ausgesprochene Weltraum-Freaks, die alle Raketen-Starts live mitverfolgen, aber keine Nerds - eher Slacker mit regem Sexleben. Mit ihren Freundinnen Kelly und Alicia bilden sie eine eingeschworene Clique, die in Daks aufgepimptem Blauem Donner durch die Gegend brettert. Eines Nachts überfahren sie dabei am Strand beinahe einen vergessenen Helden: Colonel Travis Broussard, ein Ex-Astronaut, den die NASA aus ihren Annalen gestrichen hat, weil er in einen für sie peinlichen Vorfall verwickelt war. Sie liefern den besoffenen Broussard zu Hause ab und treffen dabei auf die Person, die die Geschichte von Raumfahrt und Physik revolutionieren wird: Broussards Cousin Jubal, ein wunderliches Genie mit Entwicklungsstörung, seit sein irrer Christen-Prediger von Vater ihn einst beinahe totgeschlagen hätte. Seitdem denkt Jubal anders - und wirft immer wieder mal Erfindungen aus, die nicht mal er zur Gänze versteht. Zum Beispiel masselose Silberkugeln, die nicht nur hübsch in der Gegend herumschweben, sondern sich auch (mittels einer Fernbedienung, die mysteriöserweise ganz ohne Strom funktioniert) nach Belieben vergrößern und verkleinern lassen. Das paraphysikalische Prinzip dahinter versteht zwar niemand, aber es lässt sich anwenden - und wird der erste Schritt in einem Triumphzug provisorischen Erfindertums sein, an dessen Ende das Raumschiff Roter Donner zum Mars starten soll. Mit einer Tiefkühltruhe voller Fertigpizzen, einem Wassererhitzer aus dem Kaufhaus und einem Plumpsklo an Bord ...
Wie gesagt: haarsträubend. Die jeder Logik widersprechenden Züge beginnen beim nebenbei noch als unbegrenzte Energiequelle fungierenden Prinzip des Antriebs, gehen über die technische Umsetzung des aus Eisenbahn-Tankwaggons zusammengeschweißten Raumschiffsrumpfs und das Tempo von dessen Bau inklusive sämtlicher dafür notwendiger Logistik (als sie mit der Montage beginnen, sind die offiziellen Mars-Expeditionen der USA und Chinas längst auf dem Weg) und enden beim kaum glaublichen Einverständnis der Eltern, dass ihre Kinder mal eben zum Mars fliegen. - Aber das macht nichts, denn das Ganze wird mit Witz erzählt. Nicht überdreht genug, um von einer Persiflage zu sprechen, aber frisch, voller turbulenter Ereignisse und humoriger Einschübe. Und endlich mal mit Dialogen, die so klingen, wie man wirklich spricht, und keine in Gesprächsform inszenierten Erklärungen zur Handlung sind. Optimismus ist roter Faden und Botschaft von Varleys Roman, in dem sich der vielfach mit Hugo, Nebula und Locus Award ausgezeichnete Science Fiction-Veteran aus Texas einmal mehr auf die Spuren Robert Heinleins - speziell von dessen Jugendromanen - begibt. Da dürfen auch patriotische Anwandlungen nicht ganz fehlen, und der erste Impetus der "Mission Roter Donner" ist unverhohlen, dass Manny & Co nicht den Chinesen die Erstbetretung des Mars überlassen wollen. Das erschien Varley dann vielleicht doch zu dünn, und so konstruiert er später noch eine Rettungsmission für das Marsraumschiff der NASA dazu, wofür der Rote Donner eigentlich noch weniger ausgerüstet ist als für alles andere - aber was soll's. Ein paar Seitenhiebe auf das einstige "Apollo"-Programm und wieviel die NASA da an übers Knie gebrochenen Provisorien einsetzte, fügen dem Ganzen übrigens eine ironische Note hinzu.
Das soll jetzt nicht heißen, dass Varley erzähltechnisch alles richtig macht, denn ausgewogen läuft der Plot nicht ab. Sehr lange bleiben wir im - zum Glück vergnüglichen - Alltag der Teenager-Clique, ehe das eigentliche Weltraum-Projekt mit zunehmender Hast geschildert wird. Wozu dann noch ein kursorisches Nachwort kommt, dessen Inhalt bei Einhaltung des anfänglichen Erzähltempos einige tausend Seiten gefüllt hätte. So ist das im Original 2003 veröffentlichte "Red Thunder" weniger eine Space Opera als ein wüstes Südstaaten-Geflunker, in dem jede Menge gegessen und gebechert, gestritten und gefeiert wird. Und irgendwann auch zum Mars geflogen.

David Weber: "Nimue Alban": "Codename: Merlin" und "Die Flotte von Charis"
Broschiert, 491 bzw. 510 Seiten, jeweils € 10,30, Bastei Lübbe 2009.
Der vorangegangene Teil der "Nimue Alban"-Reihe (hier der Rückblick) endete mit dem umfassenden Seesieg des Inselkönigreichs Charis über seine von der Weltkirche aufgehetzten Nachbarreiche, dem Tod des alten Königs von Charis in der Schlacht und Merlins düsterer Ahnung, das Echo der Geschichte von Heinrich VIII. zu hören. "Merlin" ist der einzige auf dem ganzen Planeten Safehold, der diese Assoziation haben kann, denn "er" ist die Tarnexistenz von Nimue Alban, der letzten überlebenden Verantwortlichen eines Projekts zur Rettung der Menschheit. Überlebend mit Abstrichen, denn genau genommen handelt es sich um eine Bewusstseinskopie der Original-Nimue, die fast 900 Jahre nach der Kolonisierung Safeholds aktiviert und in einen kybernetischen Körper hochgeladen wurde.
Seit ihrem Erwachen hat Nimue mit dem Umstand zu raufen, dass das Safehold-Projekt aus dem Ruder gelaufen ist. In einem bürgerkriegsartigen Streit zwischen den Projektverantwortlichen setzte sich die Fraktion durch, die die KolonistInnen über ihre Herkunft in Unwissenheit belassen wollte - als "Erzengel" sind die Sieger nun in die Theologie der Kirche des Verheißenen eingeflossen, der Name von Nimues ehemaliger Vorgesetzter hingegen ist nun das Pendant zu Satan. Die dogmatischen Ächtungen sorgen dafür, dass der Stand der Technik auf Safehold nicht über ein prä-industrielles Niveau hinausgehen kann - daher hat Nimue sich das recht fortschrittliche Königreich Charis als Basis auserkoren, von der aus sie Safehold langsam aber sicher umkrempeln will. Ein schwieriger Balance-Akt stünde ihr dabei selbst nach der erhofften Überwindung aller politischen und kriegerischen Auseinandersetzungen bevor: Schließlich ist Safehold der letzte Zufluchtsort der Menschheit, die auf allen anderen Planeten von einem außerirdischen Feind ausgelöscht wurde. Die pervertierte Low-Tech-Strategie sollte dazu dienen, Safehold bedeckt und nicht ortbar zu halten - dennoch wird es auf lange Sicht notwendig zu sein, die letzten Menschen auf den Kampf gegen die Aliens vorzubereiten.
Aber noch ist es lange nicht soweit: Nach dem gewonnenen Seekrieg verkündet Erbischof Maikel Staynair von Charis mit einem - unbewussten - Luther-Zitat offiziell das Schisma ("By Schism Rent Asunder" lautet der Originaltitel, und wie schon Webers erster "Nimue"-Roman "Off Armageddon Reef" wurde auch dessen Nachfolger in der deutschen Ausgabe auf zwei Bücher aufgeteilt). Die Gegner von Charis lecken ihre Wunden und machen sich an das Ausarbeiten von Gegenstrategien - allen voran die Vierer-Gruppe der mächtigsten Vikare der Kirche. Cayleb, der neue König von Charis schmiedet indessen ein Bündnis mit Sharleyan, der Königin von Chisholm, das ähnlich wie Charis wenig von der Allmacht der Kirche hält. Um diese Figuren - plus Prinz Nahrmahn, Erzrivale von Charis - kreist der größte Teil der "zwei" Romane, Merlin selbst tritt im Vergleich zum Erstling ein wenig in den Hintergrund. - Die Vielzahl der Charaktere und der Umstand, dass sich Weber eine eigene Lautverschiebung für die Safehold-Sprache ausgedacht hat, welche [a] und [y] zu Lasten der übrigen Vokale bevorzugt, fördert die Übersichtlichkeit nicht gerade (da knattert Mahrak Sahndrys auf Zhaksyn Maiyr und Zhasyn Cahnyr auf Zhaspyr Clynthan usw. usf., zum Glück gibt es ein Glossar). Und apropos Übersichtlichkeit: Eine Karte von Safehold wäre ein cooles Gimmick!
Aus der Plot-Logik heraus ließe sich die Frage aufwerfen, ob Nimue Alban nicht eine andere Stelle hätte finden können, um den Hebel zur Umwälzung Safeholds anzusetzen - etwa die globale Kirche zu infiltieren, anstatt als Graue Eminenz im Hintergrund ein einzelnes Königreich in den Krieg gegen den Rest der Welt zu treiben. Dafür war natürlich ein anderer Faktor auschlaggebend: Webers Wunsch, jede Menge geile Kriegsabenteuer zu schreiben. Eine gewisse Schwarz-Weiß-Zeichnung ist da unvermeidlich: In Charis sind die Soldaten heldenhafter, die Machthaber weitsichtiger und die Menschen im allgemeinen anständiger als anderswo (unwahrscheinlicherweise freuen sich Industriekapitäne darüber, dass endlich ein Gesetz gegen Kinderarbeit in Kraft treten wird ...); und natürlich sind ihre Kriegszüge gerechter. Allerdings muss man Weber zugute halten, dass er auch den Gegnern von Charis immer wieder Gesicht und Stimme verleiht - und sei es nur der Offizier einer Truppe, die gleich darauf von den Charisianern massakriert wird. Tiefgehende Charakterisierung der Figuren ist beileibe keine Stärke Webers, allerdings könnte man auch einfach von einer anderen Prioritätensetzung sprechen: Weber fokussiert eben am liebsten auf Abläufen: Sei es eine Seeschlacht, der Aufbau einer Kanonengießerei, eine Taktikbesprechung (die Dialoge sind hier in Sachen "organisch" so ziemlich das Gegenteil zu denen John Varleys) oder ein Baseballspiel. Oder auf globaler Ebene Entstehen und Fortschreiten eines Schismas.
Dass "By Schism Rent Asunder" gegenüber "Off Armageddon Reef" etwas abfällt, liegt daran, dass einige interessante Elemente diesmal keine Rolle spielen. So wird aus Nimues Zwiespalt, als Frau in einem männlichen Körper zu stecken, nichts mehr gemacht - und auf den Komplex der Alien-Bedrohung, der immerhin den großen Rahmen der gesamten Reihe bildet, wird diesmal überhaupt nicht eingegangen. Es bleibt der Eindruck, dass Weber sich in seinem Setting gemütlich eingerichtet hat und dieses nun primär dafür nutzen will, der Reihe nach martialische Abenteuergeschichten an der Schnittstelle von Military Science Fiction und Alternativweltgeschichte zu veröffentlichen - worauf auch die Inhaltsbeschreibung des kürzlich erschienenen dritten Romans "By Heresies Distressed" hindeutet. Stoff bietet eine Welt, in der Reformationszeit und die ersten Vorbeben der industriellen Revolution verschmelzen, allemal - nur darf der größere Rahmen nicht zu kurz kommen, um der wirklich originellen Ausgangsidee der Serie gerecht zu werden.
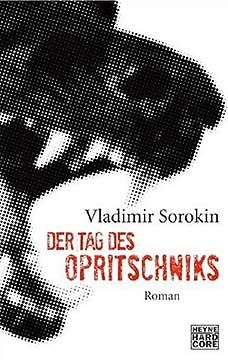
Vladimir Sorokin: "Der Tag des Opritschniks"
Broschiert, 220 Seiten, € 9,20, Heyne Hardcore 2009.
Und noch eine unbedingt lesenswerte Wiederveröffentlichung im Taschenbuch-Format: Die 20 Jahre in die Zukunft verlegte groteske und vor Gewalt strotzende Polit-Satire "Der Tag des Opritschniks" von Vladimir Sorokin, einem der Lieblingsfeinde der Kreml-treuen "Putin-Jugend". Die kommt hier - natürlich in einer gesteigerten Variante, die auf das geschilderte Russland unter dem allmächtigen Gossudaren bezogen ist und dennoch gut erkennbar bleibt - doppelt schlecht weg: Nicht nur dass sie in SA-Manier eine Bühnenaufführung zu stören versucht, sie scheitert damit auch noch am Intellekt des Künstlers. Was auch schon die einzige Szene des 2006 erstveröffenlichten Romans bleibt, in der der Widerstand der Vernunft gegen die staatlich gelenkte Gewalt obsiegt. Aber da waren ja auch nicht die Opritschniki, die hochprofessionelle Spezial-Schlägertruppe des Gossudaren, im Einsatz.
Einer davon ist Andrej Danilowitsch alias Komjaga, und Sorokins Roman schildert einen typischen Tag in dessen Leben. Andrej startet, von den Auschweifungen und Gräueltaten des Vortages - der Staatsdienst ist kein Honiglecken - noch verquollen, mit mühsamen körperlichen Restaurierungsarbeiten; das Morgengebet folgt auf dem Fuß. Danach geht es zwecks Mord, Vergewaltigung und Brandschatzung erst mal zum Gehöft eines in Ungnade gefallenen "Edelmanns": Die im Roman gesprochene Sprache ist altertümelnd gehalten, und zum Teil liegt dies darin begründet, dass sie um "westlich-dekadente Unflätigkeiten" bereinigt wurde. Vor allem aber daran, dass das Heilige Russländische Reich des Jahres 2027 die zaristische Tradition für sich wiederentdeckt und die kommunistischen wie auch demokratischen Verirrungen der Vergangenheit ausgetilgt hat. Eine West- und eine Südmauer haben die Isolation gegenüber der Außenwelt einbetoniert - und machen auf der Innenseite die Aufräumungsarbeiten mit allem Unliebsamen umso leichter. Als sichtbares Zeichen dafür montieren die Opritschniki neben täglich wechselnden Hundeköpfen auch Eisenbesen auf ihre Karossen.
Details wie dieses sind typisch für den Stil greller Überzeichnung, in dem Sorokin seine Satire abspult: Das beginnt schon bei der lächerlichen Aufmachung - Kaftan, Samtmütze, Glöckchen im Ohr -, in die Andrej während seiner Morgengarderobe schlüpft, und endet bei der Analfick-Polonäse, für die sich die Opritschniki am Ende des Arbeitstages in der Sauna aufstellen (der Pornografie-Prozess, der gegen Sorokin angestrengt wurde, ging allerdings auf ein anderes Werk zurück ... nicht dass er dort angebrachter gewesen wäre). Und jede Menge Surreales auch dazwischen: Der Gossudar erscheint seinen Mannen nur als überlebensgroßes Hologramm, das an den Zauberer von Oz erinnert. Und ehe Andrej & Co den Hof des Edelmanns niederbrennen, ziehen sie erst dreimal im Kreis darum herum und skandieren "Wehe diesem Haus!" - die lachhaften Elemente des Romans machen seine Schrecken allerdings keineswegs geringer. - Wer "Der Tag des Opritschniks" durch eine Genre-Brille lesen will, sollte sich aber vorab bewusst machen, dass Sorokin hier keinen herkömmlichen Phantastik-Roman geschrieben hat, sondern eine Satire auf das Russland von heute - und zwar tendenziell stärker als etwa Boris Strugatzki in seinen Nahzukunftsromanen der 90er und 00er Jahre. Auch die Form ist alles andere als eine straighte Erzählung: Da fließen des öfteren Gedichte ein, und wenn sich die Opritschniki einer psychedelischen Droge hingeben, springt das betreffende Kapitel mal eben von einer Ballade auf einen interpunktionslosen Stream of Consciousness um.
Weitere Stationen von Andrejs Tageswerk: Raubritter-artige Verhandlungen mit chinesischen Warentransporteuren an der Grenze und angewandte Kunstkritik: In einer besonders gelungenen Szene sitzen die Brutalos als gebildete Kulturmenschen im Theater, um eine vor Nationalkitsch triefende Travestie von Theaterstück vorab zu begutachten und gutgelaunt zu beklatschen: "Ich sehe ein deutliches Element von Schweinigelei. Ansonsten ist die Sache aktuell, und Pfiff hat sie auch." - So handelt Sorokin von der Politik über Kultur und Moral bis zur Wirtschaft alle gesellschaftlichen Bereiche in beispielhaften Szenen ab und entwirft daraus ein scheußliches Gesamtbild. Gruselig daran ist nicht zuletzt, dass hier trotz aller Gewaltexzesse keine Eskalation beschrieben wird - es handelt sich einfach um einen ganz normalen Tag im Leben eines Opritschniks. Und der ist - schwärzeste Pointe von allen - ein typischer Beamter, der einerseits seine Pflicht erfüllt und andererseits aus vollem Herz die l(i)ebenswerte russische Tradition lobpreist. Beim Anblick des weißgestrichenen Kreml - Lenin-Mausoleum und ähnliches wurden längst entfernt - kriegt er sich vor lauter aufrichtig empfundener Rührseligkeit gar nicht mehr ein: Für diese Zuckermauern, diese Doppeladler, diese Flagge (...) für all dies sein Leben hinzugeben fiele nicht schwer. Und hätte man ein zweites - mit Freuden gäbe man es hin für den Gossudaren. Mir stehen die Tränen in den Augen ... - Prosaische Nachbemerkung: Angesichts der für russische AutorInnen typischen Fülle von Zitaten und Anspielungen hätten sich ein paar erklärende Fußnoten des Übersetzers ganz gut gemacht.

Alisha Bionda (Hrsg.): "Unter dunklen Schwingen"
Broschiert, 335 Seiten, € 15,95, Otherworld 2009.
Ach, Anthologien. Es liegt an den Verlagen und Lesern, diese wichtige Gattung nicht zum Aussterben zu verurteilen - sie gar vielleicht wieder boomen zu lassen, schreibt die umtriebige deutsche Autorin und Anthologien-Kompilatrix Alisha Bionda im Vorwort zu "Unter dunklen Schwingen", und da kann man ihr wirklich nur beipflichten - vor allem mit Blick auf die Markttendenzen, nach denen Zusammenstellungen wie diese längst auf der Roten Liste bedrohter Literaturgattungen stehen. Schon zwei oder drei gute Beiträge pro Band rechtfertigen das Genre, weil sie nicht zuletzt die Möglichkeit bieten, neue AutorInnen kennenzulernen, von denen man sich im Anschluss auch gerne mal einen Roman gönnen würde. 11 düstere Kurzgeschichten von AutorInnen, die im deutschsprachigen Raum ansässig sind, wurden hier kompiliert - die Titel sind durchgehend nach dem Prinzip "Unter dunklen Schwingen ... XY" gestaltet, und einen weiteren Beitrag zum Corporate Design leisten die wirklich sehr schön gestalteten Gothic-Grafiken von Mark Freier, der mit dem vage an Lovecraft-Szenarien erinnernden Beitrag "Unter dunklen Schwingen ... ist kein rechter Bund zu schließen" auch in schreiberischer Form vertreten ist.
Motive aus alten Märchen greifen die beiden Autorinnen Aino Laos und Uschi Zietsch auf: Bei Laos ist es das von dem einen Gerechten in einer Gruppe von Sündern, die in einer Höhle Schutz vor einem Gewitter suchen und sich untereinander ausmachen müssen, auf welchen von ihnen der göttliche Blitzstrahl abzielt. Das wird in "... gesteht ein jeder seine Schuld" zu einer gemischten Gruppe, die in einem fluchbeladenen Haus festsitzt. Da kommt zwar auch schon mal im panischen Getümmel bei einer schwulen Nebenfigur die weibliche Seite hervor (oweh), aber die Schlusspointe ist verblüffend. - Zietsch wiederum versetzt in "... wächst manch Aberglaube" das "hässliche Entlein" in eine Gruppe religiöser Eiferer, die im Gebirge darauf warten, von ihrem Gott abgeholt zu werden. Die Frage ist nur, ob die langgediente Fantasy-Autorin diese archaische Geschichte nicht besser in einem längeren Format abgehandelt hätte - zehn Seiten sind dem wuchtigen Stil nicht wirklich angemessen und so fällt das Mini-Epos recht kursorisch aus.
Am besten sind zwei ausgesprochen hermetische Geschichten, zum einen "... kauert Gottes Kind" von Dominik Irtenkauf: Ein körperlich verfallendes Mädchen, das mehrmals missbraucht wurde, bewahrt schweigend ein Geheimnis - nicht notwendigerweise ein übernatürliches, auch wenn Wölfe, Gnome und eine Serie von Ritualmorden Teile eines verstörenden Mosaiks bilden, in dem Innen- und Außenwelt einander durchdringen. Surreale Züge trägt auch das Highlight der Anthologie, "... gehen Wunder ihren Gang" von Marc-Alastor E. E., der nicht nur im Londoner Setting, sondern auch sprachlich ein gutes Jahrhundert zurückgeht: Eine viele Fragen offen lassende und dennoch in sich geschlossene Erzählung über den verkrüppelten Waisen Firminus Becket, der im Zuge einer Serie von Kindsmorden mittels Gas zum Pflegefall wird und sich in seinem Zustand der Hilflosigkeit Poe-artigen Heimsuchungen ausgesetzt sieht. Eine Geschichte, die man wieder und wieder lesen kann.
... und ziemlich genau in der Mitte der Anthologie ist es dann vorbei, den Rest kann man sich mehr oder weniger sparen. Die "B-Seite" beginnt mit der Vampir-Geschichte "... geht der Tod auf die Jagd" des "Trolle"-Autors Christoph Hardebusch - einem weiteren Indiz dafür, dass dem Spitzzahn-Genre nur schwer neue, interessante Seiten abzugewinnen sind. Das gilt in noch stärkerem Maße für das komplett missratene "... zieht dich die Blutgräfin in ihren Bann" von Barbara Büchner, besser bekannt als Julia Conrad ("Die Drachen"): Jan und Julia zieht es in der Ära nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ins österreichisch-tschechische Grenzgebiet, wo heute immerhin so unheimliche Gebilde wie die Monster-Mall "Excalibur City" stehen - hier aber muss ein "Spukschloss" für eine altbackene Gruselgeschichte herhalten, die wirklich kein Klischee der Schauerliteratur auslässt. Schon der ÖBB-Schaffner im Zug zum Waldviertel munkelt über den Fluch, der auf Burg Heidebrock lastet und nimmt dabei Worte wie Bauernmagd und Gefolge von Untoten in den Mund. (Was der wohl auf den anderen Strecken, für die ihn die Zentrale so einteilt, erzählt?) - Unlogisch, unfreiwillig komisch und für eine Autorin mehrerer Romane erstaunlich unbeholfen im Stil - der Tiefpunkt der Anthologie. Aber kein ganz einsamer, denn dazu gesellt sich noch die dritte Bluttrinker-Geschichte, "... zerbricht die Unsterblichkeit", die mit Tanya Carpenter und Mark Staats gleich zwei AutorInnen hat und mit allen vier Beinen fest auf Heftroman-Niveau steht.
Zumindest in seiner Bildhaftigkeit beeindruckt "... entscheidet der Feuerengel über die Geschicke der Welt" der Musikerin und Autorin Arcana Moon (obwohl Gundula Schikora fast cooler klingen würde) über eine Frau, die entweder Psychiatriepatientin oder ein übernatürliches Wesen oder vielleicht auch beides ist. Fans von Storm Constantine dürften den pathosgeladenen Stil mögen, auch wenn (oder in dem Fall vielleicht gerade weil) die Geschichte erheblich unter verquastem Weltschmerz leidet. Letzterer zieht sich auch durch Alisha Biondas eigenen Beitrag "... trifft dich Ischariots Kuss", in dem der angebliche allgemeine Werteverfall das Produkt eines Kreises dunkler Gestalten mit biblischen Namen ist, die hinter den Kulissen der verderbten Welt agieren. - Vielleicht ist es kein Zufall, dass einer der besten Beiträge der Anthologie einer ist, der strenggenommen gar nicht unter "Phantastik" fällt: "... nimmt der Wahnsinn seinen Lauf" von Andeas Gruber, die bedrückende Psycho-Studie des Außenseiters Konrad, der unter Zwangshandlungen und sozialer Verelendung leidet. Ein Schulfreund und Arbeitskollege - gleichzeitig der Ich-Erzähler - schenkt ihm ein riesiges Puzzle, damit Konrad lernt sich zu konzentrieren und sein Leben wieder zu organisieren. Doch statt dessen leitet es seinen völligen geistigen Verfall ein. Und das ist dann wirklich gruselig.

Sascha Mamczak & Wolfgang Jeschke (Hrsg.): "Das Science Fiction Jahr 2009"
Broschiert, 1.594 Seiten, € 30,80, Heyne 2009.
Das Universum expandiert mit beschleunigter Rate, wie Rüdiger Vaas in seinem hier enthaltenen Aufsatz "Die Saat der Zeit" mehrfach betont - aber das alljährliche SF-Kompendium des Heyne-Verlags hält da locker mit und nähert sich mittlerweile der 1.600-Seiten-Schallmauer. Wie jedes Jahr wird dabei ein Schwerpunkt besonders herausgestrichen, und der lautet heuer - pingelige LateingrammatikerInnen mögen sich nicht ins Beinkleid machen - "Quo vadis, Superhelden?": Scheinbar dem Trend folgend, dass die einst ausschließlich in Comics vertretenen Figuren in den vergangenen Jahren verstärkt in die Non-Graphic Novels eingewandert sind. Und zwar nicht nur auf einer Meta-Ebene wie in Michael Chabons großartigem Roman "Die unglaublichen Abenteuer von Kavalier und Clay", sondern durchaus 1:1. - Interessanterweise wird dieser Aspekt in keinem der Aufsätze des insgesamt 400 Seiten langen Schwerpunkts behandelt, statt dessen ganz auf Comics und Filme fokussiert. Fast als Rechtfertigung bzw. Erklärung liest sich da in Karsten Kruschels Aufsatz "In der Zeitmaschine auf dem Weg zu Gott" ein Statement, warum Superhelden in der bildlosen Literatur nicht so besonders gut funktionieren: (...) der Leser eines Textes hat den Vorteil, sich selbst ein Bild machen zu können. Ihn drücken die bildgewaltigen Vorlagen des Comics oder des Films nicht auf den Status des staunenden Betrachters. Sein Film spielt im Kopf. Und Köpfe wollen denken.
Zwangsläufig kommt es bei den historischen Betrachtungen von "Golden Age" und "Silver Age" zu einigen Überschneidungen, und die Siegel/Shuster/Superman-Kiste wird mehrfach aufgemacht - umso spannender daher, wenn sich Hartmut Kasper in "I Shall Destroy All the Civilized Planets!" Supies vergessenen Zeitgenossen widmet, die - warum bloß, fragt man sich - die Wechselbäder der Geschichte nicht überlebt haben. Etwa "Stardust, the Super Wizard" mit hochdramatischen Patentlösungen wie He releases his powerful boomerang ray, and the atom-smasher smashes itself. - Vergnüglich auch Uwe Neuholds 100-seitige Bestandsaufnahme "Aerokinese, Phasing, kosmische Kräfte", die sich unter Bezugnahme auf James Kakalios' bekanntes Buch "Physik der Superhelden" den naturwissenschaftlichen Aspekten des Themas widmet. Altgediente Comic-ExpertInnen werden in den Beiträgen vermutlich weniger Neues finden, die große Mehrheit des Publikums kann sich damit aber auf den aktuellen Analyse-Stand einer lange verfemten (und mittlerweile altehrwürdigen) Kulturform bringen lassen - und das in sehr unterhaltsamer und reich illustrierter Art und Weise.
Der literaturbezogene Teil enthält Interviews mit den Erfolgsautoren John Scalzi und Greg Bear - bei letzterem auch zum Themendreieck Wissenschaft-Science Fiction-Politik, was nicht zuletzt deshalb interessant ist, weil Bear ("Blutmusik", "Das Darwin-Virus") einem Think Tank von SF-AutorInnen angehört, der unter anderem die Bush-Regierung beraten hat. Wolfgang Neuhaus betrachtet in "Am Vorabend der Singularität" die Entwicklung der posthumanen Science Fiction, im Zuge dessen der bemerkenswerte Satz fällt: Wobei das Problem der Verständlichkeit, das im Zusammenhang mit der posthumanen SF moniert worden ist, eines der allgemeinen Bildung ist und keines der Literatur selbst. Hart, aber leider nicht ganz unwahr. - Weiters enthalten sind unter anderem Christopher Eckers Würdigung des 2008 freiwillig aus dem Leben geschiedenen Autors Thomas M. Disch ("Camp Concentration", "The Genocides") unter dem Titel "Warum wir alle Pyramiden bauen sollten" und Erik Simons Nachruf auf das ebenfalls 2008 verstorbene AutorInnenpaar Johanna und Günter Braun. Und wer immer eines von deren Genre-Werken auf dem Flohmarkt aufstöbert, sollte unbedingt zuschlagen: Mit leichtfüßigem Humor karikierten sie gut gemeinte Utopien mit Gültigkeit weit über die heimische DDR hinaus. Das reichte von der gesamtgesellschaftlichen Ebene (etwa wenn in "Unheimliche Erscheinungsformen auf Omega XI" Raumfahrer auf eine Zivilisation treffen, in der sich Produzenten und Konsumenten zu eigenen Spezies entwickelt haben, was ihren Heimatplaneten in ein müllstrotzendes Desaster getrieben hat) bis zur genialen Situationskomik im Detail: Etwa wenn in "Conviva Ludibundus" ein weltfremder Professor nicht nur mit den ausufernd katastrophalen Folgen einer Unterwasser-Expedition zu ringen hat - nein, zu allem Überdruss reist aus PR-Gründen auch noch eine Sängerin mit an Bord, die bei jeder Gelegenheit ihr famoses Chanson Die grauen schlappen Wasser zum Besten gibt. Große Empfehlung!
280 Seiten sind den Wissenschaften vorbehalten, danach folgt der Medienteil: Ein Kessel Buntes, in dem unter anderem die Space-Rocker Hawkwind noch einmal dem erlösenden Vergessen entrissen werden und Anime-Großmeister Hayao Miyazaki gewürdigt wird (im September bringt das Wiener Filmcasino übrigens eine große Miyazaki-Retrospektive!). Auf Hörspiele, Comics und Computerspiele wird dankenswerterweise auch nicht vergessen, denn was der eine wöchentlich am Plan hat, mag dem anderen exotisch erscheinen: Praktisch also, sich auch darüber informieren zu können, was sich in Medien, die man nicht so oft frequentiert, tut. Marktberichte sowie Buch- und Filmkritiken runden das Angebot ab - letztere ein traditionell vielgeliebter Reibebaum, wenn persönliche Geschmäcker auseinanderlaufen; und hier gebührt noch einmal der Bildredaktion ein Extra-Lob. - Wie üblich ist das Jahrbuch also ein unverzichtbares Werk für alle, die an Science Fiction über das bloße Konsumerlebnis hinaus interessiert sind. Nur sollte das heimische Buchregal auf einem festen Fundament stehen.
Nächsten Monat geht es unter anderem um den eingangs erwähnten neuen Roman von Robert Charles Wilson ("Julian Comstock") - außerdem nehmen wir mal unter die Lupe, was das Stichwort "Drache" so hergibt. Nicht aufstöhnen: Die Ansätze sind weiter gestreut, als man denkt.
(Josefson)