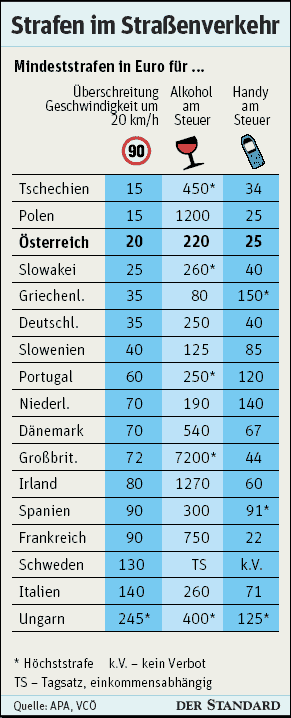Wien/Luxemburg - Hohe Spritpreise sind keine Ausrede: Autofahrer, die in Deutschland mit einem leeren Tank auf der Autobahn stranden, machen sich strafbar. Wer in der Slowakei kein Ersatzlampenset dabei hat, dito. In Österreich hingegen muss deswegen niemand ein Strafmandat befürchten - andere Länder, andere Verbote eben. Genau diese rechtlichen Unterschiede machen eine einheitliche, grenzenlose Ahndung von Verkehrsstrafen, wie sie das EU-Parlament seit längerem anstrebt, bisher unmöglich. Auch beim jüngsten Versuch am vergangenen Freitag in Luxemburg konnten sich die EU-Verkehrsminister nicht auf gemeinsame Richtlinien einigen.
Dabei ist der derzeit zur Diskussion gestellte Vorschlag auf nur mehr vier Kernbereiche beschränkt, die bei weitem die meisten Verkehrsunfälle verursachen: Tempoüberschreitungen, Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Gurt und Missachtung von roten Ampeln. Umstritten ist nicht der Deliktkatalog an sich, sondern die Frage, wie dieser verankert werden soll: als Gemeinschaftsrecht oder lediglich im Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit?
Andere Zuständigkeiten
Letztere gibt es bereits seit einigen Monaten. In Österreich ist es seit 1. Juli möglich, von einem ausländischen Gericht festgesetzte Geldstrafen bei hartnäckigem Nichtbezahlen zwangsweise einzutreiben. Betroffen sind gerichtliche Geldstrafen, etwa nach Unfällen mit Personenschäden. Im EU-Ausland fallen aber auch häufig Unfälle mit Fahrerflucht, extremes Drängeln oder das Fahren unter Einfluss von Drogen in die Zuständigkeit der Gerichte. Alko-Fahrten sind - auch ohne Unfallfolgen - ebenso häufig Vergehen, die von Gerichten geahndet werden.
"Während diese Delikte in Österreich in die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden fallen, kommt man dafür etwa in Ungarn ab einem Promillegehalt von 0,8 auch ohne Unfall vor den Richter", heißt es beim ÖAMTC. Zahle man eine solche Strafe nicht ein, müssten heimische Gerichte bei der zwangsweisen Eintreibung helfen. Voraussetzung ist jedenfalls, dass die Strafe mindestens 70 Euro beträgt, betont der ARBÖ.
Dennoch kommen viele ausländische Verkehrssünder in Österreich, aber auch viele Österreicher im EU-Ausland immer noch ungeschoren davon, weil noch nicht alle Staaten das Abkommen unterzeichnet haben.
Gegen Privateintreiber
Bei privaten Strafeneintreibern hängt es vom Goodwill der jeweiligen Heimatbehörde ab, ob Daten überhaupt übermittelt werden. Diese Methode ist generell sehr umstritten. Bei den kürzlich zu Ende gegangenen Europäischen Verkehrsrechtstagen in Luxemburg bestand Einigkeit darüber, dass es für ausländische Privatsheriffs keine Rechtsgrundlage gebe.
"Eine fixe EU-Richtlinie würde nicht nur die Durchsetzung von Vorschriften über die Verkehrssicherheit erleichtern, sondern auch gewährleisten, dass Fahrer aus dem In- und Ausland gleich behandelt werden", erläutert Zoltán Kazatsay, der stellvertretende Generaldirektor für Energie und Verkehr bei der Europäischen Kommission. Doch einige Länder, wie Polen und Großbritannien, wollen es bei der justiziellen Zusammenarbeit in Einzelfällen belassen. Ihr Argument: Eine Harmonisierung der Gesetze wäre eine zu starke Einmischung in nationales Recht.
Dass ausländische Lenker oft einer Bestrafung entgehen, wurmt hingegen alle Länder gleichermaßen. Die Stadt London hat sogar die Kampagne "Sparks" gegründet, die für eine effektivere grenzüberschreitende Ahndung von Verkehrsdelikten Lobbying betreibt.
Citymaut-Sünder
Nach Angaben von Sparks-Manager Bill Blakemore sind drei Prozent der Autos auf Londons Straßen außerhalb Großbritanniens zugelassen. "Auch wenn die meisten Fahrer dieser Autos sich an die Regeln halten, steht fest, dass sie mit doppelter Wahrscheinlichkeit die Citymaut umgehen." Statistisch seien sie um 30 Prozent häufiger in Unfälle verwickelt und würden auch häufiger beim Zuschnellfahren geblitzt. Michael Simoner/DER STANDARD-Printausgabe, 21.10.2008)