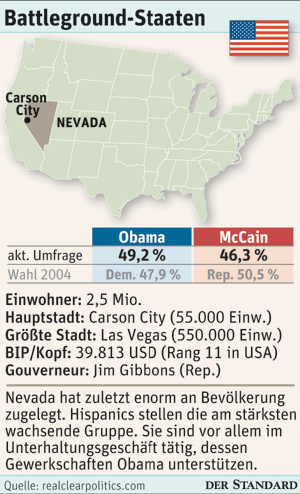Nevada gehört zu den heißumkämpften Bundesstaaten im US-Präsidentschaftswahlkampf. In den Umfragen führt Barack Obama vor John McCain. Die Wahl entscheiden dürften letztlich aber die Hispanics.
***
Eine ägyptische Pyramide ragt aus der Wüste, ein falscher Eiffelturm glänzt in der Sonne, Wolkenkratzer à la Manhattan komplettieren das Bild. Es ist eine Silhouette der Illusionen, die den Besucher in Las Vegas empfängt. Und man kann Las Vegas, rein wahltechnisch gesehen, fast gleichsetzen mit Nevada. Sieben von zehn Einwohnern des kargen Bundesstaats leben in der Stadt der Luftschlösser.
19 Jahre lang war Nevada der am schnellsten wachsende Staat der USA, bevor es 2006 vom benachbarten Arizona abgelöst wurde. Allein in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich die Bevölkerung mehr als verdoppelt. In gewisser Weise ist Nevada auch der Staat, der dem klassischen amerikanischen Mythos am besten entspricht: Alles ist Zukunft, nichts Geschichte, der Blick geht nach vorn statt zurück.
"Nevada", schreibt der Publizist Michael Barone, "ist ein Ort der zweiten Chance, ein Ort, an dem Außenseiter Erfolg haben und Gescheiterte von vorn anfangen können." Für Präsidentschaftskandidaten bedeutet das, dass sie mit allem rechnen müssen.
Langjährige Parteitraditionen fehlen, nur die wenigsten fühlen sich von vornherein einem bestimmten Bewerber verpflichtet. Unter Franklin D. Roosevelt wählte Nevada demokratisch, unter Ronald Reagan wurde es eindeutig republikanisch, aber nur, um 1992 und 1996 Bill Clinton den Vorzug zu geben (Clinton gewann mit dem Versprechen, den Bau eines Atommüllagers in den Yucca Mountains durch ein Veto zu verhindern). 2000 und 2004 behielt George W. Bush die Oberhand. Es ist die Chronologie einer Achterbahn.
Nur fünf Wahlmännerstimmen hat Nevada zu vergeben, in Kombination mit anderen westlichen Staaten (New Mexico, Colorado) könnten sie jedoch das Zünglein an der Waage bilden. Sie könnten - zumindest lassen die aktuellen Umfragen diesen Schluss zu - Barack Obama über die Hürde helfen. Entscheidend wird sein, wie die Hispanics votieren. Angelockt durch den Tourismusboom und reichlich vorhandene Jobs in der Hotel- und Glücksspielbranche, bilden sie heute knapp ein Viertel der Wählerschaft. Instinktiv neigen viele den Demokraten zu. Mit Obama wurden sie allerdings lange nicht warm; im Vorwahlduell des Winters hatte Hillary Clinton das bessere Ende klar für sich. Offen bleibt, ob der neuerdings zelebrierte Schulterschluss Clintons mit Obama ausreicht, um dem Senator aus Illinois die Gunst der Hispanics zu sichern.
John McCain wiederum hofft darauf, dass sich das sprichwörtliche Laisser-faire des Westens durchsetzt, die Abneigung gegen jede staatliche Einflussnahme. Seine eigene Popularität hält sich jedoch in Grenzen. Beim Vorausscheid der Republikaner wurde McCain nicht nur von dem Unternehmer Mitt Romney geschlagen, sondern auch von Ron Paul, dem libertären Bewerber mit seiner Devise, dass es freie Bürger am besten selber richten, ohne von den "Kindermädchen" in den weit entfernten Amtsstuben Washingtons bevormundet zu werden.
Manches spricht dafür, dass auch der notorisch staatsskeptische Westen mit seiner Cowboy-Romantik in der Finanzkrise nach staatlichen Rettungsankern verlangt - theoretisch ein Vorteil für Obama. Las Vegas ist die amerikanische Großstadt mit dem heftigsten Einbruch der Immobilienpreise (minus 28 Prozent in einem Jahr). Überdurchschnittlich viele Käufer, die Subprime-Kredite mit zunächst niedrigen, später nach oben schnellenden Zinsen aufnahmen, haben dort ihre Häuser verloren. Die Welle der Zwangsversteigerungen rollt so heftig wie kaum irgendwo sonst. (Frank Herrmann aus Washington/DER STANDARD, Printausgabe, 14.10.2008)