
Was von Mutter unsichtbar war. Ich hatte es vor Augen und konnte es nicht sehen. Es ist das von Mutter unsichtbar Gemachte. Eine Lücke mitten im Leben. Der Nebel mitten im vergilbten Bild. Ein Nichts, das da ist."
Diesem Nichts, diesem, so der Titel ihres Bandes, Mutternichts, will Christine Vescoli aus Bozen Worte geben, eine Sprache, ja eine autonome Biografie, die via Schreiben erhalten und erinnert wird.
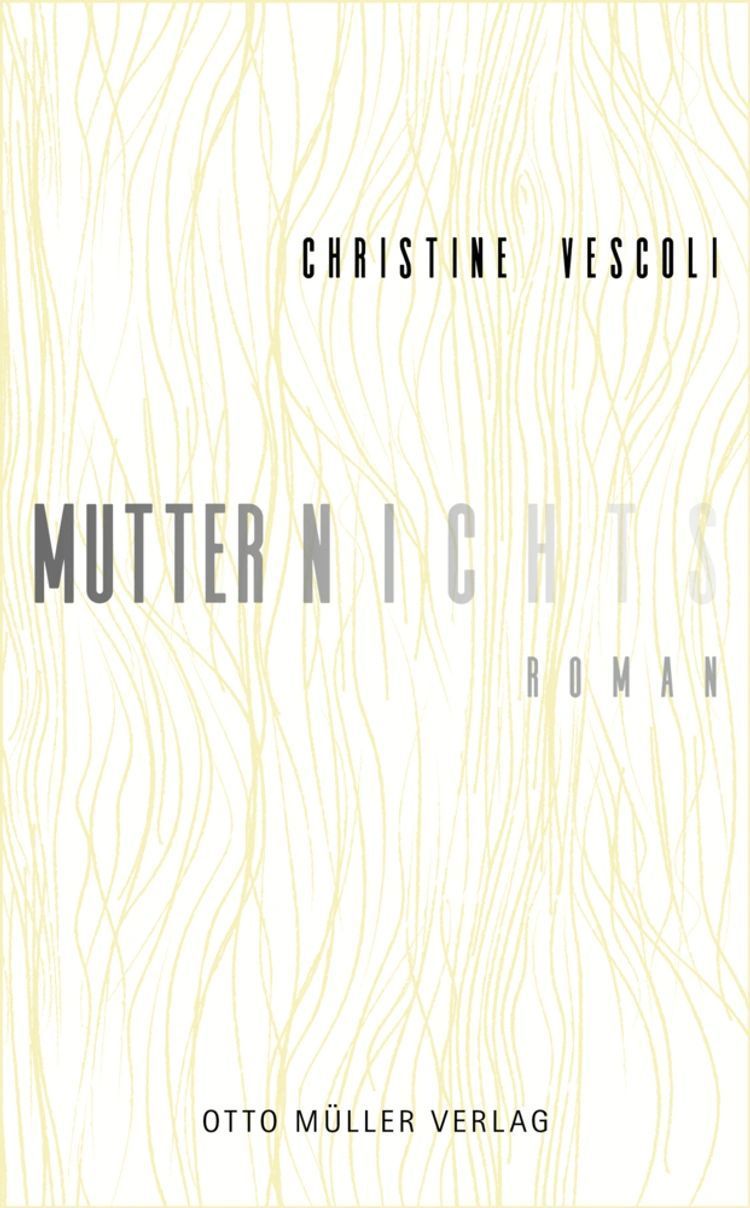
Poetischer Tonfall
In ihrem Debüt – mit 55 Jahren – findet Vescoli, studierte Literaturwissenschafterin, die seit langem die Literaturtage Lana in Südtirol leitet, den Bücherwürmern Lana präsidierte und eine Literaturzeitschrift edierte, einen eindringlich poetischen Tonfall. Ihr Duktus ist bannend, er ist sinnlich und suchend.
Selber erzählte Vescolis Mutter nichts, dies die andere Wortambivalenz im Titel, über ihr Leben, das 1940 begann und 2020 endete. Mit vier wurde sie, in eine bitterarme Südtiroler Berglerfamilie geboren, an einen anderen Hof weitergereicht, als billigste Arbeitskraft. Erst mit 20 entkam sie dem Tal, fand in der Stadt ihren zukünftigen Ehemann, der ihr ein gutes Leben verschaffte. Es ist aber auch die Geschichte der Großmutter, die in noch kargeren, noch arbeitsintensiveren Verhältnissen aufwuchs.
Sensibel tastet sich Vescoli durch die nach und nach auftauchenden Funde des mütterlichen Atlantis-Lebens, sorgsam und nirgends übermächtig noch sich überhebend über Armut, Kleinheit, Bildungsverhinderung. Ein mehr als beachtlicher, ja ein tiefbeeindruckender, ein gewichtiger Band ist dies, nur äußerlich dünn.
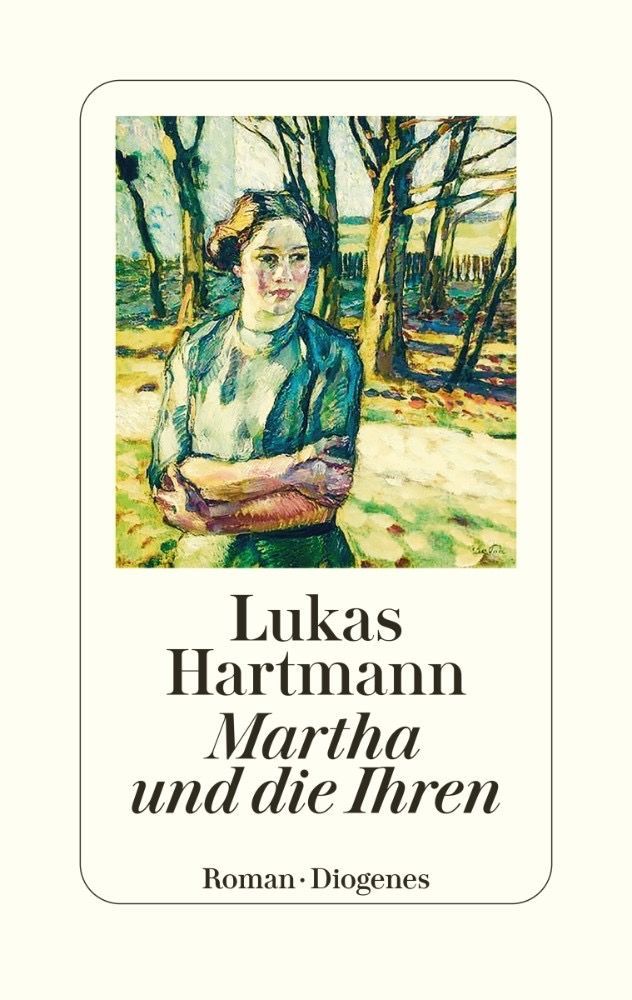
Völlige Verarmung
Der Berner Autor Lukas Hartmann, der heuer im August 80 Jahre alt wird und seit Mitte der Siebzigerjahre in großer Regelmäßigkeit Romane publiziert, geht in seinem Mutter-Buch einen anderen, erzählerisch eingängigeren Weg. Der jedoch ein recht ähnlicher ist.
Aus durchgehend sacht distanzierter Warte erzählt Hartmann von Martha, die einige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg als Achtjährige im Berner Land "Verdingkind" wird, wegen der völligen Verarmung ihrer mehrköpfigen Familie somit zu einer anderen Bauernfamilie gegeben wird. Sie boxt sich, da hart, klug und zäh, durch und hoch zu einer Anstellung in einer Berner Strickerei, zu zwei Heiraten, zwei Witwenschaften, einem großen Haus, zu zwei Söhnen, die auf unterschiedliche Weise die emotionale Kälte Marthas, einst das "Ding", an ihre eigenen Kinder weitergeben. So kommt es zwischen Marthas älterem Sohn Toni, der bei der Schweizer Post bedingungslos Karriere machen will, was ihm Gesundheit und Leben kosten wird, zu massiven Konflikten mit seinem Erstgeborenen, Bastian, der künstlerische Ambitionen hat, Lehrer wird und ganz am Ende sich anschickt, die Geschichte der Familie von Martha und den Ihren aufzuschreiben. In einer Nachbemerkung erläutert Hartmann: Es ist seine eigene Historie.
Unsichere Zukunft
Das lässt sich von Liesbet Dills Roman, der erstmals 1943 in Berlin erschien, kaum sagen. Der Original-Verlag Weichert war ein seit 70 Jahren existierender, flexibel auf Publikumswünsche und Regimewechsel reagierender Unterhaltungsverlag, der 1944 wie viele deutsche Verlage auch aufgelöst wurde. 1946 neu gegründet, im Ostteil Berlins ansässig, wurde er 1950 von den DDR-Behörden enteignet, 1952 aufgelöst, im selben Jahr gab es in Hannover eine Neugründung, die 50 Jahre lang Jugendbücher edierte. Kein Wunder also, dass die saarländische Autorin Liesbet(h) Dill (1877–1962) keine verlegerische Zukunft mehr hatte.
Als Joseph Roth 1927 das Saargebiet bereiste, reklamierte er als "einzigen Dichter, der in jener Gegend geboren ist, Frau Liesbet Dill". Sie war enorm produktiv, schrieb rund 100 Bücher, heute allesamt vergessen; ab den späten Dreißigerjahren wich sie ins Genre des historischen Romans aus. 2005 erschien in einem kleinen saarländischen Hochschulverlag ein Reprint ihres 1889 spielenden Bergarbeiter- und Streikromans Virago.
Dill erzählt in Tagebuch einer Mutter die Geschichte Olivia Nordecks, einer lebenslustigen, feinsinnigen, gebildeten musisch begabten Frau, die, da ihr Mann, ein Offizier, stirbt, über Jahrzehnte hinweg ihre Kinder allein durchbringen muss.
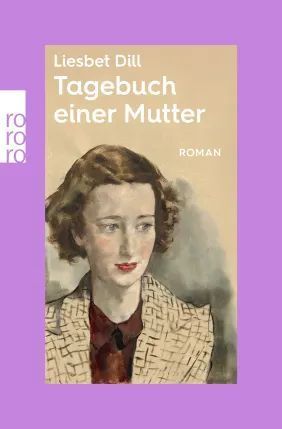
Zweite Familie gegründet
Das hatte mit Dills Leben wenig zu tun. Nach einer Scheidung gründete sie mit einem Mediziner, der Ordinarius an der Universität Halle war, später Stadtmedizinalrat von Berlin wurde, eine zweite Familie. Nach 1945 lebte sie, die mit Hugo von Hofmannsthal und Alfred Kerr, mit Gerhart Hauptmann und Hermann Bahr verkehrt hatte, in Wiesbaden in überschaubar gediegenen Verhältnissen.
In ihrem mit arg modischen, recht unpassenden Schlagworten getrüffelten Nachwort versucht die Bloggerin Magda Birkmann eine Ehrenrettung dieser Prosa, leider, ach, vergeblich. Die Schilderung des Lebens und der Schreibbiografie Dills nehmen darin großen Raum ein. Aus gutem, weil nicht zu überlesendem Grund. Denn Dills Prosa ist zeitgebunden, überschaubar lesenswert, sprachlich konventionell und durchschnittlich realistisch. Welche Gründe neben dem Geschlecht dazu bewogen haben, diesen Band wieder zugänglich zu machen, sie wiegen zu leicht.
Einen Stich ins leicht Geschmacklose offeriert zudem der Umschlag, den ein feines Frauenporträt ziert. Diese Darstellung stammt von der jüdisch-deutschen Malerin Lotte Laserstein, die sich aus Berlin nach Schweden retten konnte (und dort als Malerin jahrzehntelang in Vergessenheit geriet und erst 2018 infolge einer Einzelausstellung im Frankfurter Museum Städel wiederentdeckt wurde), war doch Dill nach 1933 auf NS-Propagandalinie umgeschwenkt und hatte Hitler literarisch glorifiziert.
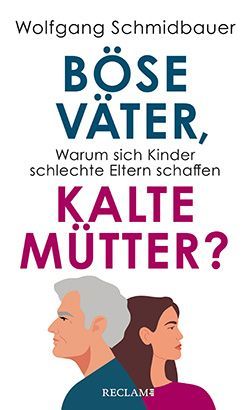
Schlechte Eltern
Mutter-Fiktionen. Mutter-Konstruktionen. Eltern-Konflikte. Der Münchner Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer (83) publiziert seit einem Halbjahrhundert zugängliche wie durchaus lesenswerte Bücher über Psychologisches. Man realisiert bei Böse Väter, kalte Mütter?, über wie viel Routine er verfügt. Dramaturgisch ist das schlüssig wie argumentativ en détail gut nachvollziehbar.
Schmidbauer beugt sich über eine Fragestellung, die im ersten Moment ketzerisch klingt, im zweiten noch immer fast ruchlos anmutet: Warum erschaffen sich, warum kreieren Kinder schlechte Eltern?
Es geht um – ein treffendes Bild – den "Brückenkopf", den Eltern angeblich, mutmaßlich, präsumtiv, präpotent im Leben ihrer Kinder bilden, lebenslang. Es geht um das Widerspiel von Scham und Projektion, von Aggression, verharzter Perspektive und Ordnung, um Lenkung und Autonomie, reklamiertes Recht (und Rechthaberei) und akklamierte Demütigungsgefühle. Im Ausklang plädiert Schmidhuber für ein kompliziertes Wort, für Ambivalenztoleranz und für eine Verhaltenskorrektur namens Gnade.
Kontrolle über die Welt
Was die Gegenwart immer stärker konstruiert, ja einfordert, ist: Kontrolle. Kontrolle über die Welt und den Alltag, über rasant sich verändernde Prozesse der Arbeitsmilieus und über das scheinbar sich viel langsamer vollziehende Werk der Kindererziehung. Ängste nicht abzuwehren, sie auch einzugestehen, Fehler nicht zu verteufeln, sondern sie zuzulassen, nicht starr auf einem unveränderlichen Punkt zu verharren, sondern flexibel zu werden – das könne, so Schmidbauer, helfen, die oft heillos dämonisierte Verknotung von Eltern-Kinder-Vorwürfen aufzulösen, Verbitterung zu reduzieren, zu einem Miteinander zu kommen. Und dann sogar Danke zu sagen.
Während der Corona-Pandemie fragte der Tiroler Dichter Peter Giacomuzzi im Text cara mamma seine Mutter: "habe ich dir jemals danke gesagt?" Und er fuhr fort: "wahrscheinlich nicht. eltern sagt man nicht ‚danke‘. oder, wenn man das sagt, schmeckt das immer ein bisschen nach moder, nach einer bigotten nuance, nach kain und abel." Und das zum Muttertag!
Der Münchner Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer, mittlerweile 83, stellt sich in seinem neuen Buch "Böse Väter, kalte Mütter?" etwa die Frage: "Warum erschaffen sich, warum kreieren Kinder schlechte Eltern?" Es geht dabei viel um Projektionen.(Alexander Kluy, 11.5.2024)